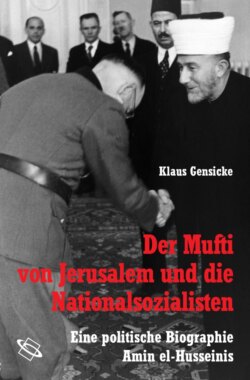Читать книгу Der Mufti von Jerusalem - Klaus Gensicke - Страница 22
3. Der Mufti im Exil 3.1Politischer Asylant im Libanon
ОглавлениеIn seinem Exil nördlich Beiruts genoß el-Husseini eine gewisse Sicherheit, zumal die Briten nichts unternahmen, um seine Auslieferung von den Franzosen zu erreichen. Von hier aus konnte er auch in absentia den arabischen Aufstand, der im April 1936 ausgebrochen war und erst im März 1939 beendet wurde, weiterschüren. Dieser fing ursprünglich als Generalstreik gegen die jüdische Einwanderung und den Landverkauf an Juden an, um dann in einen erbitterten Kampf gegen die Briten und Juden auszuarten. Der Mufti hielt ungehindert Hof im Exil, wo er weiterhin gegen die britische Mandatsmacht agitierte. Syrische Freiwillige wurden rekrutiert und in Palästina eingesetzt, so daß die Hoffnung auf Ruhe, die durch die Flucht1 des Mufti erweckt wurde, unerfüllt blieb. Bald spielten sowohl das Hakenkreuz als Erkennungssymbol als auch der „deutsche Gruß“ eine wichtige Rolle, zumal der Aufstand von den Nationalsozialisten finanziell unterstützt wurde. „Politische Oppositionelle wurden terrorisiert“ oder ermordet, und die Bevölkerung Palästinas wurde dazu gezwungen, die Rebellen umfangreich zu unterstützen.2 Für die Briten gab es keine Zweifel, daß die Terroraktionen auf Anweisung des Mufti erfolgten, was auch von einem gefangengenommenen Rebellen bestätigt wurde.3 Um einigermaßen die Lage unter Kontrolle zu bringen und den Anschluß von libanesischen und syrischen Sympathisanten an den Aufstand („Great Uprising“) zu verhindern, entschlossen sich die Briten auf Anraten Tegarts einen 50-Meilen langen Stacheldrahtzaun (Tegart’s Wall) zu errichten.4
Der Mufti intensivierte weiterhin seine Bemühungen, erneuten Kontakt zu den Nationalsozialisten aufzunehmen, da er Geld benötigte, um den Aufstand weiterzuschüren. Im November 1937 sandte er einen gewissen Dr. Said Imam aus Damaskus nach Berlin mit der Bitte um „Entsendung von Material für die Freiheitsbewegung (auch gegen Entgelt)“. Als Gegenleistung bot er die „Vorbereitung einer sympathiereichen Atmosphäre für Deutschland, die sich im Falle eines Krieges bemerkbar macht“5, an. Den wiederholten Annäherungsversuchen des Mufti standen die Nationalsozialisten jetzt weniger ablehnend gegenüber, zumal der Libanon für eine Kontaktaufnahme günstiger als das von den Briten beherrschte Palästina erschien.
Aus einer Vortragsnotiz für Canaris6 geht hervor, daß der Mufti durch die ihm von den Deutschen gewährten Geldmittel die Revolte in Palästina durchführen konnte. Allerdings vertrat die Abwehr die Auffassung, daß die Bewegung dem Mufti „aus der Hand geglitten“ sei. „Eine weitere Unterstützung des Mufti für eine Fortführung des Aufstandes ist deshalb unangebracht. Es muß jedoch gewährleistet werden, daß der Aufstand im Bedarfsfall jederzeit wieder in Gang gebracht werden kann.“ Deshalb sollte der Kontakt zum Mufti nicht abgebrochen werden, der von Deutschland und Italien eine gemeinsame Erklärung erwartete, die die Unabhängigkeit der Staaten im Vorderen Orient garantierte und darüber hinaus deren Zusammenschluß „unter eigener Oberhoheit“ begrüßen würde. Canaris regte an, daß eine derartige Erklärung noch vor Ausbruch eines Krieges erscheinen müßte, sonst würde sie als wirkungslose Propaganda betrachtet werden.7
Gegen die Unterstützung der Rebellion in Palästina gab es nach wie vor bei den Regierungsstellen in Berlin Bedenken. Hierbei wurde auf die „Unzuverlässigkeit der Araber“ hingewiesen, die „trotz der moralischen und teilweise wohl auch materiellen Hilfe“ nicht „vor rigorosen Maßnahmen gegen schutzlose deutsche Siedler […] zurückschrecken“.8 Dennoch ist es klar ersichtlich, daß das NS-Regime an eine Verständigung mit Großbritannien nicht mehr glaubte und jetzt Möglichkeiten in Erwägung zog, wie es dem britischen Empire Schwierigkeiten bereiten könnte. Aus Rücksicht gegenüber dem Achsenpartner, der seine eigenen Pläne für die arabischen Länder hegte, mußte Deutschland jedoch noch alles vermeiden, was den Argwohn Italiens erwecken könnte. Zu gegebener Zeit könnte man immer noch seine eigenen Ansprüche geltend machen.
Im Rahmen dieser Taktik erhielt el-Husseini auch über den Gesandten Grobba finanzielle Zuwendungen,9 denn es lag nach wie vor im Sinne der Nationalsozialisten, für Unruhe in Nahost zu sorgen, ohne daß sie sich dabei allzu sehr einzumischen brauchten. Im Widerwillen Hitlers, die Unabhängigkeit der Araber offen anzuerkennen, sah Grobba später den Grund dafür, „daß er (Hitler) als Prediger der Überlegenheit der arischen Rasse es nicht einsehen wollte, daß die semitischen Araber für uns eine wertvolle Unterstützung sein konnten“.10 Abwegig ist diese Meinung keinesfalls, zumal Hitler in einer zweiten Ansprache vom 22. August 1939 seine menschenverachtende Gesinnung unmißverständlich zum Ausdruck brachte: „Wir werden weiterhin die Unruhe in Fernost und in Arabien schüren. Denken wir als Herren und sehen wir in diesen Völkern bestenfalls lackierte Halbaffen, die die Knute spüren wollen.“11
Die arabischen Staaten ernannten el-Husseini zum Nominalführer einer Konferenz, die als Folge des Fallenlassens des Teilungsplans in London stattfinden sollte. Allerdings verweigerten ihm die Briten die Einreise, so daß er in Beirut zurückbleiben mußte. Zur Zeit dieser Konferenz brach Deutschland das Münchener Abkommen und proklamierte das Protektorat Böhmen und Mähren. Unter diesem zusätzlichen Druck schlug Großbritannien einen gemäßigteren Kurs ein. Sein „White Paper“ von 1939 sah eine Einstellung der jüdischen Einwanderung nach fünf Jahren, die Einschränkung von Grund- und Bodenverkauf an Juden und die Gründung eines palästinensischen Staates innerhalb von zehn Jahren vor.12 Auf Anraten des AHC, dessen deportierte Mitglieder inzwischen wieder auf freien Fuß gesetzt wurden, lehnten die arabischen Staaten diesen Plan kategorisch ab. Das „White Paper“ galt als die größte politische Errungenschaft der palästinensischen Araber seit 1918, und seine Ablehnung durch el-Husseini und das AHC war gewiß keine kluge Entscheidung.
Für el-Husseini war die Rückkehr nach Palästina nun endgültig versperrt, und sein Aufenthalt im Libanon wurde aufgrund der verschärften Überwachung durch die Franzosen für ihn unerträglich. Grobba berichtet, daß die Franzosen den Mufti unter Druck gesetzt hätten, eine Erklärung zu unterschreiben, daß er damit übereinstimme, die Franzosen führten den Krieg gegen die „Barbaren und für die Zivilisation“ und „seine aufrichtigen Wünsche begleiteten sie in diesem Kampfe“.13 Einer Unterzeichnung konnte er dadurch entgehen, daß er sich im Oktober 1939 in den Irak absetzte.