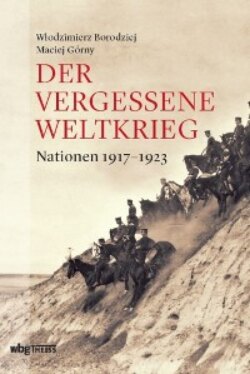Читать книгу Der vergessene Weltkrieg - Maciej Górny - Страница 10
Das demokratische Experiment in der Armee
ОглавлениеBevor die Februarrevolution die bisherige Militärhierarchie und überkommenen Gewohnheiten über den Haufen warf, sorgten die unklaren Nachrichten aus Petrograd in vielen russischen Fronteinheiten für Verwirrung, Panik und Chaos. Was sich dort gegen Winterende und Frühlingsbeginn 1917 abspielte, lässt sich kaum als Konflikt konkreter politischer Kräfte bezeichnen. Weder Vorgesetzte noch Untergebene wussten wirklich, was eigentlich vor sich geht. Wie so oft in diesem Krieg entschieden Gerüchte, Zufälle oder lokale Interessen, Sympathien und Animositäten über Leben und Tod. So war es auch im Fall des Admirals Adrian Iwanowitsch Nepenin, dem Kommandeur der in Helsingfors stationierten russischen Baltischen Flotte. Weil er nicht wusste, wer die Macht innehatte und was zu tun sei, zögerte Nepenin mit den Befehlen für die Flotte. Unterdessen kochte unter den Matrosen die Gerüchteküche. Sie hörten, in Petrograd hätten die Arbeiter rebelliert, und vermuteten, ihr Kommandeur wolle sie zur Niederschlagung der Revolte einsetzen. Diese Vermutung war nicht nur falsch (Nepenin war allem Anschein nach völlig desorientiert), sondern auch absurd: Der Weg in die Hauptstadt war von Eis versperrt und auf den Schiffen wurden keine Vorbereitungen zum Auslaufen getroffen. Trotzdem rebellierten die Matrosen. Am Abend des 3. März brach auf der Imperator Pawel I. eine Meuterei aus. Matrosen töteten einige Offiziere und hissten die rote Flagge. Dann richteten sie die Geschütze auf die Andrei Perwoswanny, woraufhin deren Besatzung sich den Meuternden anschloss. Bald schlossen sich andere Schiffe an. Nepenin verlor die Kontrolle über die Situation, konnte jedoch rasch Kontakt zum Kriegsminister der Provisorischen Regierung Kerenski herstellen, der seine Befehlsgewalt über die Flotte bestätigte. Die Matrosen müssten ihm Gehorsam leisten.
Der Triumph des Admirals erwies sich aber als Pyrrhussieg. Die Matrosen ließen die arrestierten Offiziere frei und die Besatzungen versammelten sich zu einer Kundgebung, auf der Nepenins Autorität durch aus der Hauptstadt angereiste Dumaabgeordnete bestätigt werden sollte. Ein solches Ende der Meuterei in Helsingfors hätte aber bedeutet, dass die Rädelsführer vor ein Kriegsgericht gestellt worden wären. Daran war keiner von ihnen interessiert. Die Lösung war überraschend einfach. Admiral Nepenin wurde von der Eskorte ermordet, die ihn auf dem Weg zur besagten Kundgebung begleitete. Er erfuhr also nicht mehr, dass ihn die revolutionäre Provisorische Regierung zum Vizeminister und Verantwortlichen für die russische Flotte ernannt hatte.35
Die Ereignisse in Finnland waren nicht typisch. An anderen Orten wurden normalerweise keine Offiziere ermordet, auch wenn kurzzeitige Revolten in einzelnen Einheiten keine Seltenheit waren. Meist wurden sie Schikanen ausgesetzt wie etwa ein Regimentskommandeur, dessen Untergebene zu Ostern 1917 Eier und Kuchen verlangten und ihm, weil er ihre Forderung nicht erfüllen konnte, mit dem Tod drohten. Der Kommandeur flehte auf Knien um sein Leben, doch auch wenn er letztlich verschont wurde, ist zu bezweifeln, dass er anschließend von seinen Soldaten noch respektiert wurde.36
Im März und April begann die Disziplin in den Fronttruppen zu bröckeln. Die Soldaten verweigerten die Ausführung von Befehlen, immer häufiger war auch von Frieden die Rede. Die Fälle von Verbrüderung mit dem Feind wurden zu einer solchen Gefahr für den Zusammenhalt der eigenen Reihen, dass die fraternisierenden Soldaten immer häufiger mit leichter Artillerie beschossen wurden.37 Wie die Prawda berichtete, wurde der 1. Mai (immer noch nach dem vorrevolutionären Kalender) feierlich begangen, in der vordersten Linie der Schützengräben hisste man rote Flaggen. Über den deutschen Gräben wehten die gleichen Flaggen. „An den meisten Abschnitten herrscht absolute Stille. Ganze Tage vergehen ohne einen einzigen Schuss.“38
Aus Sicht der Soldaten beider Armeen wurde das Leben in den Schützengräben etwas erträglicher. Die Empfindungen der Infanteristen waren auf beiden Seiten der Front sehr ähnlich. Ein russischer Soldat schrieb in einem Brief nach Hause:
Sobald wir unsere Stellungen erreicht hatten, gingen wir am folgenden Tag aus den Schützengräben zu den Deutschen und sie kamen zu uns. Sie ließen ihre Gewehre in ihren Gräben, wir unsere auch, und wir trafen uns, um zu reden. Sie boten uns Zigaretten an, manche auch Zigarren. Es war der 23. April, sie sagten: „Russen, schießt nicht“, und unsere sagten ihnen: „Schießt ihr auch nicht“, und wir stiegen ganz auf die Wälle der Schützengräben, sie und wir, und ihre und unsere Batterien feuerten.39
Rumänische Batterie in einem Maisfeld.
Das gleiche Bild blieb František Stanislav Petr, einem tschechischen Unteroffizier in der österreichisch-ungarischen Armee, im Gedächtnis haften. Das Frühjahr 1917 war eine ruhige Zeit, die nur manchmal von Lärm gestört wurde, allerdings nicht solchem, an den das Ohr des vom Isonzo an die Ostfront verlegten Soldaten gewohnt war:
Wir hatten uns schön eingerichtet. Die Front war ruhig, nicht so belegt wie am Tscheremosch. Ab und zu donnerten die Kanonen, aber während meiner ganzen Zeit an der Front gab es keine ernsthaften Angriffe. Das schlimmste in meinem Unterschlupf waren die Frösche, die sich im Wasser ringsum zu Tausenden drängten. Wer es nicht gehört hat, kann sich nicht vorstellen, wie nervtötend das Quaken einer solchen Froscharmee sein kann, das von morgens bis abends und weit in die Nacht hinein pausenlos andauert. Manchmal bringt es mich zur Verzweiflung.40
Petr beschreibt diese neue Art des Kriegs als Kampf, an dem sich auf beiden Seiten eigentlich nur die Artilleristen beteiligten. Weil diese meist die Artillerie und das Kommando des Gegners beschossen, das heißt die Stellungen in den hinteren Verteidigungslinien, konnten die Soldaten aus den vorderen Linien ihre Schützengräben verlassen und gemäß der ungeschriebenen Übereinkunft gemeinsam mit den ebenso agierenden Russen den beindruckenden Anblick genießen:
Geschosse und Schrapnelle formten über uns gleichsam eine feste Wand oder eher Decke, in etwa so, wie Baron Münchhausen im Regen seinen Säbel über dem Kopf kreisen ließ, sodass ihm kein einziger Tropfen auf die Nase fiel.41
Die deutsche und die österreichisch-ungarische Führung beobachteten mit wohlwollendem Interesse den Verfall der Disziplin in der russischen Armee. Man untersagte den habsburgischen Linientruppen jegliche Provokation des Feindes, um Verluste möglichst zu vermeiden. Die vorgeschobenen Stellungen wurden immer spärlicher besetzt, während die übrigen Kräfte an die italienische Front verlegt wurden, die inzwischen für das Überleben der Monarchie wichtiger geworden war. Józef Iwicki, ein Pole in deutscher Uniform, der Ende April an die Ostfront kam, stieß dort auf fast friedliche Verhältnisse:
Längere Zeit schoss überhaupt niemand. Die Soldaten beider Seiten verkehrten miteinander, zwischen den beiden Gräben herrschte reger Handel. Die Deutschen brachten den Russen Zigaretten und vor allem Rum, im Gegenzug erhielten sie Seife, Brot und andere Dinge, vor allem aber Brot. Das ging so weit, dass man das russische Brot als ständige Ergänzung der täglichen Brotration ansah. […] Einer unserer Offiziere ließ sich sogar fotografieren, als er mit einigen russischen Soldaten zusammenstand und sich mit ihnen unterhielt. Es herrschte also eine echte Waffenruhe.42
Baron Münchhausen am rumänischen Frontabschnitt, 1917.
Unterdessen wurde die von unten ausgehende Demokratisierung der russischen Armee durch die Regierung sanktioniert. Die in Russland bestehende Doppelherrschaft bedeutete, dass der Petrograder Rat und die Provisorische Regierung um die Gunst der soldatischen Massen wetteiferten. Im Mai wurde offiziell die Demokratie in der Armee eingeführt. Gewählte Soldatendelegierte sollten in den einzelnen Einheiten die wichtigsten Entscheidungen treffen. Unter anderem bestimmten sie die Verteilung der Ausrüstung und bestätigten (oder auch nicht, wie in der Demokratie üblich) die Befehle der übergeordneten Ebene. Es wurden Offizierswahlen eingeführt, was an sich noch keine Katastrophe war, denn selbst die anarchistischsten Soldaten bevorzugten professionelle Kommandeure. Die neuen Vorschriften zum Salutieren trugen dem veränderten Status der Rekruten – die nun keine Untertanen mehr waren, sondern Staatsbürger – Rechnung.
Unter anderen Umständen hätten diese Neuerungen nicht zum Zerfall der Armee führen müssen. Doch die Demokratisierung erfolgte letztlich gegen den Willen der Regierung, sie war ein Beleg ihrer Schwäche, nicht ihres Großmuts. Der entsprechende Befehl betraf zunächst nur den Militärbezirk Petrograd. Die Regierung ging vernünftigerweise davon aus, dass die Demokratisierung in der Nähe der Frontlinie fatale Auswirkungen auf die Disziplin haben könnte. Die Nachricht von der Reform verbreitete sich allerdings wie ein Lauffeuer. Im ganzen Land verweigerten die Soldaten den Gehorsam und gründeten eigene Selbstverwaltungen. In dieser Situation blieb der Regierung nichts anderes übrig, als die geschaffenen Fakten anzuerkennen und den Befehl auf alle Fronten auszuweiten.43 Nicht nur der Inhalt des Befehls, sondern auch die Art seiner Umsetzung hatte gravierende Auswirkungen für das Funktionieren der Armee. Die russischen Soldaten bekamen – oder besser: erkämpften – sich das Recht, demokratisch zu entscheiden, wem sie gehorchten und ob sie sich an einer militärischen Operation beteiligten oder nicht.
Wie folgenschwer diese Entscheidung war, zeigte sich bereits Anfang Juli. Wie bereits erwähnt, erklärte sich die Provisorische Regierung auf Druck der Verbündeten zu einer weiteren Offensive im Westen bereit, um die vor einem Jahr von der Brussilow-Offensive verfehlten Ziele zu erreichen. Während es entlang der gesamten Front in den russischen Reihen zu immer drastischeren Fällen von Ungehorsam und Verbrüderungen mit dem Feind kam, bereiste Minister Kerenski gewissenhaft die einzelnen Einheiten und warb unter den Soldaten für die geplante Operation. Ende Juni schien es, als habe er Erfolg – große Einheiten stimmten für die Offensive. Deshalb rückten die Russen am 1. Juli in Galizien, der Bukowina und in Rumänien vor. In den ersten Tagen drängten sie die Österreicher nach Westen zurück. Dieses Mal gelang es Brussilow allerdings nicht, größere Einheiten des Feindes zu zerschlagen oder Panik unter den Zurückweichenden hervorzurufen. Am 19. Juli starteten die Deutschen eine Gegenoffensive, die den Vormarsch der russischen Streitkräfte endgültig zum Erliegen brachte. Es gab keine neue Offensive mehr, sondern nur einen für die Zivilbevölkerung verheerenden Rückzug und Anfang September den Verlust Rigas, das von den Deutschen eingenommen wurde.
Beobachtung der Frontlinie, Rumänien 1917.
Die Schuld für das Scheitern der Kerenski-Offensive wird meist entweder Agenten der Mittelmächte oder den umstürzlerischen Aktivitäten der Bolschewiki (die während der Operation in Petrograd einen missglückten Putschversuch unternahmen) zugeschrieben. Die einen wie die anderen taten zweifellos alles, was in ihrer Macht stand, um den Kampfgeist der russischen Soldaten zu schwächen. In der k. u. k. Armee wurden die Einheiten an der vordersten Frontlinie von (oft ukrainischen) Geheimdienstoffizieren begleitet, die sich rege am sozialen Kontakt mit dem Feind beteiligten. Die Bolschewiki wiederum machten einen sofortigen Frieden zu ihrer Hauptforderung. Zugleich deutet vieles darauf hin, dass die bolschewistischen Aktivitäten lediglich bereits existierende Stimmungen und Emotionen in den russischen Reihen verstärkten. Als besonders effektiver Katalysator wirkten die Nachrichten aus der Heimat sowie die Unaufrichtigkeit und Ungeschicklichkeit von Kerenskis Propagandaaktion auf der Ebene der kleineren Armeeeinheiten.
Die überwiegende Mehrheit der russischen Soldaten waren Bauern. Solange die Revolution von den Arbeitern in den Städten getragen wurde, waren sie nicht unmittelbar von ihr betroffen. Letztlich erreichte sie aber auch das Land, wo sie Hoffnungen, aber auch Unruhe weckte. Die Bauern rechneten mit dem Land, das den „Vaterlandsverteidigern“ versprochen worden war. Mit der Zeit wurden ihre Forderungen immer nachdrücklicher, sie überschwemmten die zaristischen Ämter mit Briefen, die sich teils wie Petitionen, teils wie Drohungen lesen. So schrieben zwei Brüder, deren Vater gerade eine Gerichtsverhandlung um einen Bodenanteil in seinem Heimatdorf verloren hatte, an den Innenminister:
Wie Ihnen bekannt ist, hat sich jeder von uns mit großem Einsatz an der Kriegsanstrengung beteiligt und darüber hinaus blutet unser Herz, wenn wir an unsere Familien denken. Nach dem Erhalt einer solchen Nachricht von unserem Vater verlässt uns die Kraft und, obwohl wir gegen einen unnachgiebigen Feind kämpfen müssen, fehlt uns der Geist, überhaupt unser Gewehr in die Hand zu nehmen.44
Die Aussicht auf eine Vergrößerung des Besitzes (oder auch, auf russischem Territorium, des Anteils am gemeinsamen Land) war nur die eine Seite der Medaille. Die Kehrseite war die wachsende Angst, dass in Abwesenheit des Familienoberhaupts die „Reservistin“ (so nannte man die zurückbleibenden Ehefrauen der an die Front geschickten Männer) um den Familienbesitz gebracht werden könnte. Corinne Gaudin zeigt anhand zahlreicher Briefe und amtlicher Dokumente, dass schon 1915 in der russischen Provinz massenweise Bittbriefe, Petitionen und – zunehmend – auch Denunziationen verfasst wurden, deren Zweck darin bestand, das Land des Nachbarn zu bekommen, zumal, wenn der Nachbar nicht in der Armee war.45 Die Sorge um die im Hinterland zurückgelassenen Nächsten war keineswegs eine russische Besonderheit. Der ungarische Historiker Péter Hanák untersuchte Briefe ungarischer Bauern (die oft in ihrem Namen von Dorfschreibern geschrieben worden waren), die von der österreichisch-ungarischen Zensur konfisziert wurden. Ihr Inhalt besteht in einer anschwellenden Klage über Armut, Hunger, Hoffnungslosigkeit. Die Frauen der Soldaten bekennen sich zur Untreue – als Gegenleistung für Essen für die Kinder –, klagen über die korrupte Verwaltung und verurteilen immer wieder, zumal in den letzten beiden Kriegsjahren, die Männer, die noch immer im Hinterland verblieben:
[…] mein blutendes, verwaistes Herz ist von Trauer erfüllt, denn es sind nun schon drei Jahre, dass Du fern von mir bist; hier zu Hause wimmelt es von beurlaubten Soldaten, den Reichen und Glücklichen, die sich vom Soldatenschicksal freikaufen können, die Witwen und Waisen verführen. Sie haben wenigstens etwas zu verlieren […] Nur die Reichen bleiben zu Hause, den alle sind taub und blind, nur ihr Geldbeutel hat einen guten Blick … wer kann, häuft Geld an; alle Armen sind an der Front.46
Wir werden nie erfahren, was geschehen wäre, wenn man in der österreichischungarischen Armee ein demokratisches Experiment durchgeführt hätte. In der russischen Armee führte es zu einem deutlichen Anstieg der Desertionen. Anders als Ende 1916 ließ sich der Prozess nun nicht mehr aufhalten. Er verstärkte sich nämlich selbst: Die bewaffneten Deserteure marodierten im Hinterland, in den Dörfern. Die an der Front verbleibenden Bauern erfuhren, dass ihren Familien dadurch eine Gefahr drohte, vor der die schwache und unfähige Staatsmacht sie nicht schützen konnte. Darum verließen auch viele von ihnen eigenmächtig ihre Einheiten und kehren auf schnellstem Wege in die Heimat zurück. Unterwegs fielen weitere Dörfer den Plünderungen der Deserteure zum Opfer.
Die pazifistische Revolution in der russischen Armee wäre womöglich weniger heftig gewesen, wenn nicht ein zweiter Faktor zur Radikalisierung der Soldaten beigetragen hätte. Kerenski hatte mit aller Kraft versucht, sie zur Beteiligung an der Offensive zu bewegen. Die Freiwilligkeit der Teilnahme war die Grundlage der Legitimität der Operation. In diesem Punkt sollte sich die Revolutionsregierung von der zaristischen unterscheiden: Statt den Untertanen ihren Willen aufzuzwingen, realisierte sie den Willen der Bürger. Die Wirklichkeit sah freilich anders aus. Im Juni intensivierten die Militärgerichte ihre Tätigkeit und eliminierten gefährliche „Defätisten“ aus den Einheiten, was die Stimmung aber nicht verbesserte. Skeptisch waren insbesondere die Infanteristen, die wie immer die größten Verluste erleiden sollten. Aus Argumentationen wurden mitunter harte Verhandlungen, oft unter Einsatz erpresserischer Mittel. An einem Frontabschnitt erklärten sich finnische Freiwillige unter der Bedingung zum Angriff auf die österreichisch-ungarischen Stellungen bereit, dass sie sofort nach Einnahme der dritten Verteidigungslinie des Feindes von der Leibgarde abgelöst würden. Man drohte ihnen, im Fall einer Weigerung würde die Leibgarde sie angreifen. Kaum war die Vereinbarung jedoch geschlossen, wurde sie bereits aufgekündigt. Es stellte sich nämlich heraus, dass die Leibgarde, mit der die Führung parallel verhandelt hatte, überhaupt nicht kämpfen würde.47 General Carl Gustaf Mannerheim, der schon bald zum finnischen Nationalhelden werden sollte, doch 1917 noch ein guter russischer Offizier war, trieb die Infanterie einfach unter der Androhung von Artilleriebeschuss in den Kampf.48 Welcher Kampfeswille herrschte wohl in Einheiten, die auf diese Weise zur Teilnahme an der Offensive gezwungen wurden? Sicher keine uneingeschränkte, wie das Beispiel der 159. Infanteriedivision zeigt, die nach einigen Tagen ihren Vorgesetzten mitteilte, falls sie nicht binnen einer Woche von der Front abgezogen würden, könne man „für die Konsequenzen nicht garantieren“.49
Das Problem war nicht allein die Anwendung von Gewalt gegen die eigenen Soldaten. So verfuhren Ende Mai 1917 auch die Franzosen, die eine Revolte der Fronttruppen zu radikalen Schritten zwang. Am brutalsten verfuhr man damals mit einer an der Westfront eingesetzten russischen Division, die durch Artilleriefeuer zum Gehorsam gezwungen wurde.50 Die Krise in der französischen Armee konnte letztlich aber durch Verhandlungen überwunden werden. Die Bereitschaft zur Anwendung von Zwangsmaßnahmen in Kombination mit Gesprächsbereitschaft kennzeichnete eine entschlossene, selbstsichere Regierung. In Russland wurde die Androhung von Gewalt bald illusorisch, beide Seiten hielten sich nicht an geschlossene Vereinbarungen. Auf diese Weise kam zu den Krisen, die ohnehin schon die Armee erschütterten, eine weitere hinzu: eine Vertrauenskrise.