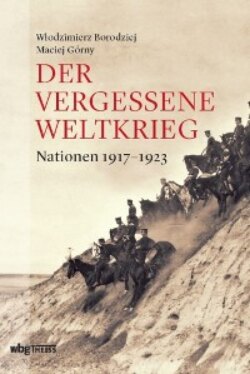Читать книгу Der vergessene Weltkrieg - Maciej Górny - Страница 18
Söldner
ОглавлениеDer Leiter des Presseamts der litauischen Regierung erklärte im zitierten Gespräch mit Paderewski und im PAT-Interview, wie Staatlichkeit entsteht: auf der Grundlage von Selbstverwaltungsstrukturen und des Militärs. Dmowski hätte ihn sehr gut verstanden. Das sogenannte Weichselland hatte dieselben Probleme wie seine nördlichen Nachbarn. Hinsichtlich der Zivilverwaltung befand sich Finnland in der besten Lage, denn dort hatte die Selbstverwaltung trotz aller Einschränkungen unter der Herrschaft von Alexander III. und Nikolaus II. eine generationenlange Tradition; sie war ein fester Bestandteil der Strukturen des Großfürstentums. In den Ostsee- und Weichselgouvernements implodierten die Selbstverwaltungen während des Kriegs, als ihnen – noch innerhalb des zaristischen Imperiums oder unter deutscher Besatzung – die Staatsmacht die Last der Verwaltung von Mangel und Hunger aufbürdete.
Umgekehrt verhielt es sich mit dem Militär. Finnland besaß – wie wir schon schrieben – keine ausgebildeten Rekruten. Umso wichtiger waren sowohl die Jäger als auch von der Goltz’ deutsches Expeditionskorps. Die konservative finnische Presse druckte – auf Deutsch – Lobgesänge auf den Verbündeten: Der berühmte deutsche Krieger habe sein Schwert zur Verteidigung des kleinen Nachbarn im Norden gezogen, er kämpfe für dessen rechtmäßige, bürgerliche Ordnung und Freiheit. Und für mehr:
Ihr wisst ebenso gut wie wir, dass wir nicht Krieg führen um eine Klasse zu unterdrücken, sondern dass dieser Krieg, in dem heute finnisches und deutsches Blut gemeinsam fließt, ein Kampf ist, um tausendjährige Errungenschaften unserer westeuropäischen Kultur vor der zunächst von Finnland, indirekt aber von der ganzen Welt von Osten her drohenden Gefahr von Anarchie und Umsturz zu schützen.
Eine maßgebliche Rolle spielten die seit Jahrhunderten engen deutsch-finnischen Beziehungen:
Gibt es doch kein zweites großes Kulturvolk, mit welchem wir Finnländer uns so dem Geiste nach verwandt fühlen wie Deutschland, keine andere große fremde Kultur, die bei uns so zu Hause wäre wie die deutsche, keine zweite Kultursprache, die hier so verbreitet ist, wie die deutsche.21
Der schwedischsprachige Mannerheim hätte als Wahlfinne derlei unterwürfige Adressen als Gebot der Stunde betrachten oder sie achselzuckend ignorieren können. Doch nun hatte er in seiner täglichen Arbeit den Weg zur Eigenstaatlichkeit im Bund mit den Deutschen zu gestalten. Er tat dies mit äußerst gemischten Gefühlen. Im März 1918, als der Bürgerkrieg noch keineswegs entschieden war, schrieb er an seine Tante:
Wir haben schon eine Menge schwerer Arbeit verrichtet und ich vermute, bald kommt der Tag, an dem wir endlich Südfinnland helfen können. Ich glaube, wir könnten das Land aus eigener Kraft säubern, aber jetzt, mit der Hilfe der Deutschen, geht es natürlich wesentlich schneller und auf diese Weise schonen wir viele Menschenleben. Doch wäre das Gefühl, ohne Hilfe von außen einen ungleichen Kampf gekämpft und gewonnen zu haben, überaus wertvoll und wichtig für die Zukunft des Volkes. Alles, was leicht errungen wird, härtet ein Volk ja nicht ab, doch dessen bedarf es, wenn man auf eigenen Beinen stehen und andere dazu bringen will, die eben errungene Unabhängigkeit zu achten.
Im November ließ der ehemalige zaristische General und Vater der finnischen Unabhängigkeit eine noch skeptischere Haltung zu den wenigen in finnischem Dienst verbliebenen deutschen Söldnern erkennen:
Ich halte nicht für unmöglich, dass wir den Rest der deutschen Ostseedivision im Land behalten können, ohne unser Ansehen bei den Westmächten deutlich zu verschlechtern, doch ich bezweifle sehr, dass es sinnvoll wäre. Das würde erstens bedeuten, dass wir in den bevorstehenden Gesprächen mit den Westmächten einen Trumpf weniger in der Hand hätten, und zweitens würde es unser Volk in der vielleicht angenehmen, aber gefährlichen Illusion wiegen, wir könnten uns bei der Verteidigung gegen innere oder äußere Feinde auf fremde Hilfe verlassen. Ich kann mir auch kaum vorstellen, dass eine Regierung wirklich unabhängig ist, solange ein so politisch engagierter und intriganter General wie von der Goltz im Land ist.22
Mannerheim stand mit seinen Ansichten nicht allein. Päts, Ulmanis, Laidoner und Smetona hatten die Unabhängigkeit ebenfalls mithilfe deutscher „Freiwilliger“, de facto Söldner, erkämpft. Die Geschichte der sogenannten Freikorps in den baltischen Staaten ist stark mythologisiert. Man sieht ihre Brutalität, die zahlreichen – teils gleichsam nebenbei begangenen – Kriegsverbrechen auf dem lettischen oder litauischen Land (oder auch in der Stadt, wo entsprechende Fälle es in den Lokalteil der Tageszeitung schafften), und macht sie zu Vorläufern des Nazismus, die im Namen der Rassenüberlegenheit Unschuldige ermorden. Klaus Theweleit spricht in diesem Kontext noch vom „Männlichkeitskult“, von der Erfüllung der Fantasie von der Überlegenheit des eigenen Kollektivs – und der beliebigen Bestrafung der anderen – nicht nur über die suspekten Männer anderer Nationen, sondern auch über die Frauen.23 Das alles stimmt sicher, doch man kann diese Geschichte auch weniger postmodern betrachten. Der litauische Historiker Tomas Balkelis befasst sich seit Jahren mit der Geschichte der Freikorps.24 Er widerspricht weder Theweleit noch den zahlreichen anderen Forschern zu den Vorläufern des Nazismus, sondern ergänzt ihre Erkenntnisse. Auf dem Territorium des späteren Litauens – die Einwohnerzahl wich nur unwesentlich von den drei Millionen Finnlands ab – wurden rund 64.000 Rekruten mobilisiert. 11.000 von ihnen fielen, 15.000 gerieten in Gefangenschaft. In der zaristischen Armee dienten 1917 ca. 30.000 Soldaten, ein Zehntel davon infolge der Ethnisierung in litauischen Regimentern. Der zum Ministerpräsidenten berufene Augustinas Voldemaras musste sich beim Aufbau der Armee auf ehemalige zaristische Offiziere stützen, die oft kein Litauisch sprachen. Anfang Oktober 1918 zählte die Armee elf unbewaffnete Freiwillige, einige Wochen später 150 (darunter 82 Offiziere). Am 29. Dezember veröffentlichte die Regierung – auf Litauisch, Polnisch, Weißrussisch und Jiddisch – einen Appell zum freiwilligen Eintritt in die Armee. Sie versprach monatlich 100 Mark Sold und einen Sozialzuschlag (50 Mark) für die Familie des Freiwilligen. Im Januar wuchs die Armee auf 3000 Soldaten an, im Februar auf 4500. Im Februar 1919 wurde die oben erwähnte Mobilisierung der Jahrgänge 1897 und 1898 bekannt gegeben. Es meldete sich die Hälfte der 17.400 registrierten Männer. Im Mai hatte die Armee 10.000 Soldaten. Am 20. Juni folgte Litauen dem estnischen Beispiel: Die Regierung versprach den Soldaten Land. Bei der nächsten Mobilisierung im Oktober meldeten sich 13.000 von 34.000 Wehrpflichtigen.
Im Frühjahr 1919 jedoch stand Litauen den Offensiven der Roten Armee und der Polen wehrlos gegenüber. Ober Ost war schon Vergangenheit. Die kriegsmüden 50-Jährigen aus dem deutschen Landsturm kehrten nach Hause zurück, wo auf die meisten eine Familie, Kinder und oft – wenngleich keineswegs immer – der alte Arbeitsplatz wartete. Weitaus schlechter war die Lage der Jungen und Jüngsten. Ein Teil von ihnen war von den Ideen der Revolution angesteckt worden. Andere hassten die Roten, sie gaben ihnen – und nicht Wilhelm II., Hindenburg und Ludendorff – die Schuld an der erlittenen Demütigung, an den sinnlos in den Schützengräben Flanderns und Frankreichs verbrachten Jahren und an der Zerstörung der Welt, die sie wenige Jahre zuvor zurückgelassen hatten, um das Vaterland gegen slawische Barbarei und französische Dekadenz zu verteidigen. Die einen wie die anderen kannten kein anderes Mittel zur Konfliktlösung als Gewalt.
Die Briten kannten dieses Syndrom. Sie warben 10.000 ehemalige Soldaten als sogenannte Black and Tans zum Dienst in Irland an, wo ihre Brutalität sich gegen die Separatisten von Sinn Féin und der Irish Republican Army als nützlich erweisen konnte. Auch die Deutschen lagerten ihr Problem aus – in von der Goltz’ Korps in Finnland und in die Freikorps in den baltischen Staaten. Die vom zivilen Leben frustrierten arbeits-, mittel- und perspektivlosen ehemaligen Rekruten unterschrieben in den regionalen Anwerbestellen lukrative Verträge als Söldner in den Kriegen gegen die Bolschewiki. Sie erhielten 900 Mark pro Monat und konnten für diesen Lohn zu der einzigen Arbeit zurückkehren, die sie gelernt hatten – zum Töten. Das heißt nicht, dass sich in den Freikorps ausschließlich spätere Nazis gesammelt hätten. Der erste Anwerbeappell klang wie ein Satz aus einem schlechten Westerndrehbuch („wem der Übergang vom Militärdienst ins Zivilleben schwerfällt, wer noch immer neue Länder kennenlernen will“, der solle sich den Reihen der furchtlosen deutschen Ritter anschließen). Das erste Kontingent sächsischer Freiwilliger in Litauen wurde rasch wieder nach Hause geschickt, weil die Söldner nach dem Vorbild des Herbsts 1918 anfingen, Soldatenräte zu gründen und die Autorität der Offiziere infrage zu stellen. Anschließend kämpften die Deutschen einige Wochen lang vertragsgemäß – bis zum erwähnten Putsch in Libau am 16. April 1919 und bis zur Niederlage in der Schlacht von Wenden.
Dies ist kein Buch über die Geschichte der Diplomatie, doch an dieser Stelle kommen wir nicht an ihr vorbei: Die sozialdemokratische Regierung in Berlin unterstützte die Werbung für die Freikorps und kontrollierte bis zu einem gewissen Grad ihre Aktivitäten in den baltischen Ländern. Die diplomatischen Vertreter der Entente in der Region hatten ambivalente Gefühle. Die Söldner waren eine große Hilfe im Kampf gegen die Bolschewiki, doch sie waren bis vor Kurzem Feinde gewesen und handelten ausschließlich im eigenen Interesse. Am 5. August 1919 forderten die Westmächte den Abzug der Freikorps aus den baltischen Ländern. Die Berliner Regierung befahl den Rückzug. Die Söldner verweigerten jedoch den Gehorsam und schlossen sich Bermondt-Awaloffs Westrussischer Befreiungsarmee an. Am 11. November 1919 verloren sie vor Riga eine weitere Schlacht gegen die lettisch-estnische Armee und verschwanden – zumindest vorerst.
Sie hinterließen Erinnerungen, die aus heutiger Sicht eindeutig negativ wirken. Theweleit, Balkelis und andere sehen in ihnen eine Reinkarnation der Landsknechte, deutscher und schweizerischer Söldner, die im 16. Jahrhundert Europa verwüsteten. Gleichwohl war der Mythos, der sich in der Zwischenkriegszeit um sie rankte, weder in Deutschland noch erstaunlicherweise in den baltischen Ländern negativ konnotiert. Vielmehr wurden sie für paramilitärische Organisationen und in Veteranenkreisen zu vorbildlichen Soldaten, die fern des Vaterlands für die richtige Sache kämpften. Deshalb sprach man auch von Freiwilligen. Das klang wesentlich freundlicher als „Söldner“.