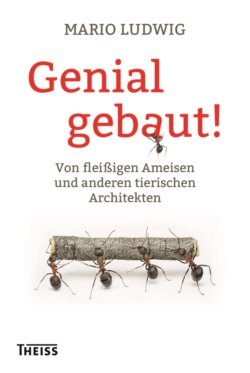Читать книгу Genial gebaut! - Mario Ludwig - Страница 11
Warum der Specht beim Zimmern kein Kopfweh bekommt
ОглавлениеWährend der Eisvogel seine Bruthöhlen im Erdreich von Steilufern anlegt, setzt der Buntspecht ganz auf Holz, wenn es darum geht, eine sichere Unterkunft für den Nachwuchs zu schaffen. Er wählt dazu solches Holz, das er mit seinem scharfen, meißelartigen Schnabel gut bearbeiten kann und das er vor allem in lichten Laubwäldern mit altem Baumbestand findet. Da aber auch der kräftigste Spechtschnabel mit gesundem Kernholz seine Mühe hat, bevorzugt der Buntspecht zur Anlage seiner Nisthöhlen morsche oder kranke Bäume.
Da Buntspechte hohe Anforderungen an ihre künftige Behausung stellen, arbeiten sie zunächst an mehreren potenziellen Höhlen gleichzeitig, bevor sie sich im letzten Bauabschnitt endgültig für die Bruthöhle ihrer Wahl entscheiden. Es kann aber auch durchaus vorkommen, dass eine bereits fertiggestellte Bruthöhle letztendlich keine Gnade vor den strengen Spechtaugen findet. In diesem Fall kennt der Buntspecht kein Pardon und beginnt mit den Bauarbeiten wieder ganz von vorne. Beim Bau der Nisthöhle ist übrigens Arbeitsteilung angesagt – Männchen und Weibchen wechseln sich beim Zimmern in regelmäßigen Abständen ab. Zur Fertigstellung der Höhle benötigt das Paar je nach Holzbeschaffenheit zwischen ein bis drei Wochen.
In der Stadt, wo es naturgemäß an geeigneten Nistbäumen mangelt, greift der Buntspecht auch einmal auf wärmegedämmte Fassaden als Nistplatz zurück. Die bunten Zimmerer durchlöchern den Putz mit ihrem Schnabel und legen sich eine komfortable Nisthöhle im Dämmmaterial an.
Der Aufbau der Bruthöhle selbst, ist dabei vergleichsweise simpel. Vom Einschlupfloch, das oft nur einen halben Meter über dem Boden liegt, führt ein sehr kurzer waagrechter Zugang zu einer senkrechten Höhle, in die das Weibchen nach Fertigstellung zwischen fünf und sieben Eier legt. Ein richtig schön ausgepolstertes Nest bauen Buntspechte nicht. Als Nistunterlage dienen einige Holzspäne, die die Spechte beim Bau der Höhle auf dem Boden zurückgelassen haben.
Buntspechte nutzen ihren scharfen Schnabel nicht nur zum Wohnungsbau, sondern auch zur Kommunikation.
Buntspechtmännchen sind gute Väter. Im Gegensatz zu den meisten anderen Vogelarten nehmen sie beim Bebrüten der Eier die dominante Rolle ein. Nachts bebrüten sie zum Beispiel das Gelege ausschließlich. Dabei ist die Brutdauer beim Buntspecht relativ kurz. Bereits nach acht bis neun Tagen schlüpfen die Jungen, die dank Fütterung mit proteinreicher Nahrung schnell heranwachsen und bereits nach drei Wochen flugfähig sind.
Verlassene oder nicht vollendete Buntspechthöhlen erfüllen übrigens in unseren Wäldern eine wichtige Funktion: Sie dienen für viele andere Tierarten wie Kohl- und Tannenmeisen, Eichhörnchen, Siebenschläfer oder Fledermäuse, die wegen mangelndem körpereigenen Werkzeug nicht in der Lage sind, sich eine eigene schützende Nisthöhle zu zimmern, als „Secondhandwohnhöhle“. In der Wissenschaft werden solche Tiere als „sekundäre Höhlenbrüter“ bezeichnet.
Buntspechte nutzen ihren scharfen Schnabel nicht nur, um sich komfortable und sichere Unterkünfte anzulegen, sondern auch zur Nahrungssuche, indem sie im morschen Holz unter der Baumrinde nach leckeren Larven stochern. Bekannt sind auch die sogenannten Spechtschmieden – Baumspalten oder selbst gezimmerte Baumvertiefungen, in die der Specht Nüsse oder Zapfen eingeklemmt, um dann gezielt die Samen herauszuhacken. Und zu guter Letzt setzt das Buntspechtmännchen seinen Schnabel auch ein, um die Damen zu beeindrucken. Mit seinem berühmten Getrommel will es nicht nur lästige Rivalen aus dem eigenen Revier fernhalten, sondern vor allem zu Beginn der Balzzeit willige Weibchen anlocken. Gehämmert wird dabei auf alles, was gute Resonanz verspricht – beispielsweise hohle Bäume oder tote Äste. Gerne nutzt der Buntspecht in Zivilisationsnähe aber auch Blechschornsteine, Regenrinnen, Fernsehantennen oder Telefonmasten für seine Trommelwirbel. So kann er seinen Trommelsignalen sogar eine persönliche Note verleihen, was für die Revierabgrenzung sicherlich von Vorteil sein kann. Der Buntspecht ist übrigens der schnellste Trommler unter den Spechten: Bis zu 20 Schläge pro Sekunde und das über viele Stunden hinweg – davon können auch Profischlagzeuger nur träumen.
Wissenschaftler haben unlängst herausgefunden, dass manche Spechte bis zu 12.000-mal am Tag mit ihrem Schnabel gegen Bäume hämmern. Eine vor Kurzem in einer renommierten Fachzeitschrift veröffentlichte Untersuchung zeigte, dass dabei der Aufprall des Schnabels mit einer Geschwindigkeit von sieben Metern pro Sekunde erfolgt. Wer wissen will, wie sich das anfühlt, schlage einmal versuchsweise seinen Schädel mit 25 Kilometer pro Stunde an die Wand. Da stellt sich natürlich die Frage, wie schaffen die Spechte das, ohne Kopfschmerzen oder gar eine Gehirnerschütterung zu bekommen? Warum sind unsere Wälder also nicht voll von Spechten, die vom Hämmern völlig benommen am Boden liegen?
Es gibt gleich mehrere wissenschaftliche Publikationen, die präzise erklären, warum dem Specht trotz intensivster Kopfarbeit nicht der Schädel brummt. Das Geheimnis der Spechte liegt in der speziellen Anatomie und Biomechanik ihres Schädels. Zunächst einmal unterscheidet sich der Spechtschädel von den Schädeln aller anderen Vogelarten dadurch, dass auf einer gedachten Achse vom Schnabel durch den Schädel nur Knochen liegen. Anders als beispielsweise bei einer Taube, bei der diese Achse mitten durch das Gehirn verläuft, liegt beim Buntspecht und seinen Verwandten das Gehirn deutlich oberhalb dieser Achse und bekommt so bei den Stößen nicht allzu viel ab. Außerdem ist das Gehirn im Schädel nur von äußerst wenig Gehirnflüssigkeit umgeben und füllt den relativ kleinen Spechtschädel fast vollständig aus, sodass es beim Aufprall kaum hin- und herschwappen kann.
Der wichtigste Schutz für den Spechtschädel ist jedoch ein raffiniertes körpereigenes Stoßdämpfersystem: Auch die Kiefermuskulatur leistet beim Specht ihren Beitrag zum Schutz des Gehirns. Die außerordentlich starken Muskeln ziehen sich wenige Millisekunden vor dem Aufprall zusammen und absorbieren einen Großteil der Energie. Nach neueren Erkenntnissen sorgt zudem eine schwammartig aufgebaute Knochensubstanz, die sogenannte Spongiosa, dafür, dass die beim Hämmern entstehenden Stoßkräfte auch noch von der Schädeldecke selbst abgedämpft werden.
Aber Buntspechte verhindern noch mit einem weiteren Trick, dass sie beim „Zimmern“ ihrer Wohnhöhle ernsthaft zu Schaden kommen können. Dabei kommt es auf ein genaues Timing an: Nur eine Millisekunde vor dem Aufprall der Schnabelspitze schließen die Spechte ganz kurz ihre Lider. So sind die Augen der Vögel zuverlässig vor den umherfliegenden spitzkantigen Holzspänen geschützt. Die Nasenlöcher des Buntspechts wiederum sind mit feinen Federn überwachsen. So wird verhindert, dass der Buntspecht den beim Hämmern entstehenden Holzstaub einatmen muss.