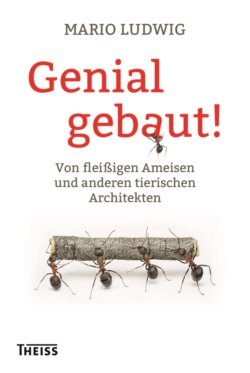Читать книгу Genial gebaut! - Mario Ludwig - Страница 7
ОглавлениеEinleitung
Tiere als Baumeister? Auf den ersten Blick passen diese beiden Begriffe scheinbar nicht zueinander – aber nur scheinbar. Wie bei uns Menschen findet man auch im Tierreich Stararchitekten, begnadete Baumeister, ausgefuchste Ingenieure sowie geschickte Handwerker. In der Welt der Tiere wird ebenso gebuddelt, gemauert, geklebt, genäht oder geflochten. Und so unterschiedlich wie die Bauart ist das fertige Produkt: Da gibt es Singlewohnungen, Luftschlösser, unterirdische Millionenstädte, gewaltige Wolkenkratzer, Gefängnisse oder Wohnmobile – sogar einen sozialen Wohnungsbau.
Wenn wir an tierische Architekten denken, kommen uns wahrscheinlich zuerst die Nester unserer Vögel in den Sinn – Nester, die unsere gefiederten Freunde zur Ablage ihrer überaus zerbrechlichen Eier und später als Kinderstube für den Nachwuchs benötigen. Dabei sind die Nester, die außen möglichst solide und innen möglichst behaglich sein sollen, in Bauweise und Materialzusammensetzung oft genauso unterschiedlich wie die rund 10.000 bekannten Vogelarten. Jedes Vogelnest bzw. jede Bruthöhle ist ein Kunstwerk für sich: Während Amsel, Fink und Meise für Brutgeschäft und Aufzucht der Jungen auf ein vergleichsweise simples, aber in Vogelkreisen weit verbreitetes Napfnest setzen, kleben Mehlschwalben mit viel Geduld und Spucke Lehmnester unter die Dachtraufen und Torbögen unserer Städte. Apropos Spucke: Das Nest der Salangen, den in riesigen Kolonien brütenden, südostasiatischen Vettern unseres heimischen Mauerseglers, besteht zu 100 Prozent aus dem eigenen Speichel. Ein solches Nest erzielt – als wichtigste Zutat der sogenanntes „Schwalbennestersuppe“ – Höchstpreise bei den chinesischen Liebhabern dieser Delikatesse.
Eisvögel graben dagegen metertiefe Bruthöhlen in Uferböschungen. Der Schneidervogel greift zu Blatt und Faden und schneidert sich – nomen est omen – sein tütenförmiges Nest selbst zusammen. Ähnlich geht die Schwanzmeise beim Nestbau vor, die ihre Nester mit einem selbstgebastelten Klettverschluss zusammenhält. Sogar echte Zimmerleute sind in der Welt der Vögel zu finden: Die Spechte, die dank ihres harten Schnabels in der Lage sind, komfortable Bruthöhlen in unsere Waldbäume zu meißeln. Noch einen Schritt weiter geht das Weibchen des Doppelhornvogels, der in den Regenwäldern Südostasiens zu Hause ist. Diese Vogeldame mauert sich zum Schutz vor Fressfeinden selbst in ihre Bruthöhle ein und ist auf den Goodwill ihres Männchens angewiesen, das nach erfolgreicher „Einkerkerung“ ganz allein für die Versorgung von Weibchen und Brut verantwortlich ist.
Andere Vögel, wie etwa das Thermometerhuhn, halten dagegen nichts davon, ihre Eier selbst auszubrüten, sondern errichten stattdessen in monatelanger Kleinarbeit riesige Bruthügel, in denen Sonneneinstrahlung und Gärungswärme das Brutgeschäft für sie übernehmen. Die richtige Bruttemperatur können sie dabei mit einer Art Biothermometer im „Schnabel“ überprüfen.
Um regelrechte Vogelwohnanlagen, in denen bis zu 150 Familien Platz finden, handelt es sich dagegen bei den Gemeinschaftsnestern der afrikanischen Siedelweber. Die sperlingsgroßen Vögel arbeiten bei Bau, Instandsetzung und Verteidigung ihrer riesigen, oft tonnenschweren Nester eng zusammen – ein sozialer Wohnungsbau der besonderen Art.
Säugetiere gehören im Gegensatz zu den Vögeln sicherlich nicht zur Elite der tierischen Baumeister. Aber wie fast immer gibt es auch hier die berühmten Ausnahmen von der Regel. So errichten amerikanische Präriehunde riesige unterirdische Megacitys, in denen mehrere Millionen Tiere wohnen und leben können. Jede Präriehundefamilie bewohnt dabei ihr eigenes Viertel und verfügt dort – in einer Wohnanlage der Luxusklasse – über Schlafhöhlen, Vorratskammern und sogar Toiletten. Denn auch Präriehunde legen Wert auf Sauberkeit. Für frische Luft in der Megastadt sorgt ein ausgeklügeltes Belüftungssystem.
Und auch unser heimischer Maulwurf hat es sich unter der Erde in einem selbstgegrabenen, raffiniert angelegten Tunnelsystem gemütlich gemacht. Lebensmittelpunkt der kleinen Tiere mit dem samtigen Fell ist der sogenannte Wohnkessel. Von hier aus begibt sich der Maulwurf in extra angelegten Gängen auf die Jagd nach Regenwürmern, die er später in seinen berühmt-berüchtigten Frischfleischspeisekammern deponiert. Was dem Maulwurf sein unterirdisches Reich ist, ist dem Biber seine Burg. Deren Zugänge müssen aus Sicherheitsgründen stets unter Wasser liegen, um Fressfeinden den Zutritt zu erschweren. Damit die Eingänge nicht trockenfallen, stauen die Biber ihr Wohngewässer mit selbstangelegten Dämmen auf. Bei diesen Staudämmen handelt es sich um technische Meisterwerke, die mehrere hundert Meter lang werden können und so stabil sind, dass ein Mensch sie sogar auf einem Pferd reitend überqueren kann. Möglich macht das die Fähigkeit des Baumeisters Biber, bis zu einen Meter dicke Bäume zu fällen. Das schafft er durch seine speziellen Nagezähne. Die sind nicht nur selbstschärfend, sondern wachsen auch ein Leben lang nach. Durch seine Fähigkeit, Dämme zu bauen, ist der Biber übrigens das einzige Lebewesen neben dem Menschen, das seinen Lebensraum selbst gestalten kann.
Die absoluten architektonischen Superstars im Tierreich finden wir bei den Insekten, genauer gesagt, bei den sogenannten sozialen Insekten wie Ameisen, Termiten, Bienen und Co. Und die geben sich nicht mit Einzimmerwohnungen zufrieden, sondern bauen gleich ganze Städte mit Millionen von Einwohnern. Einem regelrechten Gigantismus in Sachen Hausbau sind zum Beispiel mehrere Termitenarten Südafrikas verfallen. Die kleinen Insekten errichten aus einer Mischung aus Lehm, Sand, Speichel und Kot Wohntürme, die es sowohl Größe als auch Ausstattung betreffend durchaus mit unseren höchsten Wolkenkratzern aufnehmen können.
Tropische Blattschneiderameisen können dagegen mit riesigen unterirdischen Farmen aufwarten, in denen sie gezielt der Pilzzucht nachgehen. Auch die Ausstattung der Behausungen dieser koloniebildenden Ameisen, die manchmal 10 Millionen Individuen und mehr beherbergen, kann sich durchaus sehen lassen. Dafür sorgen Klimaanlage, Zentralheizung, Vorratsräume, aber auch Müllhalden und sogar eigene Friedhöfe.
Aber auch unsere heimischen Insekten brauchen sich in Sachen Baukunst keineswegs zu verstecken: Wespen und Hornissen bauen kunstvolle Papiernester. Honigbienen dagegen erzeugen ihren Baustoff selbst. Die kleinen Honigsammlerinnen produzieren aus speziellen Drüsen am Hinterleib täglich kleine Wachsblättchen, die als Bausubstanz für die berühmten sechseckigen Waben dienen, in denen die Brut des Bienenstocks aufgezogen wird.
Das größte Bauwerk der Welt und das einzige neben der Chinesischen Mauer, das man auch vom Mond aus sehen kann, wurde nicht von uns Menschen, sondern von Tieren erbaut: das weltberühmte australische Great Barrier Reef. Bei den fleißigen Baumeistern dieser gigantischen Struktur handelt es sich um Billionen und Aberbillionen winziger Lebewesen: die Korallenpolypen. Wer hätte so eine Leistung ausgerechnet von sogenannten „niederen“ Tieren erwartet?
Aber auch, wenn es um das Baumaterial geht, stellen die tierischen Baumeister uns oft locker in den Schatten. So können zum Beispiel Spinnen und Schnecken ihre Bausubstanz in körpereigenen Drüsen selbst herstellen. Bei den Wanderameisen dient sogar der gesamte eigene Körper als Bausubstanz: Zum Bau einer Unterkunft verhaken sich viele Tausende der kleinen Krabbler gegenseitig mit ihren Beinen ineinander, sodass letztendlich ein überaus „lebendiges“, aber auch komplexes Nest entsteht, das in seinem Inneren die Ameisenkönigin und ihre Brut vor Fressfeinden schützt.
Einige wenige Tiere haben es sogar geschafft, sich eine transportable Unterkunft zuzulegen – ein nicht zu unterschätzender Vorteil. So bietet ein Schneckengehäuse oder die steinerne oder hölzerne Röhre einer Köcherfliegenlarve zuverlässigen Schutz bei gleichzeitiger Mobilität. Aber tierische Baumeister setzen ihre Kunst nicht nur zum Errichten von Behausungen, sondern auch zum Beutefang ein. Das demonstrieren vor allem viele Spinnenarten mit ihren vielfältigen Netzwerken, Ameisenlöwen mit ihren heimtückischen Rutschtrichtern, aber auch Schimpansen, die sich ab und zu einen Speer basteln, um sich auf die Jagd nach anderen Affen zu begeben. Und dann wären da noch die männlichen Tiere, die ihre Baukunst einsetzen, um ein geneigtes Weibchen von ihren sonstigen Qualitäten zu überzeugen. Besonders raffinierte „Fortpflanzungsbaumeister“ sind Laubenvogel, Hüttenvogel und Co. Sie müssen sich allerdings gewaltig anstrengen, um ihre Konkurrenz durch ein besonders gelungenes Bauwerk auszustechen. Nur dann haben sie die Chance, ihre Gene erfolgreich weiterzugeben.
Und wer glaubt, der Bau von Möbelstücken sei nur uns Menschen vorbehalten, der sollte vielleicht einmal die raffiniert konstruierten Schlafstätten von Orang-Utans und Schimpansen genauer unter die Lupe nehmen.
Oft sind die tierischen Architekten und Baumeister der Natur – dank außergewöhnlicher Materialien, aber auch sensationeller technischer Fähigkeiten – uns Menschen sogar weit voraus. Das geht sogar so weit, dass menschliche Architekten mittlerweile so einiges von ihren tierischen Kollegen abgekupfert haben. So werden zum Beispiel gerade weltweit Hochhäuser mit vollautomatischen Energiesparklimaanlagen ausgerüstet – Klimaanlagen, bei deren Bau man sich nahezu vollständig an den äußerst effektiven Klimatürmen einer afrikanischen Termitenart orientiert hat.
„Wo ist ein Tier zu Ende?“, fragt der deutsche Verhaltensforscher Jürgen Tautz. Seine ganz eigene Antwort auf diese, auf den ersten Blick etwas kuriose Frage lautet: Ein Tier grenze sich eben nicht durch seine äußere Hülle von seiner Umwelt ab, sondern reiche durch „seine Aktionen und deren nachhaltige Ergebnisse“ weit über Haut, Gefieder oder Chitinpanzer hinaus. Dazu gehört sicherlich auch das Vermögen, ein wie auch immer geartetes Bauwerk zu schaffen. Diese Fähigkeit der tierischen Architekten bzw. Baumeister ist oft von überlebenswichtiger Bedeutung. Ob primitives Nest oder raffinierte Luxushöhle mit angeschlossenem unterirdischem Gangsystem – alle diese Behausungen schützen ihre Bewohner mehr oder weniger effektiv vor Fressfeinden, aber auch vor schädlichen Umwelteinflüssen wie klirrender Kälte oder brütender Hitze. Gleichzeitig sind sie aber auch ein geeigneter Ort, um den eigenen Nachwuchs auf die Welt zu bringen, aufzuziehen und wohlgeschützt auf den Ernst des Lebens vorzubereiten. Im täglichen Kampf um das Dasein kann es demnach durchaus die Baukunst sein, die darüber entscheidet, welche Art überlebt und welche nicht.