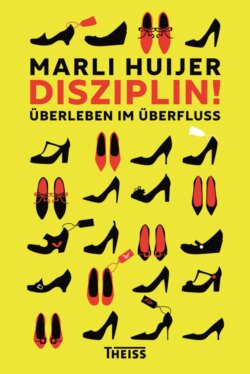Читать книгу Disziplin! - Marli Huijer - Страница 10
|23|1 Der spielende Mensch
ОглавлениеPhilosophen sehen die Entwicklung der Disziplin im Laufe der Zeit unterschiedlichen Tendenzen unterworfen. Die einen behaupten, dass sich die menschliche Kultur linear zum Besseren entwickle, andere sehen sie einem zyklischen Prozess unterworfen, während eine dritte Gruppe von Philosophen überzeugt ist, dass die Geschichte Brüche aufweist und aus einer Ansammlung von Fragmenten besteht, in der weder Zusammenhang noch Muster zu erkennen sind. Eine letzte Gruppe glaubt sogar, dass es mit unserer Geschichte ein böses Ende nehmen werde.
Die Philosophen der linearen Entwicklung glauben wahrzunehmen, dass die menschliche Gesellschaft immer kultivierter wird. Argumente finden sie zur Genüge in Norbert Elias’ (1897–1990) Über den Prozess der Zivilisation (1939), der beeindruckenden Studie über das menschliche Verhalten in der westlichen Gesellschaft.4 Der Soziologe zeigt auf, dass die Oberschicht in einem jahrhundertelangen Prozess stets verfeinerte Formen der Disziplin ausbildete, mit denen sie sich von der Unterschicht abhob. Angehörige der Unterschicht, die die soziale Leiter hinaufklettern wollten, imitierten das Verhalten der Oberschicht, wodurch die Gesamtgesellschaft mit der Zeit immer disziplinierter und kultivierter wurde.
Die Philosophen der zyklischen Wiederkehr sind der Ansicht, dass sich Zeiten mit viel Disziplin und Zeiten mit weniger Disziplin in der Gesellschaft abwechseln, denn in Notzeiten verhalten sich die Menschen gezwungenermaßen disziplinierter als in Zeiten, in denen für alle genug da ist. Nimmt der Wohlstand wieder zu, verringert sich die Disziplin und das Bedürfnis nach persönlicher Freiheit tritt in den Vordergrund. Wenn dann nach einer Weile die Folgen dieses |24|Disziplinmangels spürbar werden, werden die Zügel wieder straffer angezogen.
Die Philosophen der Brüche verweisen auf den radikalen Kulturwandel in den sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts. Die Denk- und Verhaltensweisen jener Jahre unterscheiden sich markant von denen der vorangehenden und der nachfolgenden Periode. Geschichte ist eine Folge von Momenten, und die sechziger Jahre stellen einen derartigen Moment dar.
Die Philosophen des Verfalls berufen sich auf Friedrich Nietzsche. Sie sind der Ansicht, dass der Untergang der Kultur Europas bevorstehe5 und dass der Kulturabbau der sechziger Jahre nur eine Etappe im großen unaufhaltsamen Abwärtsstrudel sei.
Was die Disziplin betrifft, so neige ich persönlich dazu, den Philosophen der zyklischen Wiederkehr zuzustimmen. In den sechziger Jahren, vielleicht aber auch schon in den Fünfzigern, setzten der Widerwille gegen die Disziplin und die sich etablierende Wohlstandsgesellschaft einen Prozess des Disziplinabbaus in Gang, dessen Auswirkungen bis heute spürbar sind. Doch in den neunziger Jahren wird plötzlich der Ruf nach Disziplin und Mäßigung laut, worauf viele Freiheiten der sechziger und siebziger Jahre rückgängig gemacht werden: Erziehungskonzepte, bei denen das Kind im Mittelpunkt steht, werden abgelöst von einer Erziehungsideologie, in der ausschließlich die Lehrkräfte und der Lehrstoff das Lernen bestimmen. Die antiautoritäre Erziehung, bei der Eltern und Kind als gleichberechtigt betrachtet werden, gehört der Vergangenheit an; populär sind jetzt Erziehungskurse, in denen Eltern lernen, ihren Kindern gegenüber strenger aufzutreten. Früheres antibürgerliches Verhalten wird heute ersetzt durch den Ruf nach mehr Manieren und aktiver Bürgerpflicht. Auch der einst lockere Umgang mit Alkohol, Sex und Drogen ist inzwischen unerwünscht und weicht einer unnachgiebigeren Haltung der Politik gegenüber Pornographie, Prostitution, Pädophilie, Frauenhandel, Alkohol-, Tabak- und Drogenkonsum.
|25|Trotzdem haben die Philosophen der linearen Entwicklung nicht unrecht – vor allem, wenn man mit Elias erkennt, dass es auf dem Wege der Zivilisation „die mannigfachsten Kreuz- und Querbewegungen“ gibt.6 Nur scheinbar leben die disziplinierten Zeiten der vorachtundsechziger Jahre wieder auf; in Wirklichkeit ist die jetzige Popularität der Disziplin eine Erneuerung: Die Disziplin kehrt in anderem Gewand, anderer Zeit, anderer Perspektive zurück. Zusammen mit den Philosophen der aufsteigenden Linie könnten wir diese Erneuerung als Fortschritt bezeichnen. Wir setzen die Disziplin wieder in ihr Recht, aber anders als früher.
Ob diese Restitution der Disziplin zu einem höheren Kulturniveau führt oder nicht, hängt davon ab, in welchem Verhältnis Freiheit und Disziplin zueinander stehen. Historisch betrachtet könnte man von einer dialektischen Bewegung sprechen, bei der die Disziplin (These) über die in Misskredit geratene Disziplin (Antithese) in Form einer höheren Disziplin zurückkehrt (Synthese).
Der erste Teil meines Buches behandelt die beiden Anfangsphasen dieser Entwicklung, die These und Antithese. Welche philosophischen Auffassungen führten dazu, dass der Disziplin eine Absage erteilt wurde und der Wunsch nach persönlicher Freiheit stetig wuchs? Wie sah die Freiheit des „spielenden Menschen“ aus? Warum suchte man diese Freiheit im Widerstand gegen die Disziplin?
Ich werde versuchen, den Kulturwandel der sechziger Jahre mithilfe von vier verschiedenen philosophischen Themen zu beschreiben. Ohne den Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben, soll dadurch ein Überblick über die Veränderungen geschaffen werden, die das Verhältnis zwischen Disziplin und Freiheit seit jener Zeit durchlaufen hat.