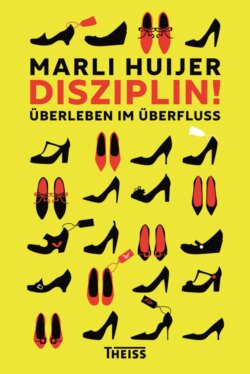Читать книгу Disziplin! - Marli Huijer - Страница 8
Vom Lernen bis zur Selbstkasteiung
ОглавлениеDass wir ohne Disziplin nicht überleben können und uns ständig gegenseitig disziplinieren müssen, bedeutet jedoch nicht, dass Disziplin immer angebracht ist. Wie sie zu beurteilen ist, hängt davon |16|ab, ob man weiß, was unter ihr zu verstehen ist, wie und wann man sie am besten einsetzt und woher sie eigentlich stammt.
Was also verstehen wir unter Disziplin? Der Begriff leitet sich vom lateinischen Wort discipulus, „Schüler“, ab. Damit verwandt ist der aus der Antike stammende lateinische Begriff disciplina, der „Erziehung“ bzw. „Zucht“ und seit dem 15. Jahrhundert auch „Wissenschaftszweig“ bedeutet. Wichtig für die Entlehnung ist der Begriff disciplina militaris als Bezeichnung für die militärische Zucht und die militärische Ausbildung.3 Das christliche Latein verballhornte das Wort zu disceplina, was mit „Züchtigung“ oder „Selbstkasteiung“ zu übersetzen ist.
Auch heute noch hat die Disziplin mehrere Bedeutungen. Zunächst umschreibt sie den Zustand des Discipel- oder Schüler-Seins und verweist damit auf die Erziehung, in welcher das Kind lernt zu lernen. Eine disziplinierende Erziehung soll Kindern beibringen, auf andere Rücksicht zu nehmen, antizipierend zu denken, spontane Eingebungen zugunsten von weitgesteckten Zielen zurückzustellen und Affekte und Triebe den geltenden gesellschaftlichen Normen gemäß zu kontrollieren. Doch was ein Kind oder ein Schüler zu lernen hat, bestimmen die Eltern, die Lehrer, das Lernumfeld und die Gesellschaft, in der das Kind aufwächst.
Zudem bezeichnet Disziplin auch das Mäßigungs- oder Selbstbeherrschungsvermögen. Es ist eine Form der Selbstformung. Objekte einer Selbstkontrolle können Triebe sein (Sexualtrieb, Esslust), Gefühle (mit dem Ziel der Gleichmut) oder die Zeit (Einteilung bzw. Ordnen der Zeit). Diese Art der Disziplin drückt sich in der Befähigung aus, Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden. Wer sich einer rigorosen Selbstdisziplin unterwirft, kann sich aber auch bestrafen wollen für das Böse, das angeblich in jedem Menschen haust. In Form der Selbstkasteiung kennen wir diese Form der Disziplin von den Mönchen des Mittelalters.
Drittens ist die Disziplin eng mit der Ordnung verbunden: zum Beispiel mit der Ordnung der Zeit, der Ordnung der Lehre |17|oder der Ordnung eines Klosterordens. Ordnung schafft zwischen Menschen oder Dingen ein hierarchisches Verhältnis und erfordert ein gehöriges Maß an Selbstbeschränkung, weil die sich aus Ordnung und Hierarchie ergebenden Vorschriften und Regeln ja befolgt werden müssen. Eine letzte Bedeutung der Disziplin ist die der normalisierenden Überwachung. Damit sind die zahlreichen Methoden gemeint, mit denen Institutionen wie Schule, Familie, Berufsleben, Medien, Polizei, Armee, Krankenhäuser und Gesundheitsbehörden das Verhalten von Gruppen und Individuen durch Kollektivnormen regulieren und organisieren. Diese Institutionen disziplinieren den Menschen durch systematisches Erfassen ihres Verhaltens (zum Beispiel durch Registrierung, Meldepflicht, Beurteilungs- oder Mitarbeitergespräch, Kameras im öffentlichen Raum und digitale Spurensuche). Durch diese Maßnahmen können die Menschen leicht klassifiziert und wenn nötig ihr Verhalten korrigiert werden. Die ersten beiden Arten der Disziplin („Lernen zu lernen“ und „Selbstformung“) beziehen sich auf das Individuum, es sind Formen der persönlichen Disziplin. Die letzten beiden Arten (die „Ordnung“ und die „Überwachung“) sind den Institutionen und der Gesellschaft als Ganzes eigen, deshalb werden sie als institutionelle Formen der Disziplin bezeichnet. Die persönlichen und die institutionellen Formen der Disziplin lassen sich nicht immer trennen. Das liegt daran, dass die institutionelle Disziplin vom Menschen oft internalisiert wird. Das heißt, sie wird zur „Selbstdisziplin“ und scheint dann eine Eigenschaft des Menschen selbst zu sein, obwohl sie in Wirklichkeit von außen auferlegt ist. Ein Kind, dem die Eltern beibringen, immer pünktlich zur verabredeten Zeit zu Hause zu sein, wird Pünktlichkeit später vermutlich zu seinen angeborenen Eigenschaften zählen. Ich werde diese Form der Disziplin von nun an internalisierte Disziplin nennen.
Bei allen drei Arten der Disziplin (der persönlichen, der institutionellen und der internalisierten) wird die Disziplin erworben. Die |18|Neigung zu diszipliniertem Verhalten ist zwar angeboren, die Disziplin selbst jedoch nicht. Als Mensch besitzen wir von Haus aus die Fähigkeit zu diszipliniertem Verhalten, aber dieses muss entwickelt und trainiert werden. Disziplin muss mühsam erlernt werden.
In der philosophischen Literatur finden sich zahlreiche Theorien und Ratschläge zur Erlangung von Disziplin. Bei Platon erfahren wir, dass die Disziplin unbedingt Teil der kindlichen Erziehung sein muss, während Aristoteles, Nietzsche und Sloterdijk der Ansicht sind, dass wir uns diese später noch mittels Übung aneignen können. Hans Achterhuis (* 1942) und Paul Verhaeghe (* 1955) behaupten, dass Wettbewerbsdenken und Geltungsdrang beim Menschen zu einer übermäßigen Form der Selbstdisziplin führen können. Also ist, um zu gewährleisten, dass der Wettbewerb fair ist, ein umfassendes Kontroll- und Disziplinierungssystem nötig. Einem konservativen Schriftsteller wie Dalrymple zufolge ist Disziplin nur durch Mäßigung zu erreichen. Foucault dagegen zeigt auf, dass Disziplin durch Überwachung zustande kommt. Latour ist überzeugt, dass man die Disziplin auf Maschinen übertragen muss, während Arendt und Elias behaupten, Disziplin entstehe erst innerhalb des menschlichen Beziehungsgeflechts.
In diesem Buch möchte ich mithilfe einer ganzen Palette philosophischer Perspektiven darlegen, was wir durch den Disziplinabbau in der Nachkriegszeit verloren haben. Warum kehrten sich die Menschen immer mehr von der Disziplin ab? Welche neuen Ideale sind dafür verantwortlich? Welche Auswirkungen hatte der Disziplinabbau auf unseren Umgang mit Geld, Essen, Liebe und Zeit? Und was bedeutet er für das zwischenmenschliche Verhältnis, insbesondere für das Verhältnis zwischen jenen Menschen, die zur Disziplin erzogen worden sind, und jenen, die es nicht sind? Und schließlich, welche Lösungen bietet die Philosophie für die Probleme, die sich aus dem Disziplinschwund ergeben?
Dieses Buch ist keine Anleitung für gute Sitten. Es soll auch kein |19|Aufruf zu Disziplin, Mäßigung, Selbstbeschränkung, Ordnung oder mehr Manieren sein. Ich werde weder eine utopische Gesellschaft skizzieren, in der sich jeder Bürger diszipliniert und artig verhält, noch eine allgemeine philosophische Theorie der Disziplin formulieren.
Mir geht es vor allem darum, ein für den heutigen Menschen geeignetes Verhältnis zwischen Freiheit und Disziplin zu definieren. Wie kann man in einer Gesellschaft mit einem solchen Überfluss an Mitteln und Möglichkeiten überleben oder besser gesagt frei leben? Wie viel Disziplin brauchen wir Bewohner des reichen Nordeuropa, das die Finanzkrise einigermaßen unbeschadet überstanden hat? Wie können wir die Disziplin erlangen, die wir für ein gutes bzw. wertvolles Leben benötigen?
Dabei werde ich folgendermaßen vorgehen: Im ersten Teil meines Buches mit dem Titel „Wider die Disziplin“ möchte ich zeigen, welche philosophischen Theorien dafür mitverantwortlich waren, dass die Disziplin in Misskredit geriet, basierend auf dem in den sechziger und siebziger Jahren aufkommenden Wunsch, sich von sämtlichen Repressionen zu befreien. Die Befreiung von Regeln und Gesetzen betraf zunächst die persönliche Ebene („Der spielende Mensch“), weitete sich dann auf den institutionellen Bereich aus („Angst vor der Disziplin“) und griff schließlich auf den verinnerlichten Bereich über („Disziplin als zweite Natur“).
Im zweiten Teil, überschrieben mit dem Wort „Disziplinlos“, möchte ich illustrieren, wie sich ein Leben ohne Disziplin gestaltet. Welche Auswirkungen hat ein Mangel an Disziplin angesichts des heutigen Übermaßes an materiellen Konsumartikeln („Überleben im materiellen Überfluss“), an Zeit („Überleben in einem Meer an Zeit“), zwischenmenschlichen Beziehungen („Liebe und Überfluss“) und Menschen („Eine Masse Menschen“)? Zuletzt stelle ich die Frage: Wie lässt sich eine Teilung der Gesellschaft in privilegierte, disziplinierte Menschen und in sozial schwache, disziplinlose Menschen |20|vermeiden („Eine gesellschaftliche Kluft – Selbstdisziplin, ja oder nein“)?
Im dritten Teil meines Buches, der mit „Reaktion“ überschrieben ist, lege ich dar, wie die Gesellschaft im Laufe der Zeit auf die sichtbaren Folgen eines disziplinlosen Lebens reagiert hat: Einerseits entstanden kapitalismuskritische Bewegungen („Die Schuld des Neoliberalismus“), andererseits ertönte immer lauter der Ruf nach Mäßigung („Die Befriedigend-Kultur“), außerdem regte sich verstärkt der Wunsch nach disziplinierter Selbstformung („Üben, üben und nochmals üben“).
Im vierten und letzten Teil meines Buches mit dem Titel „Neue Formen der Disziplin“ widme ich mich der Suche nach den modernen Varianten der traditionellen Formen von Disziplin: Kann man Disziplin an technische Artefakte wie Apps delegieren („Die Delegierung der Disziplin ans nichtmenschliche Netz“) oder auf andere Menschen übertragen („Die Delegierung der Disziplin ans menschliche Netz“)? Wie können wir nützliche und notwendige Grenzen ziehen, ohne unsere Freiheit zu sehr einschränken zu müssen? Außerdem möchte ich aufzeigen, wo man Disziplin walten lassen kann und wo man sich vor ihr in Acht nehmen soll. Am Schluss möchte ich dann noch einige Ratschläge geben, wie man in unserer Überflussgesellschaft ein gutes Leben führen kann, wie die Politik die Kluft zwischen den Menschen mit und den Menschen ohne Disziplin überbrücken könnte und wie wir die Disziplin delegieren können, ohne Gefahr zu laufen, gegen unseren Willen und ohne unser Wissen diszipliniert zu werden.