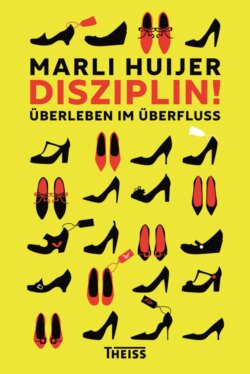Читать книгу Disziplin! - Marli Huijer - Страница 11
|26|Persönliche Freiheit
ОглавлениеDie ersten Schritte Richtung Disziplinabbau entsprangen dem Wunsch nach mehr persönlicher Freiheit. Man wollte sich der strengen Disziplin der Nachkriegszeit entledigen, die nicht nur in den Niederlanden Ausdruck einer kleinbürgerlichen Moral war. Diese Moral bestand aus dem Ideal der harten Arbeit, der Sparsamkeit, des sittsamen Verhaltens und der Autoritätsgläubigkeit. Eine Wochenarbeitszeit von 48 Stunden und eine Woche Jahresurlaub hielt man für normal, sogar bei den Gewerkschaften. Sitte und Moral waren in den fünfziger Jahren so streng, dass die Zahl der Ehescheidungen stark zurückging und auch die Zahl der außerehelichen Geburten niedriger war denn je; Geschlechtsverkehr vor der Ehe war für fast alle Frauen tabu.7 Dieses Verdienst hatten sich die Kirchen, der Gewerkschaftsbund und die Politik der damaligen Zeit zuzuschreiben, die der moralischen Verluderung während und nach der Besatzungszeit Herr zu werden versuchten, indem sie wieder an die strenge Vorkriegsmoral anknüpften.8
Doch bereits Ende der fünfziger Jahre geriet diese calvinistische Moral erneut unter Druck. In den Niederlanden beispielsweise wankte das politische, partikularistische System der „Verzuiling“ (Versäulung), das die Gesellschaft in eine katholische, protestantische und sozialistische Säule einteilte.9 Doch nicht nur hier entstand der Wunsch nach freieren, individualistischeren Lebensstilen.
Historiker sehen die Gründe für den gesellschaftlichen Wandel der sechziger Jahre im zunehmenden Wohlstand, im nicht mehr ganz so kalten Kalten Krieg und in der Erfindung der Pille. Vor allem die jungen Leute wollten die alten repressiven, hierarchischen Verhältnisse aufbrechen, Autoritäten waren in ihren Augen nur noch lächerlich:10 der patriarchische Vater, der strenge Lehrer, der moralisierende Pastor, der Arzt in seinem weißen Kittel, der Richter in seiner Robe, die allgegenwärtige Polizei und die sich wie kleine Kaiser gerierenden Politiker.11 Fast ganz Holland spottete mit, die |27|Bereitschaft zu Protest und Veränderung war nirgendwo höher als hier.12 Schluss sollte endlich sein mit der Unterdrückung der persönlichen Freiheit und mit der Repression. Die neuen Verhältnisse sollten Männern, Frauen und Kindern gleichermaßen eine freie Entfaltung ermöglichen.
Selbstbestimmung war eines der großen Ziele. Der Wunsch danach entsprang teilweise einer allgemeinen rebellischen Haltung, teilweise aber auch einer ideologischen Überzeugung. Der Existentialismus von Sartre, de Beauvoirs und Camus hatte die Intellektuellen ganz Europas darüber aufgeklärt, dass nicht Gott, die Natur oder die Umstände für unser Handeln verantwortlich sind, sondern ausschließlich wir selbst. Freiheit, so behauptet Sartre in seinem Hauptwerk L’être et le néant (1943; deutsch: Das Sein und das Nichts, 1952), ist die „erste Bedingung des Handelns“.13 Er war überzeugt, dass der Mensch zur Freiheit verurteilt sei, der er nie entgehen kann. Wer der Verführung erliegt, sich hinter Gott, der allgemeinen Norm oder dem gesunden Menschenverstand zu verstecken, belügt nicht nur sich, sondern auch die anderen. Menschen sind und bleiben stets für ihr Handeln verantwortlich, sie entscheiden selbst, welche Position sie als Individuum in der Welt einnehmen wollen.
In den protestantischen Kreisen der Niederlande führte das existentialistische Ideal der Selbstbestimmung zu einem christlichen Individualismus, bei dem die persönliche Gewissensfreiheit der Selbstentfaltung untergeordnet wurde, und zwar nicht nur auf das Jenseits bezogen, sondern auch auf das Hier und Jetzt.14 Der gläubige Mensch gehorchte nicht mehr einfach blind der Kirche, sondern wollte sich vor Gott auch selbst rechtfertigen können. Ganz neu war dieser christliche Individualismus übrigens nicht. Von Anfang an berief sich der niederländische Protestantismus auf die persönliche Gewissensfreiheit. Bereits bei Luther war der Mensch Gott ausgeliefert,15 und die Calvinisten hielten das Handeln aus Überzeugung seit Jahrhunderten für eine überaus ehrenvolle Tätigkeit.16
|28|Die Selbstbestimmung war ein großes Thema der zweiten Welle der Frauenbewegung in den sechziger und siebziger Jahren. Einige Jahre zuvor war Simone de Beauvoirs (1908–1986) zweibändiges Werk Le deuxième sexe (1949) erschienen, das bereits 1951 in deutscher Übersetzung, aber erst 1965 und 1968 in niederländischer Übersetzung erschien.17 Das andere Geschlecht machte vielen Frauen ihre unterdrückte Stellung erstmals bewusst. De Beauvoir forderte die Gleichberechtigung der Frau und deren Recht auf eine persönliche Freiheit. Dies sollte durch die Unabhängigkeit in sozialer, ökonomischer und sexueller Hinsicht erreicht werden. Während Kate Millett (* 1934) in de Beauvoir eine Vorläuferin sah und Alice Schwarzer (* 1942) sogar mit ihr befreundet war, machte es sich Joke Kool-Smit (1933–1981) unter Einfluss von de Beauvoirs Werk zur Aufgabe, die niederländischen Frauen aufzurütteln. In ihren Augen verfolgte der Feminismus drei Ziele: Die Frau soll ein freier Mensch werden, sie soll ihr Potential nutzen dürfen und ist als vollwertiges Mitglied der Gesellschaft zu betrachten.18 Der Hinweis auf das Potential zeigt, dass es um mehr ging als nur um das Wahlrecht für Frauen, es ging um die weibliche und nicht mehr nur um die männliche „Selbstverwirklichung“.
Doch worin bestand das Potential oder das „Selbst“, das verwirklicht werden sollte? In den sechziger Jahren suchte man die Antwort auf diese Frage vor allem im Menschen selbst. Selbstverwirklichung war so etwas wie Treue gegenüber dem tiefsten und wahrhaftigsten inneren Kern. Auf diesen richtete sich der Blick; man hoffte, dort das wahre Ich zu finden.
Der kanadische Philosoph Charles Taylor (* 1931) äußert in Das Unbehagen an der Moderne die Vermutung, dass sich der in den sechziger Jahren aufkommende Wunsch nach Selbstverwirklichung vom Ideal der Authentizität ableitet, das heißt vom Glauben an Ursprünglichkeit, Eigenart, Echtheit und Originalität. Aus der Überzeugung heraus, dass jeder Mensch etwas Eigenes besitzt, was ihn von den anderen unterscheidet, ergibt sich die Verpflichtung, eine |29|Verbindung mit seiner eigenen inneren Natur aufzunehmen. Taylor schreibt:
Wenn ich mir nicht treu bleibe, verfehle ich den Sinn meines Lebens; mir entgeht, was das Menschsein für mich bedeutet. Sich selbst treu zu sein heißt nichts anderes als: der eigenen Originalität treu sein, und diese ist etwas, was nur ich selbst artikulieren und ausfindig machen kann. Indem ich sie artikuliere, definiere ich mich zugleich selbst. Damit verwirkliche ich eine Möglichkeit, die ganz eigentlich mir selbst gehört. Dies ist die Auffassung im Hintergrund des modernen Authentizitätsideals und der Ziele ‚Selbsterfüllung‘ oder ‚Selbstverwirklichung‘, in deren Sinne das Ideal normalerweise formuliert wird.19
Je weiter die sechziger Jahre voranschritten, desto intensiver wurde die Suche nach dem Selbst. Die bisherigen Denkwege, die sich lediglich auf die Außenwelt gerichtet hatten, eigneten sich nicht länger für dieses Ziel. Östliche Philosophien und bewusstseinserweiternde Mittel dagegen ebneten den Weg zum ursprünglichen, authentischen Ich. Der niederländische Philosoph Jan Bor (* 1946) machte sich als junger Mann ebenfalls auf die Suche nach seinem verborgenen Selbst und entdeckte das „Licht“, das aus dem Osten kam:
Die Frage „wer bin ich“ beschäftigte mich mehr oder weniger ständig. Anfangs in Form einer vagen Ahnung jener Dimension, die sich hinter den wahrgenommenen Objekten und unserem Denken über diese verbarg, so etwas wie ein Reich der Stille. Danach aber mehr in Form einer inneren Tiefe, die sich öffnete hinter dem, was wir gemeinhin unser Ich nennen.20
Nachdem Bor Drg drsya viveka des indischen Philosophen und Heiligen Shankara gelesen hatte, kam er zur Einsicht, dass er sein inneres Selbst niemals mithilfe des Denkens würde finden können, sondern nur dadurch, dass er sich vom Denken befreite. Die Methode, |30|um dieses Ziel zu erreichen, fand er in der Meditation – einer Technik, die sehr viel Disziplin erfordert. Weil er die innere Weisheit finden wollte, reiste Bor wie viele seiner Zeitgenossen nach Osten. Sein Ziel war Japan, andere brachen auf nach Indien, Afghanistan oder Tibet.
Hier muss betont werden, dass der Wunsch nach Selbstverwirklichung in den sechziger Jahren nichts mit Egoismus, Narzissmus und Hedonismus zu tun hatte. Im Gegenteil: Damals war man felsenfest davon überzeugt, dass der Mensch im Kern gut sei.