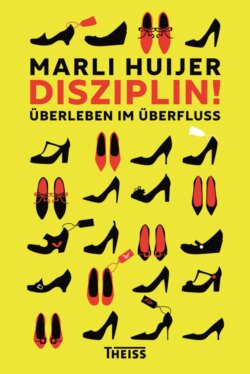Читать книгу Disziplin! - Marli Huijer - Страница 7
|9|Einleitung
ОглавлениеWas kann der Mensch sich Schöneres vorstellen als Freiheit im Überfluss? Nichts, so scheint es auf den ersten Blick. Doch trotz eines Überangebots an Nahrung, Konsumartikeln und Wahlmöglichkeiten verkümmern viele von uns. Wir überhäufen uns mit Dingen, hasten von Ort zu Ort und können kaum noch etwas richtig genießen. Letzteres aber erfordert Disziplin – und ausgerechnet vor dieser fürchten wir uns.
Warum jagt uns die Disziplin solche Angst ein? Ist es gerechtfertigt, dass sie uns größere Schwierigkeiten bereitet als die Freiheit?
Disziplin besitzt zahlreiche Vorteile. Sie verwandelt einen ungeordneten Soldatenhaufen in eine schlagkräftige Armee, einen ungestümen Welpen in einen gehorsamen Hund und ein schüchternes Mädchen in eine selbstbewusste Ballerina. Außerdem ist sie äußerst nutzvoll für den Schriftsteller, sorgt sie doch dafür, dass er still am Schreibtisch sitzen bleibt und seine Arbeit macht. Disziplin bedeutet auch Selbstbeherrschung und verhindert, dass wir losbrüllen, sobald wir uns über etwas ärgern, oder zuschlagen, wenn uns etwas stört. Selbstdisziplin ist nicht nur für den anderen angenehm, sondern auch für uns selbst: Wer gleich losbrüllt und draufhaut, macht sich nicht gerade beliebt. Dank der Disziplin können wir etwas aufschieben oder gar ganz unterlassen und müssen nicht bei jeder Regung eines Bedürfnisses sofort um uns schlagen, küssen oder konsumieren. So gesehen besitzt die Disziplin nur Vorteile.
Doch sie hat auch Schattenseiten. Man denke nur an die Disziplin von Fräulein Knüppelkuh in Roald Dahls Matilda, mit der die Schuldirektorin die Kinder terrorisiert. Der kleinen Matilda, deren Freiheit, Intelligenz und Liebe bedroht sind, gelingt es mit magischen Tricks, Fräulein Knüppelkuh zu verjagen. Das Mädchen genießt unsere ganze Sympathie, wodurch Roald Dahl uns sagen will, dass Disziplin mehr Nach- als Vorteile besitzt: Also weg damit!1
|10|Die Schattenseiten der Disziplin offenbarten sich vor allem bei den deutschen Soldaten des Zweiten Weltkriegs. Als man nach Kriegsende erkannte, dass deren kritikloses Ausführen von Befehlen für den Tod von Millionen Menschen verantwortlich war, begegnete man dieser Art von Dressur mit steigendem Misstrauen. Offenbar konnte die Disziplin Menschen in Maschinen verwandeln, in Automaten, die jedem Befehl gehorchten, und sei er noch so grausam. Solch vorbehaltlose Disziplin nennt man Kadavergehorsam. Er war lange Zeit ein wichtiger Bestandteil der Erziehung der Deutschen. Harry Mulisch behauptet in seiner Reportage über den Eichmann-Prozess De zaak 40/61 (1962; deutsch: Strafsache 40/61, 1963), dass den Niederländern der Kadavergehorsam unbekannt sei, ja, dass Niederländer wie ich überhaupt nicht gerne gehorchen2.
Nach dem Krieg wuchs die Abneigung gegen die Disziplin stetig. Philosophisch unterbaut wurde diese Abneigung unter anderem mit Michel Foucaults Surveiller et punir (1975; deutsch: Überwachen und Strafen, 1976), worin der französische Philosoph aufzeigt, wie unerwartet subtil die Disziplin zu Werke schreitet.
Bis in die siebziger Jahre des letzten Jahrhunderts hinein war Disziplin gleichbedeutend mit Unterdrückung und hierarchischen Machtverhältnissen. In diesen zwang ein Machthaber (König, Kapitalist, Kirchenvater, Lehrer, Vater) Untergebenen mit keiner oder wenig Macht (Untertanen, Arbeiter, Gläubige, Schüler, Frauen und Kinder) Gesetze und Gebote gewaltsam auf. Diesem Bild einer negativen, repressiven Macht stellt Foucault das Bild einer positiven, produktiven Macht gegenüber, die sich aus einer Vielzahl unsichtbarer, unaufhörlich auf uns einwirkender Kräfte zusammensetzt.
Foucaults positive Macht diszipliniert die Menschen nicht durch Bestrafung, sondern durch Korrektur. Sie kann weder in einer singulären Autorität – zum Beispiel einem Fürsten oder Vater – noch in einer autoritären Institution wie Kirche oder Staat personalisiert werden, sondern wirkt mit unzähligen disziplinierenden Kräften auf uns ein und ergreift sogar von unserem Inneren Besitz. Doch |11|nicht erst Regime wie das Dritte Reich schufen den Maschinenmenschen. Bereits seit dem Ende des 18. Jahrhunderts zielen Disziplinarinstitutionen wie Schulen, Kasernen, Gefängnisse, Fabriken und Krankenhäuser darauf ab, die Bewohner Europas in gehorsame Maschinen zu verwandeln. Unsichtbare Kräfte disziplinieren uns unbemerkt zu gehorsamen Bürgern. Eine Existenz außerhalb der Macht ist unmöglich, aus dem einfachen Grund, weil es keine Außerhalb-der-Macht-Existenz gibt. Schlimmer noch, wir selber sind ein Rädchen im Getriebe disziplinierender Kräfte.
Die Erkenntnis, dass die allgegenwärtige Disziplin den Menschen gefügig machen und ihn der Freiheit, selbst zu denken und zu handeln, berauben soll, führte in den sechziger und siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts dazu, dass man sich der Disziplin so oft wie möglich zu entziehen versuchte. Traditionen, Sitten und Gebräuche, hierarchische Systeme und Institutionen der Disziplinarmacht wurden auf den Prüfstand gestellt und danach entweder ganz abgeschafft oder wenigstens einer radikalen Veränderung unterzogen. In Bereichen wie Schulwesen, Armee, Arbeit, Familie, Gesundheitssystem und Sexualität fand ein umfassender Prozess des Disziplinabbaus statt. Es galt, verdeckte Formen der Disziplinierung offenzulegen und dann unschädlich zu machen. Keine Pflicht oder Dressur sollte die freie Entfaltung des Individuums behindern, „Befreiung“ wurde zum Schlüsselwort.
Doch nicht nur die Angst vor dem Maschinenmenschen führte zur Diskreditierung der Disziplin, auch der wachsende Wohlstand trug dazu bei. Dass in Not- und Mangelzeiten Disziplin nötig war, bezweifelte niemand, doch in den friedlichen Zeiten des Überflusses hielt man sie für fehl am Platz. Weil alles im Überangebot vorhanden war, wurde der Drang zur Freiheit größer, und zwar zur Freiheit, das Gute und Angenehme uneingeschränkt genießen zu können. Selbstbeherrschung und Triebunterdrückung waren überflüssig, wenn jeder genug hatte und es so aussah, als ob sich dies in absehbarer Zeit auch nicht ändern würde.
|12|Doch inzwischen hat sich die Stimmung gewandelt. Der Ruf nach mehr Disziplin wird laut, und das Thema taucht immer häufiger in den Medien auf: Man solle sich, so heißt es nun, in Selbstbeherrschung üben, solle sich ein langfristiges Ziel stecken, das Leben neu ordnen, endlich begreifen, dass man ohne Disziplin nicht studieren könne, akzeptieren, dass wahre Liebe Disziplin erfordere, sich dazu entschließen, den Smartphone-Gebrauch zu reduzieren und den Kindern wieder Manieren beizubringen. Außerdem solle der Staat den Bürger wieder mehr in die Pflicht nehmen. Der Mensch von heute habe sich ja angeblich kaum noch unter Kontrolle und sei oft unverschämt und aggressiv; den Schülern und Studenten mangele es an Disziplin, ihre Leistungen seien oft schwach und zu viele brechen die Ausbildung sogar ganz ab; Väter und Mütter lehren ihren Kindern keine Disziplin mehr und die Kinder hätten keinen „Respekt“ vor Eltern und Lehrern. Die Eltern selbst, so heißt es, verlieren zu schnell ihre Selbstbeherrschung, wovon Schieds- und Linienrichter beim Kinderfußball ein Lied singen können. Der Staat müsse, so wird verlangt, strenger gegen Bürger vorgehen, die verbal oder physisch Sozialarbeiter, Lehrer oder Polizeibeamte angreifen, außerdem müsse er angesichts der steigenden Zahl übergewichtiger Menschen öffentlich zu mehr Disziplin aufrufen – und dabei das Komasaufen in einem Aufwasch gleich mit erledigen.
Mit solchen Äußerungen scheint der Prozess des Disziplinschwunds, der in den Nachkriegsjahren eingesetzt und in den sechziger Jahren zur Hinterfragung aller Formen von Disziplin, Macht und Autorität geführt hat, an sein Ende gelangt zu sein. Wir müssen feststellen, dass das Leben in einer Überflussgesellschaft ohne Disziplin nicht besonders angenehm ist. Das Individuum muss ohne Unterstützung von außen in sämtlichen Lebensbereichen fortwährend Entscheidungen treffen – in der Beziehung, im Job, im Studium, in finanziellen Angelegenheiten, beim Konsum und in allen Lebensmittel- und Genussfragen – und droht an diesem Zuviel |13|zu scheitern. Das Leben im Überfluss erweist sich heutzutage als eine ebenso große Herausforderung wie das Leben in Armut.
Kritik an der modernen Gesellschaft kommt jedoch überraschenderweise nicht nur aus der traditionellen und konservativen Ecke. Selbst linke Denker sind davon überzeugt, dass es schlimm stehe um die Disziplin. Der einst mit großer Begeisterung vorangetriebene Prozess des Disziplinabbaus ist unter dem Deckmantel der persönlichen Freiheit inzwischen zur skrupellosen Wahrung von Eigeninteressen verkommen. Eine Folge des Disziplinschwunds in Zeiten des wachsenden Wohlstands ist der in fast allen Bereichen der Gesellschaft zu beobachtende Egoismus.
Für die Konservativen sind solche Auswüchse der zunehmenden Disziplinlosigkeit zwar ein Grund zur Verärgerung, aber keine Überraschung: Ihrer Meinung nach haben uns das die sechziger Jahre eingebrockt. Deren Ideale von persönlicher und sexueller Freiheit oder antiautoritärer Erziehung riefen in den Menschen ein schamloses und unbeherrschtes Verhalten hervor, welches Bildung und Kultur zuvor, wenn auch nur dünn, überdeckt hätten.
Die Linken schieben den schwarzen Peter dem Neoliberalismus und unkontrollierten Kapitalismus der freien Marktwirtschaft zu: Seit den achtziger Jahren wurden die Bewohner der westlichen Länder auf jede erdenkliche Art und Weise dazu angehalten, stets ihr Eigeninteresse zu vertreten, möglichst viel zu konsumieren und in jeder Hinsicht mit ihren Mitmenschen in Konkurrenz zu treten.
Beide politischen Lager sind sich jedoch in einem einig: Es muss sich etwas ändern. Die Konservativen wollen sich von den Idealen der Sechziger befreien, die Linken von den Auswüchsen des Neoliberalismus. Beide Lager teilen die Überzeugung, dass wir unsere Einstellung zur Disziplin grundlegend überdenken müssen.
Während ich an diesem Buch schrieb, fragte ich mich, ob ich mich einem der beiden Lager zuschlagen könne und wenn ja welchem. Soll man die Disziplin ehren oder fürchten? Ich habe die Disziplin oft als nützlich erfahren, doch gelegentlich ist sie mir mächtig |14|im Wege. Eine gesunde Portion Disziplin sorgt dafür, dass ich mich rechtzeitig an meinen Schreibtisch setze und auch rechtzeitig wieder aufstehe, doch dieselbe Disziplin lässt mich rigoros werden, wodurch ich länger arbeite, als gut für mich ist, so dass ich mich dann über mich oder andere ärgere.
Mir ist klar, dass meine Disziplin von vielen verschiedenen Faktoren abhängig ist. Es gibt Zeiten, da bin ich vollkommen undiszipliniert und mir gelingt so gut wie nichts, und manchmal geht alles wie von selbst. Auch frage ich mich, woher die Disziplin eigentlich kommt. Oberflächlich betrachtet, scheint sie aus dem Inneren des Menschen zu stammen, Teil des menschlichen Charakters zu sein. Dann aber müsste man immer gleich diszipliniert sein, was aber nicht stimmt. Ohne ein Gegenüber, das ein bestimmtes Verhalten erwartet, kann es um die Disziplin rasch geschehen sein. Hätte ich keinen Chef, Verleger, Kollegen oder Freund, der mir Vorhaltungen macht, wenn ich meine Termine und Verabredungen nicht einhalte, säße ich vermutlich nur noch zu Hause und hinge meinen Gedanken nach.
Was nicht automatisch bedeutet, dass alle Disziplin uns von außen aufgezwungen wird. Treffen zwei Parteien eine Vereinbarung, dann setzen sie sich auf freiwilliger Basis gegenseitig Grenzen. Würde nur eine Partei disziplinierende Maßnahmen gegen die andere ergreifen, würde diese aufbegehren. Aus diesem Grund erregen zum Beispiel Kampagnen gegen Übergewicht stets Widerstand. Übergewichtige Personen haben meist wenig Lust, sich der Disziplin von Ernährungsberatern zu unterwerfen. Das ist logisch. Wem „gutes Leben“ gleichbedeutend ist mit ungehindertem Schlemmen, der hat mit Disziplin nicht viel am Hut. Disziplin und Genießen sind nur für den zur Deckung zu bringen, für den „gutes Leben“ identisch ist mit Schlank- und Gesundsein.
Dieses Beispiel zeigt, dass es sich bei der Disziplin nicht unbedingt um eine Lebenshaltung oder eine Charaktereigenschaft handelt, sondern vielmehr um ein Mittel, mit dem man seine Lebensideale |15|verwirklichen kann. Womit allerdings die Gefahr nicht gebannt ist, dass Disziplin den Menschen in gehorsame Maschinen verwandeln kann. Nach wie vor setzen Armeen und andere Machtinstitutionen Disziplin ein, um eine große Menschengruppe bestimmte Handlungen ausführen zu lassen. Disziplin ist also ein zweischneidiges Schwert, man kann mit ihr Lebensziele verwirklichen, aber auch Menschen instrumentalisieren.
Diese Ambivalenz der Disziplin nahm ich zum Anlass, mir die Frage zu stellen, wie sich Disziplin und Freiheit zueinander verhalten. Wann wirkt sich Disziplin negativ auf die Freiheit aus und wann positiv? Gibt es Formen der Disziplin, die deren Vorteile hervortreten lassen und deren Risiken verringern? Mich interessierte dabei vor allem, wie Freiheit und Disziplin sich gegenseitig positiv beeinflussen können, ob man neue Formen der Disziplin entwickeln kann und inwiefern wir die für die Bewältigung des Alltags notwendige Disziplin teilweise auf Maschinen oder Mitmenschen übertragen können.
Je weiter mein Buch gedieh, desto weniger war ich davon überzeugt, dass wir ganz ohne Disziplin durchs Leben kommen können. Menschen disziplinieren sich bei jedem zwischenmenschlichen Kontakt gegenseitig, und zwar oft zu beiderseitigem Vorteil: Man stellt sich auf den jeweils anderen ein und trifft Vereinbarungen, an die sich beide Seiten zu halten versuchen. Je abhängiger die eine Partei von der anderen ist, desto eher ist sie bereit, die vereinbarten Einschränkungen durch die andere Seite zu akzeptieren.