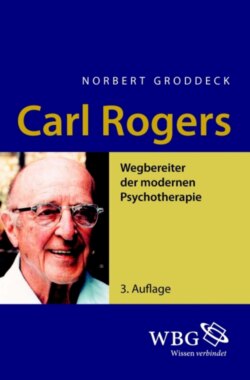Читать книгу Carl Rogers - Norbert Groddeck - Страница 10
Die Familie Walter und Julia Rogers
ОглавлениеCarl Ransom Rogers wurde am 8. Januar 1902 als viertes von sechs Kindern in Oak Park, Illinois, einem noblen Vorort von Chicago, geboren. Oak Park hatte um die Jahrhundertwende ungefähr 10 000 Einwohner. Hier wohnten viele wohlhabende Familien, die nach dem verheerenden Feuer, das Chicago 1871 heimgesucht hatte, in die Vorstadt übergesiedelt waren. Ernest Hemingway, der etwa zur selben Zeit wie Carl Rogers dort aufwuchs, beschrieb die Vorstadt als einen Ort von „weiten Park- und Rasenanlagen und engem Geist“.
In Oak Park gab es, wie sicherlich auch im restlichen Teil der christlichen Welt Amerikas, verschiedene religiöse Gemeinschaften, Freikirchen und Sekten, die untereinander rivalisierten. Jede versuchte, von oben auf die anderen herabzuschauen und diese mit religiösem Eifer in einer christlichen Lebensführung zu übertreffen. Die Rogers waren Mitglieder in einer freien protestantischen Gemeinde (Congregational Church)3 , die, wie viele dieser Gemeinden, keine zentrale und übergeordnete Aufsichtsorganisation (im Sinne einer Amtskirche) duldete. Die Lebensführung der Familie wurde durch eine strenge Variante des calvinistischen Glaubens bestimmt, den die Siedler in der Pionierzeit nach Amerika gebracht hatten. Insbesondere Mutter Julia sorgte wesentlich dafür, dass diese christlichen Standards in der Familie hochgehalten wurden.
Vater Walter Alexander hatte an der Universität von Wisconsin ein Ingenieurstudium abgeschlossen und war, als Carl zur Welt kam, bereits ein erfolgreicher Geschäftsmann im Bereich des Straßen- und Brückenbaus. Er konnte der Familie ein wohlhabendes Zuhause einrichten. Ohnehin waren die Rogers trotz oder in gewissem Sinne auch gerade wegen ihres Glaubens dem technologischen Fortschritt der modernen Zeit gegenüber durchaus aufgeschlossen. Auch Mutter Julia besaß eine höhere Schulbildung und hatte ebenfalls zwei Jahre die Universität besucht.
Ellen Key hatte zu dieser Zeit in Europa gerade das „Jahrhundert des Kindes“ ausgerufen. Auch in Nordamerika waren in allen Bereichen Auswirkungen einer Lebensreformbewegung zu spüren, die sich kritisch gegen die sozialen Folgen der Industrialisierung und der allgemeinen „Entwurzelung“ der Menschen richtete. Ein „Ast“ dieser Bewegung war die „progressive education“. Sie hatte im Amerika des frühen 20. Jahrhunderts viele Anhänger gerade in der gut ausgebildeten bürgerlichen Mittelschicht, die sich zunehmend Gedanken über die gesellschaftlichen Verhältnisse und über die richtige Erziehung ihrer Kinder machten.
Unter engagierten Pädagogen und pädagogisch engagierten Eltern vollzog sich im Erziehungsdenken eine „kopernikanische Wende“, wie Herman Nohl dies genannt hatte. Das Verhältnis von Eltern und Kindern, wie auch das von Lehrern und den ihnen anvertrauten Schülern, sollte umgekehrt werden. Die Erwachsenen sollten für die Kinder da sein, deren Entwicklung und Anlagen fördern und nicht umgekehrt von den Kindern fordern, dass sie sich in die Anschauungen und Auffassungen der Erwachsenen einzufügen haben. Die kind-zentrierte Pädagogik kritisierte, dass die traditionelle Erziehung in der zurückliegenden Zeit die unendlichen kreativen Potentiale, die Kinder immer wieder neu mit zur Welt bringen, sträflich missachtet und in blinden Anpassungs- und Dressurprozessen in den Institutionen der Gesellschaft erstickt habe. Die lebensfremde und obrigkeitsstaatliche Buch- und Paukschule war für sie eine solche Institution.
Kinder sollten nach der modernen Pädagogik ohne Angst, frei und selbstbestimmt in einer „guten“ und pädagogisch wohl geordneten Umwelt aufwachsen. Am besten in freier Natur, abgeschieden von den Versuchungen und Verlockungen des modernen Großstadtlebens, sollten sie in einer klug geregelten „pädagogischen Provinz“ leben und aufwachsen, ganz so wie es Rousseau schon vor der Französischen Revolution für seine Romanfigur „Emile“ gefordert hatte. Auf ihrem Lehrplan sollte zur Vorbereitung auf das Leben nicht mehr totes Schulbuchwissen stehen, sondern die Kinder sollten an den wirklichen Herausforderungen des „natürlichen“ und sozialen Lebens lernen und in der Bewährung an wirklichen Aufgaben und Herausforderungen die Kräfte sammeln, aus denen sie dann ihre eigenen Persönlichkeiten entwickeln konnten.
Das beginnende Jahrhundert des Kindes hatte vielversprechend angefangen: Sigmund Freud hatte als Mediziner mit seiner Psychoanalyse die Öffentlichkeit mit einer neuen Auffassung vom Menschen überrascht. Dieser sei primär ein triebbestimmtes Wesen und von Erlebnissen und Ereignissen seiner frühen Kindheit viel stärker bestimmt, als ihm bewusst sei. Seine Auffassung von der überragenden Kraft der Libido und dem Einfluss sexueller Impulse auch auf das Leben des Kindes hatte Freud bereits 1905 in seinen drei Abhandlungen zur Sexualtheorie veröffentlicht und in der Anwendung dieser Konzepte 1909 eine erste Kindertherapie durchgeführt. Er konnte den fünfjährigen kleinen Hans, in Zusammenarbeit mit dessen Vater als Co-Therapeut, unter Zuhilfenahme seiner sexualtheoretischen Konzepte von einer Pferdephobie befreien.
Maria Montessori hatte im Januar 1907 ihr erstes Kinderhaus in Rom eröffnet, nachdem es ihr zuvor schon mit ihrer Methode gelungen war, geistesschwache, so genannte „Idioten“-Kinder zum Lesen und Schreiben zu führen, und diese in vergleichenden Prüfungen nicht schlechter abgeschnitten hatten als „normale“ Kinder. Kurzum: Die Vertreter einer neuen Medizin, einer modernen Pädagogik und der jungen Psychologie machten sich daran, die konkreten Entwicklungsbedingungen des Menschen zu erforschen und Lebens- und Erziehungskonzepte zu entwickeln, die sich zu den traditionellen und vorwiegend religiös geprägten Lebens- und Erziehungsvorstellungen der Jahrhunderte zuvor in eine deutliche Opposition brachten. So begann das „Jahrhundert des Kindes“ in religiöser, pädagogischer und psychologischer Hinsicht mit Kämpfen und polarisierenden Geburtswehen zwischen Traditionalisten und Erneuerern. Der allgemeine technologische Fortschritt und in dessen Gefolge der soziale Wandel rissen eine tiefe Kluft in das Alltagsleben vieler Menschen.
Die Familie Walter und Julia Rogers lebte als relativ wohlhabende und gut gebildete Mittelschichtfamilie genau in diesem Spannungsfeld von technologisch-wissenschaftlicher Erneuerung und wirtschaftlichem Gewinnstreben einerseits und dogmatischem Festhalten an überkommenen religiösen Prinzipien der Lebensführung und Erziehung andererseits. Sie lebte vom Fortschritt der Zeit und war doch in den traditionellen Wertvorstellungen eines konservativen Protestantismus aus der frühen Zeit der amerikanischen Siedlerbewegung zu Hause. Die Wurzeln der Familie Rogers ließen sich bis weit in das 17. Jahrhundert zurückverfolgen, als europäische Auswanderer den Atlantik überquerten, um in Amerika eine neue Heimat zu finden.
In amerikanischen Schriften über Rogers wird sehr gerne mit nationalem Stolz betont, dass es Carl Rogers als einem „echten Amerikaner aus dem mittleren Westen der USA“ gelungen sei, das Bild der noch jungen Wissenschaft der Psychologie und Psychotherapie nachhaltig mitzugestalten, das bis dahin doch weitgehend in Europa und von europäischen Einwanderern geprägt wurde. Der Abenteurer- und Pioniergeist der Siedler, die sich in der „Wildnis“ behaupten lernten, und der strenge und missionarische Protestantismus, gepaart mit einem vom Überlebenskampf geprägten Pragmatismus, waren gewiss ein wichtiger Teil seines Familienerbes.
Mutter Julia Rogers und Vater Walter Rogers (aus: Familienchronik der Familie Rogers. Fotos mit freundlicher Genehmigung der Library of Congress, Washington D.C.).
Viele der Pioniere hatten als Protestanten Europa aus Glaubensgründen verlassen müssen und waren als Siedler und Eroberer auf ihrem Weg westwärts in die „Neue Welt“ Amerikas gekommen, um ihren Glauben hier endlich frei leben und verbreiten zu können. In dieser Hinsicht unterschieden sich die Entwicklungen in der „Neuen Welt“ deutlich von den Verhältnissen und Strukturen der „Alten Welt“. Die politische Ordnung, die sich die Siedler in der Neuen Welt gegeben hatten, entwickelte sich streng individualistisch, sozusagen von unten, und im rauhen Kampf ums Überleben. Kennzeichnend war und ist bis heute eine deutliche Abstinenz vom Staat, eine pragmatische Orientierung an den Prinzipien von Selbstverantwortung, von Angebot und Nachfrage und eine nur minimale Regelung sozialer Fragen durch die öffentliche Hand.
Deshalb reichen die Wurzeln der progressiven Erziehungsbewegung in Amerika inhaltlich zum Teil in eine andere Mentalitätsgeschichte zurück als in Europa. Die Freiheit der Religionsausübung spielt im Streben nach Glück und im amerikanischen Demokratieverständnis eine große Rolle.
Der deutsche Soziologe Max Weber hatte zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit seiner Studie ›Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus‹, die im Geburtsjahr von Carl Rogers 1902 erschien, auf Zusammenhänge hingewiesen, die zwischen kapitalistisch-unternehmerischer Unrast einerseits und protestantischer Tugendhaftigkeit und Strebsamkeit (protestantische Pflichtethik) andererseits zu finden sind. Speziell für die calvinistische Variante des Protestantismus galt seiner Meinung nach, dass wirtschaftlicher Erfolg und ein frommes Leben nicht in einem Widerspruch zu sehen sind, sondern dass umgekehrt der wirtschaftliche Erfolg des arbeitsamen und tugendhaften Christenmenschen durchaus auch als Zeichen dafür angesehen werden kann, dass dieser zu den von Gott „Auserwählten“ gehört, der der ewigen Verdammnis des Sünders entkommen ist.
Entsprechend hatte das Klima innerhalb der Familie Walter und Julia Rogers, bei aller Offenheit für Technik und wissenschaftlichen Fortschritt, zugleich auch etwas von der Stimmung in einer Wagenburg aus der Pionierzeit: Man fühlte sich umzingelt von Feinden, Fremden und von unreligiösen Verlockungen und Versuchungen des Vorstadtlebens. Man musste zusammenhalten, und jedermann in dieser auserwählten „Pionierfamilie“ musste sich anstrengen und aufpassen, dass die hohen Standards einer christlich-tugendhaften Lebensführung eingehalten wurden. Das bedeutete konkret: viel Arbeit, keine Freizeit, kein Müßiggang, keine „Laster“ und stets ein Vorbild für die anderen sein.
Carl Rogers selbst beschrieb sein Zuhause als einen Ort, der von einer engen Familienbindung gekennzeichnet war und der bestimmt wurde durch eine strenge und kompromisslos-religiöse und moralisierende Atmosphäre (Rogers 1961: 6). „Gehet aus ihrer Mitte und sondert euch ab!“ – so lautete eines der beliebtesten Bibelzitate von Mutter Julia, mit dem sie die Kinder den weltlichen Versuchungen des Vorstadtlebens zu entziehen suchte. Ein Zweites „All our righteousness is as filthy rags in Thy sight, o Lord!“ machte Carl immer deutlich, dass er zwar zu den Auserwählten gehörte, aber trotzdem durch und durch ein sündiger und nichtswürdiger Mensch sei (Kirschenbaum 1995: 1).
Zweifellos wurde er geliebt, aber die fast exzessive religiöse Sorge der Eltern um das Wohlergehen ihrer Kinder wurde von einer subtilen und liebevollen Kontrolle begleitet, die auch darauf abzielte, einen selbstsüchtigen Eigenwillen frühzeitig zu unterwerfen. Im Hause Rogers herrschte eine protestantische Pflichtethik. Es war selbstverständlich, dass die Familie anders war als andere, und sie führten ihr Leben unter dem hohen Anspruch, dass sie „von Gott auserwählt“ waren. Alkohol war tabu, ebenso Tanzen oder der Besuch eines Theaters. Es gab keine Kartenspiele, und so ziemlich jede Art gesellschaftlicher Unterhaltung und Zerstreuung war verboten. Kein Mensch war gut genug, und alle mussten sich gewaltig anstrengen und rivalisierten untereinander. „Es fällt mir schwer, meine Kinder davon zu überzeugen, dass sogar kohlensäurehaltige Getränke einen leicht sündigen Beigeschmack hatten; und ich erinnere mich an das leichte Gefühl der Verworfenheit, als ich meine erste Flasche,Limo‘ trank“, schreibt Rogers in einem autobiographischen Rückblick auf seine Erziehung (Rogers 1961 / 1976, S. 21).
Carls Selbstwertgefühl war eher negativ entwickelt und besetzt von hohen Idealen und Ansprüchen an sich selbst. All dieses wurde zusammengehalten von einer stetigen Abwertung anderer. Die eine Kirchengemeinde lebte von der Abwertung der anderen, die eigene Familie im Kontrast zu den anderen, und schließlich herrschte dieser bewertende, kontrollierende und abwertende Ton auch innerhalb der Familie.
Andauernde „Sticheleien“ bestimmten das Klima unter den Geschwistern und zwischen den Eltern und Kindern. „Jeder meckerte an dir herum und du meckertest an jedem herum“, so beschrieb Carl später die familiäre Situation seiner Kindertage in einem Interview mit Wesley Westmann und begründete damit, dass er als Kind sich am liebsten aus diesen nervigen Situationen zurückzog und lesend in seine Abenteuerliteratur (James Fenimore Cooper oder Jean Stratton-Porter) flüchtete (Kirschenbaum 1995: 2).
Sein Vater Walter wurde 1868, ebenfalls im Januar, als Sohn eines Bahnschaffners geboren. Er war während seines Ingenieurstudiums an der Universität von Wisconsin Vorsitzender des örtlichen Christlichen Vereins Junger Männer (YMCA) gewesen. Als 20-Jähriger hatte er mit hervorragenden Noten in Mathematik graduiert und war ein weiteres Jahr an der Universität geblieben, um sich im Bereich der angewandten Forschung im Betonbau zu spezialisieren. Für die Wisconsin-Bahngesellschaft baute er später Brücken und machte sich dann mit einer eigenen Firma selbständig. Seine Frau Julia kannte er aus seinen Kindertagen. Sie heirateten 1891, nachdem Julia ihr Studium am College absolviert hatte. Ihre ehrgeizigen Ambitionen konzentrierten sich anschließend darauf, den Haushalt zu führen und das Familienleben zu gestalten. Die Familie betete regelmäßig zu allen Mahlzeiten, Tischgebete um die Gnade Gottes und der Segen wurden zelebriert, die Familie besuchte den Gottesdienst sonntags regelmäßig.
Es ist vor allem Carl, der in diesem Familienleben Verständnis, persönliche Nähe und Zuneigung schmerzlich vermisst. Seine Geschwister erleben Mutter und Vater durchaus anders als er und konnten sich an Situationen erinnern, die sie als liebevoll bezeichneten, so z. B. wie die Mutter bei Carls Schwester am Bett sitzt, als diese Alpträume hatte, und wie sie mit ihr Lieder aus dem Gottesdienst singt.