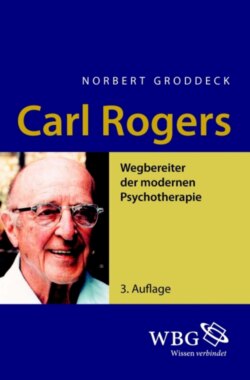Читать книгу Carl Rogers - Norbert Groddeck - Страница 18
Das Studium der klinischen Psychologie
ОглавлениеZurück in New York stand noch das Gespräch mit McGiffert über den Wechsel zum Teachers College an. Es verlief unproblematisch, weil McGiffert keinen seiner Studenten in ein Kirchenamt zwingen wollte, und so beschreibt Rogers diesen Wechsel in seinen eigenen autobiographischen Schriften abgeklärt und vernünftig. Er habe nur auf die andere Seite der Straße gehen müssen, um dort seine Studien fortzusetzen. David Cohen kommentiert diesen Schritt in seiner „kritischen“ Biographie allerdings als einen sehr viel bedeutungsvolleren Akt: Rogers habe mit dieser Entscheidung die Ideale seiner Jugend verraten und sich zu Gunsten einer Karriere gegen den Vorsatz aus seiner Jugendzeit entschieden: „Gehet hin und missionieret die Welt in dieser Generation.“ Dieses Ziel des fundamentalistischen Protestantismus hat er sicherlich aufgegeben, aber sein gesamtes weiteres Wirken und sein Lebenswerk als Psychologe, Berater und Psychotherapeut zeigt deutlich, dass Carl Rogers trotzdem immer ein sendungsbewusster Lehrer und ein engagierter Missionar geblieben ist – freilich zunächst für streng wissenschaftliche und später dann für humanistische Ideale.
Am Teachers College belegte er verschiedene Kurse in klinischer Psychologie. Einer fand unter der Leitung von Leta Hollingworth statt. Rogers beschreibt sie als eine Frau, die die Eigenschaften eines warmherzigen Menschen mit denen einer kompetenten Wissenschaftlerin in einer Person vereinen konnte. Dank Hollingworth machte er erste Erfahrungen in der psychologischen Arbeit mit psychisch traumatisierten Kindern. Diese machte ihm nach einigen kleineren Anlaufschwierigkeiten, weil er so scheu und gehemmt im Umgang auch mit Kindern war, großen Spaß. Nach einer Weile konnte er mit Kindern therapeutische Gespräche führen und auch mit ihnen spielen. Von Leta Hollingworth übernahm er den Terminus „Klient“. In seiner wissenschaftlichen Ausbildung lernte er hier Methoden der Fallstudie, der Längsschnittuntersuchung, der psychodynamischen Tests und spezielle Interviewtechniken kennen.
Es folgten intensive wissenschaftliche Studien z. B. bei E. L. Thorndike, einem Pionier der neueren Testpsychologie im Bereich der Intelligenztests. Das Klima im Fach Psychologie beschrieb Rogers am Teachers College als streng naturwissenschaftlich. Die Haltung war geprägt von einer kalten, objektiven Untersuchungsmethodik, von Laborbedingungen, von statistischen Erhebungen und vergleichenden Messungen. Alles musste messbar sein oder messbar gemacht werden können. Sigmund Freud und die Psychoanalyse galten als unwissenschaftliche Scharlatanerie. Auch Carl Gustav Jung erschien in dieser naturwissenschaftlichen Perspektive obskur, obwohl er sich auch mit Testverfahren den Phänomenen des Seelenlebens genähert hatte. Vielleicht war diese neue naturwissenschaftliche Strenge, die Rogers nun in „seinem“ neuen Fach erlebte, aber auch genau das, was er als „Gegendogma“ gut brauchen konnte. Die sozialpsychologisch beschreibbare Tendenz, sich als strenger (positivistischer) Wissenschaftler über andere Wissenschaftsauffassungen zu erheben, um auf diese dann elitär herabzublicken, dieser Mechanismus war ihm seit Kindertagen aus seiner Familiensozialisation vertraut. Jedenfalls wurde in diesem Institut der experimentell-wissenschaftliche Teil seiner Persönlichkeit aus seinen Jugendtagen auf der Farm mit Morrisons Lehrbuch ›Feeds and Feeding‹ wieder angesprochen und herausgefordert – allerdings nun ohne missionarischen Eifer und emotionale Begeisterung, sondern mit strenger Untersuchungsdisziplin. Es fiel gerade in diesem Studienabschnitt auf, dass Carl bisher stets seinen Neigungen folgend studiert hatte und ihm deshalb als graduierter Student die statistischen Grundkenntnisse im Hauptfach Psychologie fehlten.
Am Ende des ersten Studienjahres wurde ihm das erst mitten in den Abschlusstests bewusst, als er die letzten Aufgaben der Klausur, in denen es um teststatistische Fragen ging, nicht beantworten konnte. Dass er in Prüfungssituationen nicht brillieren konnte, war er nicht gewohnt. Bis hierhin war er stets von einem intellektuellen Erfolg leichtfüßig zum nächsten geeilt, sein IQ-Test hatte hervorragende Ergebnisse gebracht und ihm Brillanz bescheinigt – und jetzt das! Er stürzte in depressive Selbstzweifel und wurde ärgerlich. Nach der Darstellung von David Cohen beschimpfte er den Aufsichtsführenden, dass die Vorlesung unübersichtlich gewesen und der vorlesende Professor nicht den besten Lehrmethoden gefolgt sei (Cohen 1997: 52). Später war er nie sicher, ob er die Prüfung nur wegen seines Aufbegehrens bestanden hatte oder wegen seines Wissens. Aber er hatte damit auch ein wichtiges Erleben, was Prüfungsangst bewirken konnte, und seine ersten Zweifel an der Angemessenheit wissenschaftlicher Kriterien in der Messung von pädagogischen Erfolgen. Gleichwohl blieb er im Umfeld des Psychologischen Instituts und legte dort später dann auch seine Doktorarbeit vor.