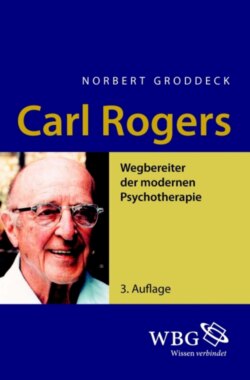Читать книгу Carl Rogers - Norbert Groddeck - Страница 8
Einleitung
ОглавлениеDie Konferenz vom 11. bis 15. Dezember 1985 in Phoenix (Arizona) war wohl so etwas wie das „Woodstock“ in der Geschichte der Psychotherapie. Obwohl der Dezember prinzipiell ein ungünstiger Termin für eine solche internationale Großveranstaltung ist, nahmen daran fast alle „Pioniere“ teil, die in dem zurückliegenden Jahrhundert eigene psychotherapeutische Konzepte vorgestellt und verbreitet hatten. Carl Rogers war mit 83 Jahren einer der Ältesten.1 Er konnte als Begründer der klient-zentrierten Psychotherapie auf ein fruchtbares Leben und Werk als Psychologe, Psychotherapeut und Psychotherapieforscher zurückblicken und hatte sich darüber hinaus – als eine „Gallionsfigur“ der humanistischen Psychologie und Pädagogik – im öffentlichen Leben Amerikas zu vielen sozialen Fragen geäußert und sich persönlich mit seinem person-zentrierten Ansatz in einer weltweiten Friedensarbeit engagiert. Seine 16 Bücher wurden in 12 Sprachen übersetzt und erreichten so die Menschen in mehr als 25 Ländern. Kein Zweifel: Er hatte eine Botschaft, die die Menschen unmittelbar berührte und die etwas von dem aussprach, was sie selbst auch fühlten.
Bevor er auf dieser Konferenz mit seinen Vortrag starten konnte, musste er lange warten. 7000 Konferenzteilnehmer feierten ihn fünf Minuten lang mit „Standing Ovations“, um so seinen Beitrag zur Entwicklung der doch noch jungen Geschichte der Psychotherapie zu würdigen. Es folgte ein anschaulicher und eindrucksvoller Vortrag zum Thema „Empathie“. Rogers sprach darüber, wie das Phänomen der Einfühlung in unterschiedlichen psychotherapeutischen Konzepten, seinem eigenen, dem des Psychoanalytikers Heinz Kohut und dem des Hypnotherapeuten Milton H. Erickson, zur Anwendung kommt und gab darüber hinaus – wie immer zu solchen Gelegenheiten – eine (auf Video mitgeschnittene) Demonstrationssitzung mit einer freiwilligen Klientin aus dem Publikum. Schließlich beantwortete er persönlichen Fragen, so z. B. was er über den Tod und das Sterben denke. Nach einigen allgemeinen Überlegungen und auch konkreten Aussagen über seine gegenwärtige körperliche und geistige Verfassung hielt er inne und sagte mit nachdenklicher Stimme: „Als ich ein Kind war, wurde mir prophezeit, dass ich jung sterben würde. Jetzt, da ich 83 Jahre alt geworden bin, weiß ich, dass sich diese Prophezeiung erfüllen wird“ (Zeig 1991, S. 34).
Rogers’ Leben (1902 – 1987) umfasst nahezu das gesamte 20. Jahrhundert. Aus einer sehr engen und stark religiös geprägten protestantischen Familie des mittleren Westens kommend, befand er sich in seinem ersten Lebensabschnitt augenscheinlich im Zustand schmerzlicher Einsamkeit. Kontakt, Beziehung, Nähe, persönliche Vertrautheit und Intimität waren – seinen Berichten zufolge – in seiner Familie für ihn nicht erfahrbar. Stattdessen erlebte er Bewertung, Kontrolle, hohe Ansprüche – und Unzulänglichkeitsgefühle, die von hohen und nicht erreichbaren Idealen ausgelöst wurden. Im Angesicht Gottes fühlte sich Carl als ein Nichts, als ein Sünder, der allein durch viel Arbeit und durch gute Taten vor diesem strengen Gott bestehen konnte.
Der sensible Carl war als Kind und Jugendlicher für die als „grausam“ empfundenen religiösen Botschaften empfänglich, die ihn innerlich in ein Gefängnis aus Anstrengung, Einsamkeit und Kontaktlosigkeit führten. Sein Lebensweg und -werk sind von seiner Suche nach einem Du, nach einer konkret spürbaren und fühlbaren Person als Gegenüber geprägt, die ihn aus dieser Einsamkeit befreien könnte. Die hohe Sensibilität als Zuhörer, die unglaublichen empathischen und mitfühlenden Qualitäten, aber auch die Achtung und der große Respekt vor dem Anderen, kurzum alle Beziehungsqualitäten, die sein psychotherapeutisches Konzept als heilsam beschreibt, sind Dinge, an denen es ihm selbst von Kindesbeinen an sehr mangelte. Dass Carl mit seiner Begeisterung für Natur, Technik und Landwirtschaft letztlich nicht Landwirtschaft oder Ingenieurwissenschaft studierte, sondern eine Berufung zur Arbeit mit Menschen in sich spürte und so zuerst als Pfarrer und später als Psychologe, Berater, Psychotherapeut, Lehrer und Gruppenleiter arbeitete, hat gewiss mit dieser tiefsitzenden Einsamkeit zu tun, in der er sich als Kind und Jugendlicher einrichten musste, und mit den kostbaren Erlebnissen glücklicher Situationen, wenn es ihm gelang, diese Einsamkeit durch einen fühlbaren Kontakt zu einem Gegenüber zu durchbrechen. Im Schonraum der Therapie, und hier insbesondere als Therapeut, konnte Carl, wie er später in seinen autobiographischen Schriften bemerkt, zaghafte Versuche mit zwischenmenschlicher Nähe und persönlichen Beziehungen machen, Erfahrungen sammeln und selbst in dieser Hinsicht dazulernen und nachreifen. Bis ins hohe Alter hatte Carl mit dieser inneren Anstrengung zu kämpfen, sich einsam zu fühlen, einerseits den Kontakt zu anderen zu suchen und andererseits zugleich vor diesem Kontakt wiederum ängstlich und verzagt zu sein und ihn nicht richtig genießen zu können. Es fiel ihm schwer, positive Zuwendung wirklich anzunehmen. Und es verunsicherte ihn zutiefst, wenn er Zuwendung, Anerkennung und gar Lob oder Bewunderung erfuhr. Das Ringen mit diesem Problem blieb Carl Rogers bis ins hohe Alter erhalten.
Referenten der Konferenz „Evolution of the Psychotherapie“ 1985 in Phönix, Arizona (aus: Zeig, J. K. [Hrsg.] 1991. Foto mit freundlicher Genehmigung des DGVT-Verlags, Tübingen. Erläuterung siehe oben, Fußnote 1).
Carl hat in vielen autobiographischen Passagen selbst von dieser Einsamkeit als Kind gesprochen, aber in welchem Ausmaß diese religiöse Enge, von der er sich im Alter von etwa 20 Jahren lossagte, sein Leben trotzdem beherrschte, ist mir erst während meiner Arbeit an seiner Biographie deutlich geworden. Carl brachte alle Voraussetzungen für das so genannte „Helfersyndrom“ oder auch für das Phänomen des „burn-out“ mit: hohe Ideale, geringes Selbstwertgefühl, extremes Verantwortungsgefühl und eine große Leistungsbereitschaft, für andere da zu sein. Alles dieses hat ihn in seinem beruflichen und persönlichen Leben wenigstens zweimal an den Rand des Zusammenbruchs geführt.
Rogers hat in seinem Leben immer wieder erneut damit gerungen, einen Ausweg aus dieser „Falle“ zu finden. Und er hat stets neue Versuche und Anläufe unternommen, als Person zu anderen hindurchzudringen, um diese im Gespräch und in der Begegnung wirklich zu erreichen. Entweder durch seine einzigartige intensive Art des empathischen Zuhörens und Verstehens, die er in den ersten Berufsjahren entwickelt hat (nichtdirektive Phase), oder indem er später verstärkt das Risiko einging, sein eigenes persönliches Erleben mitzuteilen und von sich und seinen Empfindungen und Erfahrungen zu sprechen und zu schreiben (person-zentrierter Ansatz). So ist die von ihm praktizierte Beratung und Psychotherapie immer mehr ein Prozess wechselseitigen Gebens und Nehmens zwischen Klient und Therapeut geworden, in dem der Klient zu sich selbst finden, als Person aus gegenwärtigem Leid auftauchen kann und auf eine reale Person (die des Therapeuten) trifft, die sich in kongruenter Weise für die Entwicklung des Klienten verfügbar macht. Die Zuwendung und Aufmerksamkeit des Beraters gilt vorwiegend der Person des Klienten, die zwar aktuell von Lebenskrisen, Leid und Störungen überwältigt, entmutigt und fast unsichtbar geworden ist, die aber, wenn sie wieder auftauchen kann, immer noch alle Möglichkeiten hat zu wählen, Entscheidungen zu treffen und ihr Leben aktiv und mit persönlicher Befriedigung zu gestalten. Da Rogers’ Leben selbst von diesem kreativen Ringen um Selbstverwirklichung und Authentizität geprägt war, konnte er „seine“ Klienten in dieser Hinsicht auch besonders gut verstehen. Die von ihm entwickelte klient-zentrierte Psychotherapie und der später von ihm propagierte person-zentrierte Ansatz sind Ergebnisse seines persönlichen Ringens um ein Leben in authentischen Beziehungen.
Seine persönlichen Fähigkeiten als Zuhörer, Berater und Therapeut waren eindrucksvoll. Es gibt zahllose Berichte, in denen Personen schildern, dass ein Gespräch von einer guten halben Stunde ausgereicht habe, um dramatische positive Veränderungen in ihrem Leben zu bewirken. Rogers war ein perfekter Zuhörer, der zudem die Gabe hatte, ganz unterschiedliche Menschen in ihrem Selbstverständnis so zu berühren, dass sie sich in einem existentiellen Sinne „erkannt“, verstanden und aufgehoben fühlten. Selbst die kurzen „Vorführgespräche“ hatten oft eine „erhebende“ Wirkung: Die Betroffenen fühlten sich in ihrer Beziehung zu sich selbst als bessere Wesen gewürdigt und ermutigt ( „empowered“). Die Demonstrationsklientin „Gloria“ zum Beispiel, die sich mit ihren Problemen sowohl Carl Rogers als auch Fritz Perls (Gestalttherapie) und Albert Ellis (Rational Emotive Therapie) zu vergleichenden Filmaufnahmen zur Verfügung gestellt hatte, behielt noch lange nach diesem Interview gerade die Begegnung mit Carl Rogers in guter Erinnerung und pflegte noch viele Jahre einen brieflichen Kontakt mit ihm. Ruth Cohn, die Propagandistin des gruppenpädagogischen und gruppentherapeutischen Konzepts der „Themenzentrierten Interaktion“ (TZI), beschrieb ihre Erfahrungen als Demonstrationsklientin mit Carl auf dem Jahreskongress des amerikanischen Psychologenverbandes (APA) 1965 mit folgenden Worten: „Carl Rogers beeindruckte mich tief. Er arbeitete ohne Regression, ohne Interpretation, ohne Spiele, ohne Übungen, ohne Gestalttechniken. Er arbeitete mit der Fähigkeit, sich voll auf den anderen zu konzentrieren und sich zugleich in sich selbst zu versenken, um aus der Tiefe heraus den Anderen zu verstehen. Ich habe keinen begabteren Therapeuten kennen gelernt“ (Cohn/Farau 1984, S. 289).
Trotzdem ist die Praxis und Theorie seines Beratungs- und Therapiekonzeptes nicht unumstritten. Wie präsent und kontrovers Rogers’ Einfluss selbst in alltäglichen Ausbildungssituationen noch immer ist, will ich an Beispielen aus meinem Erfahrungsfeld aufzeigen: In meinem Siegener Ausbildungsinstitut (akt) wurden 1977 im kleinen Kreis einer Ausbildungsgruppe persönliche Eindrücke zum Konzept der klient-zentrierten Beratung und Therapie und zum Werk von Carl R. Rogers ausgetauscht: Ein Teilnehmer berichtete der Gruppe von den „Aggressionen, die mich nachts überfallen, wenn ich an die Bücher von Carl Rogers denken muss! Allein dieses ewig grinsend-freundliche Gesicht auf dem Foto (Rückseite der beiden Taschenbücher, die 1971 als Standardwerke in Deutschland erschienen waren) bringen mich zur Raserei. Ich kann dieses ewige Getue, das sanfte ‚Rumgefühle‘ und diese ganze Scheinheiligkeit nicht mehr sehen. Er macht mich rasend!“ In der Gruppe herrschte betretendes Schweigen. Auch ich musste zunächst etwas tiefer Luft holen, weil etwas ausgesprochen worden war, was auch ein Teil der übrigen Teilnehmer offensichtlich dachte, aber nicht auszusprechen wagte. Diese hohen Ansprüche an Menschlichkeit, Einfühlung und Verständnis – können diese wirklich realisiert werden? Ist nicht gerade dies schon wieder unmenschlich?
Eine andere Teilnehmerin berichtete hingegen: „Carl Rogers hat mir das Leben gerettet!“ Sie hatte im Umfeld ihrer Ehekrise und einer erfolglosen Paartherapie in den 1970er Jahren begonnen, sich für psychologische Bücher zu interessieren. Verzweifelt und mit ihren Kindern alleine stieß sie damals in einer kleinen Buchhandlung zufällig auf das „rote Buch“ von Carl (›Die Kraft des Guten‹). Sie kaufte es und nahm es mit in den Urlaub, den sie mit ihren Kindern zum ersten Mal alleine verbringen wollte. „Ich habe das Buch in der ersten Nacht von Anfang bis Ende durchgelesen und war zwischendrin immer wieder von Tränen ergriffen! – Hier ging jemand davon aus, dass Menschen prinzipiell in Ordnung sind, dass also auch ich in Ordnung bin?! – Ich war persönlich angesprochen von dieser positiven Botschaft. Unter vielen Tränen merkte ich beim Lesen, wie unbedacht ich mit einer Auffassung von mir selbst groß geworden bin, die besagte, dass ich nichts wert bin. Es steckt ein Teufel in mir! Ich mache alles falsch und es wäre am besten, es gäbe mich nicht! Diese Grundhaltung hatte sich in meinem Leben von Kindesbeinen an eingenistet und war durch die Erfahrung im Familienleben und auch in meiner späteren Beziehung immer wieder neu bestätigt worden. Aber plötzlich, beim Lesen dieses Buches, konnte ich zum ersten Mal aufatmen in meinem Leben! Kein anderes Buch hatte bisher eine solche direkte Auswirkung auf mich und mein Leben gehabt!“
Ein drittes Beispiel: Meine Frau Ariane hatte als Dozentin an einer Zivildienstschule die Aufgabe, mit ihrem Unterricht junge Wehrdienstverweigerer für ihre sozialen Aufgaben vorzubereiten. Nachdem sie über Carl Rogers und sein humanistisches Konzept einer hilfreichen Beziehung gesprochen hatte und praktische Übungen im Zuhören durchführen ließ, erhielt sie prompt eine Anzeige von einem Kursteilnehmer und musste sich in der Bundeszentrale für den Zivildienst in Bonn bei dem damaligen Beauftragten für den Zivildienst, Pfarrer Hinze (der später CDU-Generalsekretär wurde), für ihren Unterricht verantworten. Der Vorwurf lautete, sie verbreite anarchistisches Gedankengut. Der junge Mann, der aus einer streng katholischen Jugendbewegung kam und den Wehrdienst aus religiösen Gründen ablehnte, erläuterte in einer Gegenüberstellung, dass die von Ariane vorgestellte Version von Freiheit nach Rogers für die Menschen gefährlich sei und einen Aspekt von anmaßender Selbsterlösung beinhalte. Er fühle sich von seinem christlichen Gewissen dazu aufgerufen, Ariane „das Handwerk zu legen“.2
Und noch ein letztes Beispiel: Ich hatte 1976 – 84 an meiner Hochschule ein Ausbildungsprogramm für Diplompädagogen in klient-zentrierter Gesprächsführung aufgebaut und mich – ohne es zu ahnen – damit tüchtig in die Nesseln und zwischen alle Stühle gesetzt. Als Pädagoge stünde mir das nicht zu, so ereiferte sich ein Kollege aus der Psychologie und wollte mir vom Rektor der Universität solche Seminare verbieten lassen, wenn nicht mindestens ein Psychologe daran beteiligt sei! Meine Kollegen vom Fach Pädagogik/Erziehungswissenschaft duldeten diese Veranstaltungen als eine Art privater Zusatzleistungen zum regulären Lehrangebot, schon weil man sich eine solche Bevormundung von den Psychologen nicht bieten lassen wollte. Bezogen auf die Inhalte meinten sie jedoch, dass Rogers’ Konzept zu persönlich sei und solche Art der Selbsterfahrung mit Erziehungswissenschaft eigentlich gar nichts zu tun habe.
Bei genauerem Hinschauen wird deutlich, das Carl Rogers’ Konzept, dem doch schnell Harmoniesucht und Konfliktvermeidung nachgesagt wird, gerade wegen seiner Werthaltungen Kontroversen und polarisierende Debatten auslöst: Es wird für zu naiv und zugleich für zu anspruchsvoll gehalten, es ist irgendwie zu wenig und verlangt gleichzeitig zu viel, es erscheint der akademischen Welt als ein sehr schlichtes theoretisches Konzept und ist zugleich doch höchst schwierig zu praktizieren. Kurzum, es wirkt auch heute in der institutionellen Landschaft der helfenden Berufe noch immer sperrig und verquer, wenn man seinen Anspruch auf persönliche Authentizität ernst nimmt.
Ein Blick in die Biographie von Carl R. Rogers zeigt, dass diese Kontroversen sein ganzes Werk und seinen Lebensweg begleitet haben. Der scheue und zurückhaltende Carl konnte zugleich sehr beharrlich und kämpferisch sein, wenn es darum ging, für seine Einsichten und Erfahrungen einzutreten. Damit meinte er stets auch die Rechte anderer – die Rechte des Einzelnen auf seine Einzigartigkeit und Unabhängigkeit, ganz im Sinne der amerikanischen Verfassung. Die Psychologie als Wissenschaft und die Psychotherapie als eine psychologische Praxis sollten für ihn selbstverständlich durchwoben sein von demokratischen Prinzipien und hohen ethischen Werten, für die er sich streitbar engagierte. Ein so produktives und weltweit einflussreiches Werk wie das seine hätte natürlich nicht ohne seine Talente als zielstrebiger Organisator, als effektiver Debattenredner, als engagierter und überzeugter Motivator und Promotor, als begnadeter Schriftsteller, Lehrer und Missionar zustande kommen können. Erst wenn man das Lebenswerk in seiner ganzen Spanne überblicken kann, werden diese Dimensionen seines Werkes sichtbar.
Aber bedeutet nicht eine Biographie über Carl Rogers zu schreiben, Eulen nach Athen zu tragen? Jeder, der sich mit seinen Texten beschäftigt hat, stößt unmittelbar auf die autobiographischen Passagen, die Rogers seit den 1960er Jahren den meisten seiner Bücher vorangestellt hat. Im Kapitel „Das bin ich“ seines Werkes ›Entwicklung der Persönlichkeit‹ (1972) beschreibt er beispielsweise auf 40 Seiten ausführlich und eindringlich die Entwicklung seiner fachlichen Ansichten und seiner persönlichen Philosophie im Zusammenhang mit seiner biographischen Entwicklung seit seiner Kindheit. Aber: Dieses Buch wurde bereits 1960 geschrieben, als Rogers gerade mal 58 Jahre alt war, sein Spätwerk und 27 Jahre seines Lebens bleiben darin zwangsläufig unberücksichtigt. Auch in seinen folgenden Werken findet sich darüber nur wenig. 1977 veröffentlicht er „Rückblick. Sechsundvierzig Jahre Carl R. Rogers“ als Einleitungskapitel seines Buches ›Die Person als Mittelpunkt der Wirklichkeit‹ (deutsch: 1980) und reflektiert dort im Alter von 68 Jahren seine berufliche Tätigkeit als Psychologe. Er geht hier deutlicher und klarer auf die Auseinandersetzungen mit der Verhaltenspsychologie und mit der Psychiatrie ein, die er in seinem Berufsleben gesucht hat. Jedoch ist Rogers auch im Alter von 68 Jahren noch sehr umtriebig und hat einen großen Teil (17 Lebensjahre liegen noch vor ihm) seiner vielleicht wichtigsten Erfahrungen und sozialen Experimente noch vor sich. Zum Beispiel seine weltweiten Friedensmissionen, die er erst 1979 in der Zeit nach dem Tod seiner Frau Helen begann. In dem Band ›Der neue Mensch‹, 1980 in den USA erschienen, stellt er ebenfalls biographische Einblicke voran und reflektiert darin vor allem seinen Prozess des Alterns oder, wie er es beschreibt, das „Älterwerden und Wachsen“. Er berichtet darin als inzwischen 75-jähriger Mann über seine körperliche und sexuelle Aktivität und teilt zentrale Lerneinsichten der letzten Jahre mit, so beispielsweise, dass er gelernt hat, für sich selbst zu sorgen, dass seine Aufgeschlossenheit für neue Ideen nicht nachgelassen hat, dass er jetzt endlich offen aussprechen kann, was er schon immer vage empfunden hatte, dass nämlich „mir meine intensive Beschäftigung mit Psychotherapie die Möglichkeit bietet, diese Bedürfnisse nach Intimität vorsichtig zu befriedigen, ohne zu viel von meiner eigenen Person zu riskieren. Ich bin jetzt eher bereit, in anderen Beziehungen Nähe zuzulassen und es zu riskieren, mehr von mir selbst zu geben. Ich fühle mich so, als hätte ich in mir eine neue, ungeahnte tiefe Fähigkeit zur Intimität entdeckt. Diese Fähigkeit hat mir viele Schmerzen eingetragen, aber noch mehr Freude“ (Rogers 1980 / 1981, S. 50). Aber auch in diesem sehr persönlichen Text findet der Leser wenig über Rogers’ Arbeit der letzten Jahre.
Howard Kirschenbaum hat 1979 eine von Rogers autorisierte Biographie vorgelegt. Rogers war zu diesem Zeitpunkt 77 Jahre alt. 1995, also acht Jahre nach Rogers’ Tod, wurde diese Biographie erweitert und modifiziert. Zwar umfasst sie seine komplette Lebensspanne, basiert dabei jedoch im Wesentlichen auf den Angaben von Carl Rogers selbst und auf Interviews, die Kirschenbaum mit ihm durchgeführt hatte. So finden sich hier vorwiegend nur solche Geschichten, die Rogers bereits vorher von sich selbst erzählt hatte. Seine Friedensarbeit von 1980 – 86 wird nicht behandelt.
1992 hatte Brian Thorne in London ein Buch über Rogers’ Leben und Werk vorgelegt. Darin werden der Biographie allerdings nur etwa 20 Seiten gewidmet. Den übrigen Text verwendet Thorne darauf, die Theorien darzustellen, auf Kritiker einzugehen und den weltumspannenden Einfluss von Rogers’ Therapiekonzept zu umreißen. In der Arbeit wird Carl Rogers allerdings nur als der Psychologe und Psychotherapieforscher vorgestellt. Wenngleich er das gewiss auch war, so bezeichnet dies aber nur einen Zeitraum von etwa 25 – 30 Jahren in einem Leben von 85 Jahren. Sein Alterswerk, sein Engagement in der Pädagogik, seine Aktivitäten in der Alternativbewegung der 1960er, 1970er und 1980er Jahre und seine weltweiten Friedensaktivitäten finden auch hier keine angemessene Berücksichtigung.
David Cohen veröffentlichte 1997, ebenfalls in England, eine „kritische“ Biographie, der das Verdienst zukommt, sich nicht nur auf Rogers’ Erzählungen zu stützen, sondern selbst ausgiebig an verschiedenen Orten in Rogers’ persönlichem Nachlass recherchiert zu haben. Diese Arbeit macht Carl Rogers als Person mit Ecken und Kanten und auch mit Schwächen und Fehlern sehr konkret sichtbar. Aber leider wurde diese im Einzelnen sehr fleißige Arbeit allzu sehr von einem sensationslüsternen Standpunkt aus geschrieben. Der Autor erweckt den Eindruck, als wollte er unbedingt etwas aufdecken, frei nach dem Motto: „Fritz Perls, der Erfinder der Gestalttherapie, hat mit seinen Patientinnen geschlafen, Carl Gustav Jung hat mit dem Faschismus geflirtet, Jean-Paul Sartre hat junge Frauen ausgenutzt und war biestig zu Simone de Beauvoir, Bruno Bettelheim, der große Kinderpsychologe, war brutal zu Kindern – mal sehen, was wir bei Carl Rogers finden können“ (Cohen 1997, S. 18). So verliert denn die biographische Detailarbeit von Cohen an Glaubwürdigkeit, und es bleibt der Verdacht, dass er seine Recherchen in den persönlichen Unterlagen von Carl Rogers nur benutzte, um das Klischee von „dem Psychologen“ zu bedienen, der von dem, was er predigt, selbst meilenweit entfernt ist.
Als jüngster Text über das Leben und Werk von Carl Rogers wurde von Reinhold Stipsits 1999 eine sehr umfangreiche und ausführliche Arbeit mit dem Titel ›Gegenlicht. Studien zum Werk von Carl R. Rogers‹ vorgelegt. Diese materialreiche Darstellung ist als akademische Habilitationsschrift verfasst und leidet, so eindrucksvoll und kenntnisreich sie auch ist, zugleich an diesem Umstand. Der nicht mit den akademischen Sprach- und Reflexionsspielen vertraute Leser wird das Buch vermutlich relativ bald wieder aus den Händen legen, weil der Verfasser seiner gelehrten Prüfungskommission offensichtlich nicht einfach eine biographische Erzählung vorlegen durfte, ohne den Nachweis zu führen, dass er mit allen akademischen Diskursen des postmodernen Wissenschaftsbetriebs vertraut ist. Ein zusammenhängender biographischer Überblick über Rogers’ Leben und Werk ist aus dieser anspruchsvollen Studie deshalb nur schwer zu rekonstruieren.
Aufgrund der beschriebenen Literaturlage schien es mir sehr sinnvoll zu sein, eine zusammenhängende Biographie von Carl Rogers für einen deutschsprachigen Leserkreis zu schreiben, und zu versuchen, seinen Lebensweg und sein bemerkenswertes Werk auch in dem Kontext zu zeigen, in dem es sozialgeschichtlich entstanden ist.