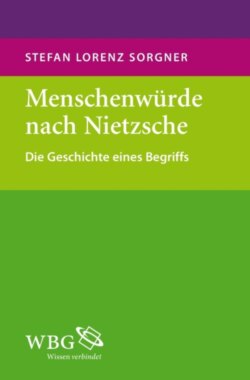Читать книгу Menschenwürde nach Nietzsche - Stefan Lorenz Sorgner - Страница 22
2.3.1 Das höchste Gut
ОглавлениеWie bei den meisten antiken und mittelalterlichen Philosophen steht das höchste Gut auch im Zentrum von Ciceros Denken. Ein Aspekt des höchsten Gutes ist das gute Leben, schließlich sei das Gute Ziel menschlichen Handelns. Gemäß der Stoiker erreiche man das Gute durch ein „naturgemäßes Leben“ und eine solche Konzeption kristallisiert sich auch bei Cicero heraus (Goedeckemeyer 1905, 150). Merklin schreibt zu Cicero und dem höchsten Gut: „Allein im Streben nach diesem höchsten Gut, das gleichbedeutend ist mit dem Prozess einer Angleichung an Gott, erfüllt sich die wahre Bestimmung des Menschen“ (1989, 7).
Ciceros Anliegen, wie das vieler Philosophen vor Descartes, ist ein ethischmetaphysisches, nämlich die Frage nach dem höchsten Gut. Das höchste Gut beinhaltet die Erkenntnis der Richtlinien für das gute und das gemeinschaftliche Leben. Das gute Leben ist das individuell gute Leben und das gemeinschaftliche Leben ist das, was für die politische Gemeinschaft, in der man sich befindet, gut ist. Bei Cicero, wie bei vielen antiken Philosophen, war keine Spannung zwischen diesen beiden Fragestellungen vorhanden. Der Bereich der positiven Gesetze ist formal von dem des Guten und des gemeinschaftlich Rechten getrennt. Cicero plädiert jedoch dafür, dass alle positiven Gesetze „auf allgemein-menschlich-göttliche Gesetze zurückgeführt, ihm wenigstens soweit als tunlich angenährt werden“ (Bloch 1961, 33) sollten.
Ciceros Abhandlung „De Officiis“ behandelt das pflichtgemäße Handeln, bei dem zwei Aspekte zu berücksichtigen sind (De off. 7f). Der eine Aspekt beziehe sich auf das höchste Gut und der andere auf die Vorschriften, „nach denen in jeder Hinsicht das tägliche Leben gestaltet werden kann“. Er betont, dass sich die Anweisungen innerhalb dieses Buches zwar auf das höchste Gut beziehen, aber letztlich „Unterweisungen für das Leben im allgemeinen“ sind. Ziel der Schrift sei es, den noch nicht Weisen (mit diesem Buch primär seinem Sohn) zu helfen, sich der Tugend, die mit dem höchsten Gut verbunden ist, wie sich noch zeigen wird, anzunähern. Außerdem unterscheidet er zwischen den mittleren und den vollkommenen Pflichten und sagt explizit, dass in „De Officiis“ die mittleren Pflichten erörtert wurden.28 Diese seien „nicht nur den Weisen eigen, sondern gemeinsam der ganzen Menschheit“ (De off. III 15). Die vollkommenen Pflichten hingegen kämen den Weisen zu.
Das vollkommen Ehrenhafte besitzt nur der Weise. Die, die nicht vollkommen weise sind, haben nur ein Abbild des Ehrenhaften (De off. III 14). Im Gegensatz zu den Stoikern geht Cicero jedoch davon aus, dass eine graduelle Annäherung an die Tugend möglich sei.29 Stoiker vertreten die Ansicht, dass jeder, der nicht tugendhaft ist, lasterhaft ist und wer eine Tugend besitzt, müsse auch alle anderen besitzen. Außerdem haben sich die Stoiker in ihren Traktaten hauptsächlich auf die Eigenschaften eines Weisen konzentriert, Cicero hingegen geht primär auf den vir bonus ein30, also einen Mann, der nicht die Vollkommenheit erreicht hat, sondern auf dem Weg der Tugend stetig voranschreitet. Sicherlich hatte er bei der Charakterisierung eines vir bonum einen vornehmen, römischen Angehörigen der Optimatenpartei vor Augen.
Um die mittleren Pflichten zu vermitteln, also die, die notwendig und hinreichend sind, um weise zu werden, geht Cicero wie folgt vor: Zunächst erläutert er, was ehrenhaft, dann, was nützlich sei, um schließlich zu fragen, ob es zu Spannungen zwischen den Bereichen der Ehre und des Nutzens kommt. Weiterhin unterscheidet er zwischen mehr oder weniger nützlichen und ehrenhaften Handlungen. Nützlich ist alles, was mit Macht und Reichtum zu tun hat.31 Im zweiten und dritten Buch zeigt Cicero, dass tugendhaftes Verhalten auch nützlich sei und alles, was wirklich nützlich sei, nicht im Konflikt zu tugendhaftem Verhalten stehe.32 Z.B.: „In jeder erdenklichen Weise also ist Gerechtigkeit zu pflegen und zu wahren: zum einen um ihrer selbst willen – denn sonst wäre es keine Gerechtigkeit –, zum anderen besonders wegen der Steigerung von Ehre und Ruhm“ (De off. II 42).