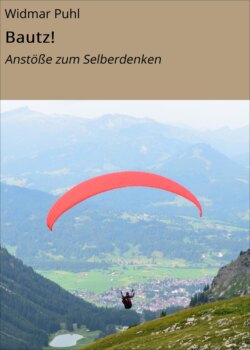Читать книгу Bautz! - Widmar Puhl - Страница 10
Armut und Würde Die Würde des Menschen ist unantastbar
Оглавление(Artikel 1 Gundgesetz)
„Nicht wer wenig hat ist arm, sondern wer viel wünscht“, schrieb der römische Philosoph Seneca. Passt dieser Gedanke noch in die Konsumwelt von heute? Werbung und Medien wecken ständig neue Wünsche. Auch Erziehung und kulturelle Tradition erzeugen den Wunsch, bestimmten Vorbildern zu genügen. Welche dieser Wünsche sind berechtigt und welche nicht? Der Staat hat ebenfalls Wünsche. Seine Bürger sollen auf eigenen Füßen stehen, nach Möglichkeit Steuern zahlen und am öffentlichen Leben teilnehmen durch ihr Engagement im Ehrenamt, in Kultur und in politischen Parteien. Was aber, wenn immer mehr Menschen das möchten, aber gar nicht können, weil ihre Arbeit zu wenig einbringt oder weil sie krank sind?
Als arm gilt, wer lebenswichtige Grundbedürfnisse nicht befriedigen kann: Körperliche Grundbedürfnisse wie Essen, Trinken, Schlaf und Gesundheit; geistige Grundbedürfnisse wie Sicherheit, Anerkennung und Teilhabe an kulturellen und politischen Leben. Wenn das Einkommen unterhalb der sogenannten Armutsgrenze liegt, ist die freie Gestaltung des Lebens unmöglich. Deshalb haben Armut und Würde viel miteinander zu tun. Der Obdachlose, der im Pappkarton schläft, ist in dieser Entscheidung nicht mehr frei.
Noch vor 200 Jahren galt Armut grundsätzlich nicht als gesellschaftlich verursacht, sondern als persönlich verschuldet oder gar "gottgewollt". Mit der Industrialisierung wuchs in Europa eine andere Einsicht: Armut als Massenphänomen ist ein Ergebnis von Verteilungsprozessen und somit ein politisches Problem. Arm wird man vor allem durch Arbeitslosigkeit, Unterbeschäftigung und sehr ungleiche Einkommen. Im ersten Armutsbericht der Bundesregierung von 2001 heißt es: „Der Begriff Armut entzieht sich wegen seiner Vielschichtigkeit einer allgemeingültigen Definition.“
Der Siegener Soziologe Rainer Geißler untersucht die Wohlstandsgesellschaft. Er hält es für typisch, dass in Wohlstandsgesellschaften die Ungleichheit bei Einkommen und Vermögen zunimmt. Was Armut wirklich ausmacht, bleibt umstritten. Unumstritten steht aber fest:
Erstens ist Armut in entwickelten Gesellschaften relativ, also keine Frage des nackten Überlebens mehr – wie noch in vielen Ländern der Dritten Welt –, sondern eine Frage des menschenwürdigen Lebens. Zweitens: Armut bedeutet in jeder Gesellschaft und zu jeder Zeit etwas anderes. Drittens: Armut ist auch ein soziales Problem. Sie bedeutet nicht nur den Verlust existenzieller Chancengleichheit, sondern auch den weitgehenden Ausschluss von der Teilnahme am gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Leben. Dies bleibt nicht ohne psychische Folgen, unter denen nicht nur die Betroffenen selbst leiden. Auch diese Form der Entwürdigung, nicht nur die durch Gewaltverbrechen, meint das deutsche Grundgesetz mit Artikel 1, der lautet „Die Würde des Menschen ist unantastbar“.
Die Idee der Menschenwürde ist historisch gewachsen. Teile davon finden sich schon in der Antike und in der Gründerzeit aller Weltreligionen. Dazu zählt etwa der Gedanke, dass alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind. Seit der Reformation gehört Gewissensfreiheit zur Menschenwürde. Aus der Aufklärung stammt die Einsicht, dass nur Freiheit, Gleichheit und Menschenwürde den Frieden sichern. Heute sind wir davon überzeugt, dass eine Demokratie die Menschenwürde am besten sichert. Doch der Demokratie droht die Pleite, wenn es immer weniger Steuerzahler gibt. Firmen sind nicht demokratisch organisiert und meist mehr am Gewinn als am Gemeinwohl orientiert. Nur sie können aber wirklich Arbeitsplätze schaffen. Zur Zeit jedoch tun viele das Gegenteil und flüchten aus der Verantwortung fürs Gemeinwohl.
Der Philosoph Immanuel Kant hat die Menschenwürde an sich definiert. Danach wird die Menschenwürde verletzt, wenn ein Mensch einen anderen bloß als Mittel für seine eigenen Zwecke benutzt – etwa durch Leibeigenschaft, Sklaverei, Unterdrückung oder Betrug. Das ist der Kern einer absoluten, objektiven Moral. Große Teile der Wirtschaft verhalten sich aber heute so, als wäre die Arbeitswelt ein moralfreier Raum, und deshalb häufen sich Armut und Verstöße gegen die Menschenwürde, die laut Artikel 1 des deutschen Grundgesetzes unantastbar ist.
Die Menschenwürde wird auch verletzt, wenn die Opfer anonym bleiben – also bei Markentyrannei, Versicherungsbetrug, Steuerhinterziehung oder Missbrauch der Sozialsysteme. Ich finde, solchen Missbrauch treibt nicht nur der Empfänger von Arbeitslosengeld, der zugleich schwarz arbeitet. Eigentlich tun das auch – bisher ganz legal – Konzerne, wenn sie „Beschäftigungsgesellschaften“ für entlassene Mitarbeiter bilden, deren Gehälter hauptsächlich die Bundesagentur für Arbeit aus Steuermitteln und aus der Arbeitslosenversicherung zahlt.
Nach wie vor wäre in Deutschland Wohlstand für alle möglich. Doch zu viele sind z. B. einfach nicht bereit, auf Schwarzarbeit zu verzichten und ehrlich ihre Steuern zu zahlen. Zu wenige von denen, die wirklich viel haben, sind bereit zu teilen und sich etwa mit kleineren Gewinnspannen zufrieden zu geben. Sie schätzen Menschen nur als Kunden, aber nicht als Mitarbeiter. So entsteht Überfluss hier und Armut dort, hier ein menschenverachtendes Über-Ego, dort verletzte Menschenwürde.