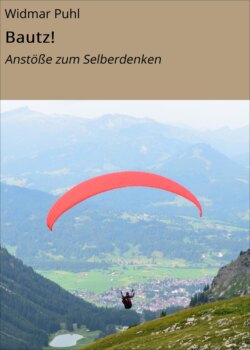Читать книгу Bautz! - Widmar Puhl - Страница 12
Nur ein Kommunikationsproblem?
ОглавлениеWorüber reden wir bei "Armut und Würde"? Und wie reden wir darüber – oder wie eben auch nicht? Reden wir zum Beispiel einmal über verdeckte Armut. Die heimlichen Armen sind Menschen, die mit weniger auskommen, als § 21 des Bundessozialhilfegesetzes vorsieht. Er regelt unter anderem die Ansprüche auf Kleidung: Pro Jahr zwei Hosen und ein Jackett, einen Schlafanzug, drei Paar Socken, drei Hemden, ein Paar Schuhe und sechs Paar Unterhosen. Für Damen gibt´s etwas mehr. Männer brauchen weder Strumpfhosen noch BHs. Das so genannte Kleidergeld wird oft als Pauschale ausgezahlt: für Frauen rund 350 und für Männer 300 € im Jahr. Das ist keine richtige Armut mehr.
Ich kenne Menschen, die hart arbeiten und so wenig verdienen, dass sie sich die letzte Jacke und den letzten Pyjama vor zehn Jahren, die letzte Hose vor fünf und die letzten Schuhe vor drei Jahren kaufen konnten. Socken oder Unterwäsche kaufen sie grundsätzlich bei Billiganbietern. Viele von ihnen wären glücklich über ein solches Budget allein für Kleidung, wie es die Sozialhilfe bietet. Aber dafür müssten sie vor möglicherweise hämischen Behördenaugen zuvor die letzte Unterhose fallen lassen. Diese schlecht bezahlten Menschen zahlen stattdessen Steuern und finanzieren damit Sozialleistungen für andere. Kann man den Beziehern von Sozialleistungen wirklich nicht zumuten, was diesen Steuerzahlern zugemutet wird? Sollten Berufstätige nicht deutlich mehr in der Tasche haben als Sozialhilfeempfänger?
Vor allem bei Alleinerziehenden und Teilzeitbeschäftigten sind auskömmliche Nettolöhne eine Milchmädchenrechnung. Sie berücksichtigen einfach nicht, was das Leben kostet, ganz abgesehen von den happigen Abzügen auch schon bei kleinen Einkommen. Ein lediger Arbeitnehmer mit 1.774 € brutto im Monat hat es sehr schwer, seine Würde zu wahren, wenn er nicht mehr in der Tasche hat als ein Langzeitarbeitsloser mit einem Zwei-Euro-Job in Vollzeit. Die Abgabenlast für kleine und mittlere Einkommen ist unangemessen.
Das macht Wut und Verbitterung bei den Betroffenen verständlich. Wenn wir zu Hause über Armut und Würde reden, dann meistens über solche Fälle in Familie, Nachbarschaft, Freundes- und Bekanntenkreis. Über konkrete Nahaufnahmen regen sich die Menschen auf. Richtige Armut verletzt ihr Gefühl für Gerechtigkeit, auch wenn sie persönlich besser dran sind.
Oder wir reden über Armut, die weit weg ist: Auf unterschiedliche Weise blenden wir Armut aus. Betroffene verdrängen ihre Lage. Nichtbetroffene reden mitleidig über die Probleme der Dritten Welt, lassen sie aber nur selten an sich heran, zum Beispiel nach der Flutkatastrophe in Asien. Andere bedecken ihre soziale Scham mit irgendeinem Feigenblatt nach dem Motto: Die Welt ist in Ordnung, so lange nur in den eigenen vier Wänden, in der eigenen Familie, auf dem eigenen Konto alles stimmt. Schon der Liedermacher Franz Josef Degenhardt hatte für diese Menschen den Rat: „Spiel nicht mit den Schmuddelkindern, sing nicht ihre Lieder! Geh doch in die Oberstadt, mach´s wie Deine Brüder!“
Anscheinend haben ihn viele seiner Zuhörer nicht ironisch, sondern wörtlich und damit falsch verstanden. Denn: Wer es sich leisten kann, lässt seine Kinder behütet aufwachsen und beileibe nicht mit jedem spielen. Sie werden zur Schule und wieder nach Hause chauffiert, zum Sport, zur Nachhilfe und zum Musiklehrer. Da kommen sie nie mit den Schmuddelkindern zusammen, auch nicht im Bus.
Viele Eltern verhalten sich aus Sicherheitsgründen so. Damit geben sie zu, wie dramatisch groß und tief die Kluft inzwischen ist zwischen Oben und Unten. Ein neues Klassenbewusstsein herrscht. Man bleibt wieder gern unter sich und hält sich unkritisch an alte Weisheiten. Eine davon ist heute besonders bitter: „Wer Arbeit will, findet auch welche“. Ja, aber was für eine?
Wir müssen mehr über Armut und Würde reden. Über falsche und echte Armut, über Zumutungen. Über offizielle, um die sich der Staat kümmert, und verdeckte, nach der kein Hahn kräht. Wir müssen auch über die Frage sprechen, wie viel finanzieller Spielraum für wen „angemessen“ ist. Sind alle Bedürfnisse gleichberechtigt? – Wohl kaum. Nur ein Beispiel: Wohlhabende Omas, die ihre Enkel maßlos verwöhnen, fördern damit ein falsches Markenbedürfnis. Die Vorstellung, es gebe einen Anspruch auf Überfluss, ist unangemessen. Und dann gibt es tatsächlich Sozialrichter, die Pendlern sagen, sie könnten an den fälligen Inspektionen sparen. Sichere Autos, eine Haushaltshilfe für Behinderte oder eine menschenwürdige Pflege für Pflegefälle sind aber kein Überfluss. Dafür wäre finanzieller Spielraum angemessen – und nicht Zynismus.