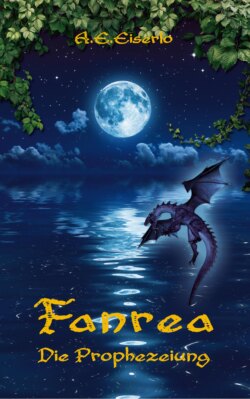Читать книгу Fanrea - A.E. Eiserlo - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Eine traurige Nachricht
ОглавлениеAm nächsten Morgen holte Ben seine Freundin zu Hause ab. Die beiden gingen zur Schule, aber irgendetwas war anders als sonst. Emma bemerkte, wie schweigsam, blass und bedrückt Ben heute war. Aufmerksam betrachtete sie ihn von der Seite und erkundigte sich: »Stimmt was nicht?«
Ben brummte nur unwirsch.
»Hast du Hunger?«
»Nee!«
»Was ist los mit dir? Hast du Stress mit deinen Eltern?«
Da blaffte er sie an: »Nichts! Es ist nichts! Lass mich einfach in Ruhe und stell mir keine blöden Fragen!«
Emma war erstaunt, aber auch ein bisschen gekränkt über die barsche Antwort. So abweisend verhielt Ben sich ihr gegenüber normalerweise nicht.
Schweigend setzten sie den Weg fort, beide hingen ihren Gedanken nach.
Emma grübelte: Etwas wirklich Schlimmes bedrückte den Freund, andernfalls hätte er nicht so reagiert. Also hatte es keinen Sinn, beleidigt zu sein, Ben brauchte ihre Hilfe. Sie musste ihn zum Reden bringen.
Angestrengt schaute Ben auf den trostlosen Asphalt hinunter, als ob es dort etwas Interessantes zu entdecken gäbe. Es tat ihm leid, dass er Emma angeschnauzt hatte, die Worte waren einfach aus ihm herausgeplatzt. Er wollte nicht, dass sie ihn weinen sah, aber die Tränen ließen sich kaum noch zurückhalten.
Schließlich waren die beiden wortlos an der Schule angekommen. Unvermittelt blieb Emma stehen, versperrte Ben den Weg, während sie ihn fest an seiner Jacke packte. »Jetzt ist Schluss! Ich gehe hier nicht rein, bevor du mir gesagt hast, warum du so pampig bist. Wir sind Freunde, und Freunden kann man alles sagen!«
Ben nickte und flüsterte: »Ich, ich … war doch gestern beim Augenarzt. Also … das Ergebnis war nicht gut.«
Da fühlte Emma, wie die Angst auf sie übersprang, gleichzeitig bemerkte sie Tränen in Bens Augen. Zögernd fragte sie: »Was, … was meinst du damit? Was bedeutet nicht gut?«
Länger konnte Ben sich nicht mehr beherrschen. Es brach aus ihm heraus: »Ich werde blind!«
Entsetzt starrte Emma ihn an. »Du wirst blind?«
Nun flossen Bens Tränen und es war ihm unglaublich peinlich. Leise bestätigte er: »Ja, der Arzt hat festgestellt, dass ich eine unheilbare Augenkrankheit habe. Das bedeutet, dass ich irgendwann nichts mehr sehen werde. Er sagte, es sei ein schleichender Prozess, der nicht aufzuhalten sei. Ich werde in ein paar Tagen mit meinen Eltern noch zu einem weiteren Spezialisten fahren, um eine zweite Meinung einzuholen. Meine Mutter kennt jede Menge guter Ärzte aus dem Medizinstudium, deshalb fahren wir zu einem ihrer alten Bekannten.«
Emma war schockiert und suchte nach tröstenden Worten, aber es fielen ihr keine ein. Hilflos schaute sie zu Boden. »Wie schrecklich, Ben«, sagte sie leise. Sie fühlte seine Not, konnte nun verstehen, warum er eben verschlossen und mürrisch reagiert hatte. Das Wort Blindheit beinhaltete für Emma so viel Schrecken, dass normale Alltagsprobleme wie Schnee in der Sonne dahinschmolzen und sich auf ein erträgliches Häufchen reduzierten. Die ewige Finsternis war einfach unvorstellbar! Völlig ratlos, wie sie Ben helfen sollte, nahm Emma dessen Hände und drückte sie fest.
Seine Augen suchten ihre. Emma sah nur Verzweiflung darin. Wut breitete sich in ihr aus, weil ihr weder eine Lösung noch tröstende Worte einfielen. Bens Gesicht war so vertraut, aber diesen resignierten Blick hatte sie noch nie an ihm gesehen. Schließlich stieß Emma hervor: »Du darfst die Hoffnung nicht verlieren! Vielleicht finden wir einen Ausweg. Du hast mir schon oft von Fußballspielen erzählt, bei denen deine Mannschaft im Rückstand war. Am Ende habt ihr durch euren Willen den Kampf gewonnen. Ihr habt einfach nicht aufgegeben. Beim Karate war das auch schon oft so!«
Aufgebracht rief Ben: »Aber ein Fußballspiel ist doch etwas ganz anderes! Ich habe riesige Angst! Ich kann nicht mehr richtig denken, mein Kopf ist wie blockiert. Mein ganzes Leben verändert sich, wenn ich nichts mehr sehen kann. Nichts ist dann mehr so wie jetzt! Alles, was mir Spaß macht, werde ich nicht mehr tun können.« Er spürte die Furcht im Herzen wie eine finstere, bedrohliche Masse, die ihn ausfüllte, größer wurde und seiner bemächtigte.
»Es muss einen Weg geben, dass es nicht so weit kommt. Außerdem können Ärzte sich auch mal irren. Egal, was passiert, ich helfe dir!«, murmelte Emma trotzig.
Die Schulglocke ertönte, die beiden mussten in ihre Klasse gehen. Doch genau in diesem Moment rannte Paul um die Ecke und stieß fast mit den zwei Freunden zusammen. Er sah, dass Ben weinte. Das war natürlich für ihn eine großartige Gelegenheit zu stänkern: »Ach je, der kleine Benny flennt. Ben ist eine Heulsuse, huhuhu…!«
Mit funkelnden Augen fuhr Emma Paul an: »Du widerlicher Idiot! Verschwinde, du schwabbeliger Fettkloß!«
Dieser schnappte nach Luft. Gegenwehr war er nicht gewohnt, erst recht nicht von einem Mädchen!
Besorgt schaute Emma zu Ben und sah, wie sich sein eben noch kummervolles Gesicht veränderte. Einer der gefürchteten Wutanfälle kündigte sich an. Sie wollte ihn besänftigen, flüsterte deshalb rasch: »Bleib ruhig. Bitte lass dich nicht auf eine Prügelei ein. Du kriegst nachher den Ärger!«
Ben hörte gar nicht hin. Er fühlte, wie diese unerklärliche Hitze in ihm aufstieg. Die Laune war auf den Nullpunkt gesunken. Paul kam ihm gerade recht. Sowohl seine aufgestaute Wut als auch die quälenden Ängste konnte er jetzt an diesem Typen auslassen.
Hilflos spürte Ben, dass ihm immer heißer wurde, im Bauch entwickelte sich das lodernde Feuer. Die Intensität, mit der die Flammen emporschossen, war jedoch neu für ihn. Er kannte zwar den Zorn, den er kaum bändigen konnte, aber diese fast schmerzhafte Hitze, die ihn nun von innen her verglühte, war ihm fremd. Bevor Ben sich noch weiter über seine Gefühle wundern konnte, trat er nach vorn und haute Paul mit zwei blitzschnellen Oi-Zukis um. Das geschah so überraschend, dass er keine Chance zur Gegenwehr hatte.
Emma war entsetzt über diese unkontrollierte Explosion. »Was hast du getan? Mensch, Ben, du kannst ihn doch nicht einfach umhauen!«
Ben dagegen lachte nur zynisch: »Heute musste das einfach sein! Dieser Mistkerl verdient es schon lange. Außerdem weiß ich nicht, wie lange ich mich noch prügeln kann.«
Irgendwie hatte Ben Recht, aber Prügeln war keine Lösung für Probleme, fand Emma. Sie schaute zu Paul, der sich langsam aufsetzte und Ben mit wutverzerrtem Gesicht anbrüllte: »Das wirst du noch bereuen! Das bedeutet Rache! Ich werde allen erzählen, was für eine Heulsuse du bist!«
Mit seinen Faustschlägen war Bens Wut verraucht, das Feuer in ihm erloschen. Dieser Kerl widerte die beiden Freunde einfach nur an. Deshalb kümmerten sie sich nicht länger um ihn, sondern hasteten schnell ins Schulgebäude.
In der ersten Stunde hatten sie Religion bei Herrn Rowan. Die Klasse diskutierte über den Satz von Jesus: Der Glaube versetzt Berge. Bedeutungsvoll schaute Emma zu Ben, denn er brauchte nun den festen Glauben daran, dass es einen Weg gäbe, sein Augenlicht zu erhalten.
Trotzdem hörte Ben nur mit halbem Ohr hin, er dachte immerzu an die drohende Blindheit und den Gefühlsausbruch. Tränen waren für einen Jungen einfach uncool, egal, warum er weinte.
Außerdem: Was bedeutete diese unglaubliche Hitze, dieses lodernde Feuer in ihm? Gemeinsam mit dem Wutausbruch war alles erloschen, zusätzlich fühlte er sich erleichtert.
Endlich klingelte es zur Pause, die Schüler rannten auf den Schulhof. Ben zögerte. Sollte er jetzt tatsächlich mit seinen Freunden Fußball spielen? Eigentlich verspürte er keine Lust dazu. Er befürchtete jedoch, nur zu grübeln, im schlimmsten Fall sogar, erneut zu weinen. Nein, das ging auf gar keinen Fall! Besser wäre es, sich abzulenken, also folgte er den Fußballfreunden nach draußen.
Nach kurzer Zeit war das Spiel in vollem Gange. Ben sprintete mit dem Ball in Richtung Tor. Einer seiner Kumpel spurtete von rechts auf ihn zu, um ihm den Ball abzunehmen, aber Ben konnte an ihm vorbei dribbeln.
Gerade, als er schießen wollte, sprang ihn jemand mit voller Wucht von hinten an. Ben verlor den Halt, taumelte, stürzte zu Boden und prallte hart mit der Stirn auf. Der Angreifer landete auf Ben. Schmerz durchzuckte ihn, er verzog das Gesicht. Eine Platzwunde auf seiner Stirn blutete heftig, während der ganze Körper schmerzte. Das Gewicht des Angreifers raubte ihm den Atem, sodass er gequält japste.
Erneut spürte Ben hemmungslose Wut in sich hochsteigen. Für heute reichte es allerdings mit dem Prügeln und er wäre der Auseinandersetzung gerne aus dem Weg gegangen. Ben drehte den Kopf. Da erkannte er erst, wer ihn gefoult hatte: Paul, der Revanche forderte! Vorhin hatte er Paul mit seinem Überraschungsangriff außer Gefecht gesetzt, jetzt hatte jener ihn überrumpelt. Nun gab es kein Zurück mehr.
In einer denkbar ungünstigen Position lag Ben auf dem Boden. Durch den Kampfsport hatte er gelernt, nicht aufzugeben, sondern nach einem Ausweg zu suchen. Er musste gedanklich stark bleiben!
Abrupt brach das Feuer wieder in ihm aus, aber dieses Mal war es nicht wild lodernd, sondern Kraft spendend. Instinktiv konzentrierte Ben sich, versuchte diese Kraft zu sammeln. Er spannte alle Muskeln an und warf den Kopf mit voller Wucht nach hinten.
Pauls Nase knackte. Vor Schmerz schrie er laut auf und rollte jammernd von Bens Rücken. Unverzüglich rappelte Paul sich hoch, um wie eine Dampfwalze erneut auf Ben loszugehen. Dieser war ebenfalls schon auf den Beinen, trat ein paar Schritte zurück und erwartete seinen Gegner mit angespannten Muskeln. Wie in Zeitlupe erlebte Ben diesen Moment, schaltete dabei alles andere um sich herum aus. Er hörte weder das Geschrei, noch die Anfeuerungsrufe der Schulkameraden, die einen Kreis um die Kämpfenden bildeten.
Paul versuchte, Ben den gesenkten Kopf gegen die Brust zu rammen, während er ihn gleichzeitig mit den Fäusten attackierte. Ben drehte sich seitwärts und machte einen Ausfallschritt nach hinten. Er blockte mit dem linken Arm die Schläge ab, riss zeitgleich den rechten Arm hoch, mit dem er Pauls Kinn erwischte. Der dicke Junge taumelte.
Ein lauter Pfiff zerschnitt die Luft. Der Religionslehrer, der die Pausenaufsicht führte, trat entschlossen zwischen die beiden Kämpfer und brüllte: »Auseinander!«
Sofort herrschte Totenstille. Die im Kreis um die Kämpfer stehenden Mitschüler schauten betroffen zu Boden oder sahen sich verunsichert an, gaben jedoch keinen Mucks von sich. Jammernd hielt Paul den Ärmel seines T-Shirts vor die blutende Nase.
Der erzürnte Lehrer befahl: »Die Schaulustigen können gehen! Ihr beiden Wahnsinnigen kommt mit mir!« Herr Rowan reichte den beiden jeweils ein Taschentuch und schritt zügig voraus. Die Raufbolde folgten ihm betreten in einen leeren Klassenraum.
Streng baute der Lehrer sich vor den Jungen auf. »Was habt ihr euch dabei gedacht? Wofür soll Prügeln eine Lösung sein? Es gibt zwei Möglichkeiten: Entweder melde ich das dem Direktor und euren Eltern, dann werdet ihr für den Mist hier abgemahnt! Oder ihr helft mir nach den Ferien beide im Altersheim.« Er machte eine kleine Pause, um die Antwort abzuwarten.
Betreten schaute Ben auf seine Schuhe.
Paul blaffte frech: »Mich schmeißt sowieso keiner von der Schule. Ihr braucht doch für den Pausenhof diese neue Kletterwand – mein Vater könnte …«
Ein herablassender Blick von Herrn Rowan ließ ihn abrupt verstummen: »Wenn du dich da mal nicht irrst, Paul! Du hast mit der Prügelei angefangen und das auf ganz hinterlistige, feige Art! Nun?«
Ben räusperte sich, murmelte schließlich verlegen: »Gut, ich komme mit Ihnen.«
»Paul?«, fragte Herr Rowan mit einem scharfen Unterton.
Der Junge zögerte, es ging ihm sehr gegen den Strich, klein beizugeben. Schließlich nuschelte er kaum hörbar: »Ich auch.« Dabei warf er dem Lehrer einen trotzigen Blick zu.
»Gut. Dann ist es also abgemacht. Ihr geht jetzt ins Sekretariat, um euch verarzten zu lassen. In Zukunft will ich keine Handgreiflichkeiten mehr! Klar?«
Beide nickten und trollten sich in Richtung Sekretariat.
*
Die restlichen Schulstunden zogen sich in die Länge wie ein ausgekautes Kaugummi, waren dabei genauso fade im Geschmack. Quälende Gedanken rumorten in den Köpfen von Ben und Emma. Deshalb waren die zwei froh, als die Schule endlich aus war, sodass sie nach Hause gehen konnten in der Hoffnung, den düsteren Gedanken zu entfliehen.
Nach dem Mittagessen verkroch Emma sich in die Stille ihres Zimmers. Sie benötigte Ruhe, um die Gedanken zu ordnen. Auf dem Bett liegend bemühte Emma sich, ebenso tief wie ruhig zu atmen, dadurch entspannte sie langsam. Die Stille umhüllte sie, nach und nach verstummten ihre zermürbenden Gedanken.
Schließlich griff sie nach dem Foto ihres verstorbenen Opas Karl, um es lange zu betrachten. Immer wenn sie Kummer hatte oder eine Lösung für ein Problem suchte, machte sie das so. Ganz intensiv dachte sie dann an ihn, fühlte, dass er bei ihr war und sie tröstete. Emma empfand tiefe Liebe für den Opa. Sie hatten viel Zeit miteinander verbracht, zusammen gelacht, gespielt, gemalt oder für die Schule geübt. Beim Tennisspielen, Fahrradfahren und Schwimmen war er ihr Lehrer gewesen. Emma schaute sich im Zimmer um, an den hellblauen Wänden hingen mehrere Fotos von ihm. Opa Karl konnte fantastisch zeichnen und fotografieren. Als Emma noch klein war, hatte er auf ihren Wunsch hin eine Wand des Zimmers mit einer kleinen Nixe und einem Delfin bemalt. Für die kindlichen Wandmalereien schien Emma eigentlich zu alt, aber liebte diese so sehr, dass sie die Bilder nicht überstreichen lassen mochte.
Wenn ihr Opa jetzt noch lebte, könnte sie ihm von Ben erzählen und um Rat fragen. Manchmal lief im Leben alles verkehrt: Opa Karl war tot, der Vater weg, Ben würde sein Augenlicht verlieren, doch sie konnte nichts daran ändern. Hilflosigkeit sowie Trauer überrollten Emma. Von dort war es nicht mehr weit bis zu dem stechenden Herzschmerz, der sie jedes Mal durchdrang, wenn sie daran dachte, dass ihr Opa gestorben war.
Mit dem Tod verband sie seither nichts Friedliches mehr, sondern er bedeutete nichts anderes als Verlust für immer. Emma konnte in der Erlösung, die in manchem Sterben lag, keinen Trost finden. Denn die Erlösung betraf nur den, der ging, nicht den, der zurückblieb.
Die Zimmertür wurde einen Spalt breit geöffnet, ihre Mutter fragte vorsichtig: »Darf ich zu dir kommen? Du warst so bedrückt beim Mittagessen. Möchtest du mir erzählen, was los ist?«
Emma nickte. Es kam selten vor, dass die Mutter Zeit für sie hatte. Aber trotz der vielen Arbeit und des Kummers, der auf Marlene lastete, spürte diese fast immer, wenn es ihrer Ältesten nicht gut ging. Leider forderten die Geschwister ständig die Aufmerksamkeit der Mutter, dadurch überfiel Emma oft das Gefühl, zu kurz zu kommen.
Doch nun setzte Marlene sich zur Tochter aufs Bett und nahm deren Hand. »Was bedrückt dich, meine Große?«
Emma seufzte: »Ach, Mama, ich bin schlecht drauf, ich fühle mich so hilflos …« Sie schluchzte, während Tränen an den Wangen hinabliefen. Schließlich erzählte sie der Mutter von Bens Augenkrankheit.
Schockiert nahm Marlene ihre Tochter in die Arme, hielt sie ganz fest, um Trost zu spenden. Emma verspürte Erleichterung, dass sie die Sorgen mit jemandem teilen konnte. Sie redeten eine Weile über Ben. Marlene machte den Vorschlag, sich im Internet über dessen Krankheit zu informieren. Die Idee gefiel Emma und sie nahm sich vor, später zu recherchieren. Außerdem wollte sie wegen Bens Krankheit ihre Tante Esther befragen, die im Dorf als Heilerin bekannt war. Allerdings heilte diese auf eine ganz spezielle Art.
Zuletzt teilte die Mutter der Tochter noch eine kleine Überraschung mit: »Dein Vater hat mir diesen Monat etwas mehr Geld überwiesen. Du kannst dir endlich die Sporttasche kaufen, die du so dringend brauchst. Das ist doch schön, oder?«
»Was ist denn daran schön? Der Blödmann denkt, er könnte sich von seinem schlechten Gewissen freikaufen!«
»Ach, Emma, sieh doch nicht alles nur negativ, freu dich einfach über deine neue Tasche!«
»Nein!« Emmas Gesicht verschloss sich vollkommen, sodass es wie eine Maske wirkte.
Obwohl Marlene ihrer Tochter eine Freude machen wollte, war das gründlich misslungen. Traurig verließ die Mutter das Zimmer, denn sie wusste genau, dass jetzt kein vernünftiges Gespräch mehr möglich war. An der Tür blieb Marlene zögernd stehen und wandte sich um: »Manche Dinge müssen wir Menschen annehmen, so wie sie sind. Wir können nicht alles ändern, weil es uns dann besser passt.« Nach diesen Worten schloss sie die Tür.
Die Worte prallten an Emma ab. Stattdessen kochte wieder der Zorn auf ihren Vater hoch wie ein Topf heißer Milch, der überläuft. Mit dem Unterschied, dass man Milch einfach wegwischen konnte, Wut jedoch nicht. Diese Stinkwut schmeckte bitter wie Artischockensaft und lag klebrig auf der Zunge. Leider kannte Emma kein Mittel, das diesen unangenehmen Geschmack wegspülen konnte.
Vielleicht würde sie sich von dem Geld die neuen Ballettschuhe kaufen, statt einer Sporttasche. Emma kämpfte mit sich, sie brauchte das Geld, aber wollte es vom Vater nicht annehmen. »Mist! Das Leben ist manchmal so schwierig!«
Zur Ablenkung griff sie nach ihrem Notebook, um im Internet zu recherchieren, fand aber nichts wirklich Hilfreiches für Ben. Am liebsten hätte sie wütend auf die Tastatur eingeschlagen. »Verdammt!«, fluchte Emma enttäuscht.
Betrübt rief sie Ben an und fragte, ob sie sich auf der großen Wiese treffen sollten. Emma selbst brauchte ihren Freund und wollte auch ihn mit seinem Kummer nicht allein lassen. Die beiden verabredeten sich für später.
Als Lara bei Emma hereinschaute, hörte sie noch das Ende des Telefonats. Sie bettelte darum, mitkommen zu dürfen, und Ben sollte seinen kleinen Bruder Mattes mitbringen: »Bitte, nehmt uns mit zur großen Wiese! Bitte! Wir werden euch ganz bestimmt nicht nerven. Ich möchte meinen Freund auch sehen, so, wie du Ben!«
Die große Wiese bekam nie einen Rasenmäher zu Gesicht und lag am Rande des Wohngebietes, in dem Ben und Emma wohnten. Sie war Spielparadies, gleichzeitig auch Treffpunkt der Kinder und Teenager aus dem Dorf. Mitten durch diese Wildnis schlängelte sich ein kleiner Bach, der im Sommer die kleinen Kinder lockte. Den ganzen Tag waren sie damit beschäftigt, Flöße aus Ästen zu basteln, Staudämme zu bauen oder Frösche zu fangen. Sie tauchten in ihre eigene Welt ab, während die älteren Fußball oder Volleyball spielten.
Der hintere Teil der Wiese endete in einem ausgedehnten Wald, wo große Bäume zum Klettern einluden. Dort hatten die Kinder einige Weidentunnel gepflanzt und wackelige Baumhäuser aus einfachen Brettern zusammengebaut, die seltsamerweise jedem Sturm trotzten.
Diese Wiese war für Mattes, ebenso für Lara der schönste Spielplatz der Welt. Aber Emma lehnte ab, sie wollte mit Ben allein sein. Auf die jüngeren Geschwister hatte sie gerade überhaupt keine Lust. Lara verspürte Enttäuschung und Wut, dass Emma sie nicht mitnehmen wollte.
*
Nach dem Telefonat ging Ben langsam zurück in sein Zimmer. Der sechsjährige Bruder Mathias, kurz Mattes genannt, saß dort verzweifelt auf dem Boden. Gerade war ihm ein Van aus Legosteinen aus der Hand gerutscht, der dadurch in sämtliche Einzelteile zersprang. Vor Jahren hatte Ben mit seinem Vater tagelang an diesem Van gebaut. Jetzt war Ben außer sich und schimpfte über Mattes. Die beiden schrien sich an, bis Ben den Bruder aus dem Zimmer schleifte. Mattes schaffte es immer wieder, ihn rasend zu machen.
»Du hast ab jetzt Zimmerverbot, du Blödmann! Immer machst du mir alles kaputt, du Baby! Ich wünschte, ich hätte einen anderen Bruder!«, stieß Ben hervor.
Entsetzt schaute Mattes ihn an, begann zu weinen und jammerte immer wieder: »Entschuldigung! Ich wollte das nicht! Ich helfe dir wieder aufbauen, ja? Entschuldigung! Ich habe das unextra gemacht, ich wollte doch nur damit spielen.«
»Das heißt nicht unextra, du Doofkopp! Außerdem ist der Van nicht zum Spielen, sondern nur zum Anschauen und Sammeln!« Ben blieb unerbittlich, er platzte fast vor Wut, knallte seine Zimmertür hinter sich zu und schloss von innen ab.
»Du bist nicht mehr mein Freund, ich rede nie mehr mit dir, und du kriegst auch keinen Kuss mehr von mir!«, rief Mattes ihm heulend hinterher.
Ben versuchte, das Gejammer zu überhören, seufzte und sah sich in seinem Zimmer um, das gerade ziemlich unordentlich aussah. Überall lagen Klamotten herum, Schulhefte bedeckten den Boden. Fußballposter lagen auf einer Fahne seines Lieblingsvereins und unter dem Bett lugte ein Experimentierkasten hervor. Die Eltern bekamen jedes Mal Angst, er würde das Haus in die Luft sprengen, wenn er damit Versuche startete. Feuer übte eine unglaubliche Anziehungskraft auf Ben aus. Schon als kleiner Junge war es für ihn das Größte gewesen, wenn er ein Streichholz anzünden durfte.
Unbeherrscht trat Ben gegen einen Stapel Bücher, was das Durcheinander noch vergrößerte. Ein paar Mal boxte er gegen einen Punchingball und stöhnte. Seine Gedanken kreisten unaufhörlich um das eine unerträgliche Thema: Er würde erblinden!
Deprimiert murmelte Ben: »Erst Chaos beseitigen, dann Emma treffen.«
Er presste die Lippen aufeinander und begann, Ordnung zu schaffen. Wobei er sich die Frage stellte, was der ganze Blödsinn sollte, da er selbst das Chaos sowieso bald nicht mehr sehen konnte.
Dummerweise musste er gerade heute das Zimmer besonders gründlich aufräumen. Seine Mutter war ziemlich sauer auf ihn wegen der Prügelei mit Paul. Da Ben mit blutverschmiertem T-Shirt, zerrissenen Jeans und Stirnwunde nach Hause kam, reagierte seine Mutter erst entsetzt und voller Mitleid. Dann allerdings, als er ihr die ganze Geschichte erzählte, schmolz das Verständnis sehr zusammen. Nur die Sorge um seine Augen stimmte sie schließlich milde.
Seine Mutter – auch so ein schwieriges Thema für ihn. Irgendwie empfand er ihr Verhältnis zueinander in der letzten Zeit noch angespannter als sonst. Vielleicht lag es daran, dass sie oft müde und gestresst nach Hause kam. Nora arbeitete als Ärztin in der psychiatrischen Abteilung eines großen Krankenhauses. Häufig übernahm sie Nachtschichten, um tagsüber für ihre beiden Jungen da sein zu können. Meistens war sie dann allerdings gereizt oder so übermüdet, dass sie einfach einschlief, egal wo sie saß.
Nora war eine hervorragende Ärztin, die den Beruf über alles liebte, im Haushalt dagegen blieb sie eine absolute Katastrophe. Wenn sie kochte, verbrannte das Essen oder schmeckte versalzen. Glücklicherweise konnte Bens Vater Tim gut kochen, und selbst Ben brachte inzwischen ganz passable Mahlzeiten zustande. Außerdem hatten sie endlich eine Haushaltshilfe eingestellt, die die Familie tatkräftig unterstützte. Seither klappte es besser.
Leider konnte Nora selten abschalten, sie dachte oft zu Hause noch über Patienten nach, wenn ein Problem sie nicht los ließ. Manchmal erzählte sie sogar von besonders schrägen Patienten. Einmal entschlüpfte ihr der Name eines Patienten: Henk van Vaal. Dieser erzählte immer wieder dieselbe abgedrehte Geschichte von einem schaurigen, düsteren Schloss, geflügelten schwarzen Panthern und einer schönen, aber bösartigen Hexe. Diese hatte ihn gefangen und gequält, doch dann gelang es ihm zu fliehen, indem er durch einen Zauberspiegel sprang. Seine Erzählung klang genauso unheimlich wie Emmas Albträume.
Henk beschrieb diese Hexe bis ins kleinste Detail, dabei jedes Mal absolut identisch. Als ob es sie wirklich gäbe und sie nicht nur als Wahnvorstellung durch seinen Kopf geisterte. Bens Mutter war manchmal so irritiert, dass sie ihrer Familie gestand: »Wenn ich kein realistisch veranlagter Mensch wäre, würde ich Henk van Vaal glauben. Ich habe seine Geschichten schon so oft gehört, dass ich diese schwarzhaarige Hexe schon fast vor mir sehe, wie sie sich niederbeugt, um ihm das Blut auszusaugen.«
Den Beruf der Mutter fand Ben bedrückend, für ihn war das eine fremde Welt, in der sie sich da bewegte. Einmal hatte er sie besucht, das reichte ihm. Er dachte, dass all diese Gestörten einen irgendwann dazu brachten, selbst wahnsinnig zu werden. Deren unkontrollierte Wutausbrüche und hysterische Schreie verfolgten ihn noch tagelang.
Wie dem auch sei, er musste jetzt endlich mit seinem Zimmer fertig werden, sonst käme er noch zu spät zum Treffen mit Emma. Er murmelte: »Geniale Menschen sind selten ordentlich, Ordentliche selten genial*.«
*
Der Himmel in Fanrea verfärbte sich lilaorange, tauchte die Welt in ein diffuses Licht. Die wenigen Wolken wirkten wie zerfranste, rot glühende Wattebäusche, die der Wind vor sich hertrieb. Krächzend suchte ein Schwarm Krähen das Nachtlager in gigantischen Mammutbäumen.
Der Abend brachte eine kühle Brise mit, die durch Äste strich und mit Blättern spielte. Nahezu lautlos segelte ein Käuzchen über die Wipfel hinweg, in den Fängen eine leblose Maus.
Der Lakota John und sein bester Freund, der Katzenjunge Nijano, wanderten leichtfüßig durch den Wald. Die beiden besaßen in etwa die gleiche Größe, doch nachtschwarze Haare bedeckten fast den gesamten Körper Nijanos, dessen Gesicht dem einer Katze glich. Mit den geschmeidigen Bewegungen eines Panthers schlich er zwischen den Bäumen hindurch. Bei Bedarf konnte er scharfe Krallen aus seinen behaarten Fingern ausfahren, mit denen er mühelos töten konnte.
John schulterte ein mittelgroßes Wildschwein, während Nijano einen Korb mit Mangos trug. Sie brachten das Abendessen ins Lager der gestrandeten Kinder, ihrem Zuhause. Das Wildschwein würden sie später über dem offenen Feuer grillen, dazu gäbe es jede Menge Gemüse und als Nachtisch reife, saftige Mangos.
Die letzten Sonnenstrahlen verfingen sich im Fell des Katzenjungen und ließen es seidig schimmern. Insekten tanzten im Licht der untergehenden Sonne, während der sanfte Wind die Jungen umschmeichelte.
Unerwartet blieb Nijano stehen, seine Ohren zuckten wachsam hin und her. »Da kommt jemand!« Witternd hob er die Nase, zog dabei leise das Schwert aus der Scheide.
Auch John zückte seine Waffe, lauschte angespannt. Jetzt hörte er ebenfalls ein Geräusch. Ein Brummen klang durch die Bäume, kurz darauf ein Kichern.
Nijano steckte das Schwert zurück. »Entwarnung! Das hört sich nach einer albernen, kichernden Blumenelfe an.«
Das Brummen kam näher. Schließlich schwebte ein schwarzer, ponygroßer Käfer zwischen den Bäumen hindurch. Als er die beiden Jungen erblickte, verlangsamte er den Flug. »Seid gegrüßt, ihr fleißeifrigen Fanreaner! Wie ich sehe, hattet ihr beiden eine erfolglückliche Wildschweinjagd.« Er setzte zur Landung an.
»Hallo Bruno!«, begrüßte John ihn grinsend.
Eine Blumenelfe auf Brunos Rücken schimpfte: »Und ich? Wer sagt zu mir Hallo?«
»Oh, verehrte Lavanda, sei gegrüßt!« Nijano verbeugte sich formvollendet. »Auf dem dicken Käferkerl hab ich dich wunderschönes Wesen übersehen!«
Gutmütig lachte Bruno. »Je dickrunder ein Käfer, umso bessergut es ist! So heißtsagen wir in unserer Familie immerständig!« Kaum hatte er diese Worte ausgesprochen, entdeckte er den prall gefüllten Korb mit Mangos. Dem Käfer lief das Wasser im Munde zusammen, und er begann geräuschvoll zu schmatzen.
Die kleine Elfe strich ihr lilafarbenes Blütenkleid glatt, runzelte dabei ungehalten die Stirn. »Bruno, schmatz doch nicht so laut!«
John hatte eine Idee. Er legte das Wildschwein nieder, griff eine Mango aus Nijanos Korb und warf diese dem Käfer zu, der sie unerwartet wendig mit dem Maul auffing. Sabbernd schluckte er sie hinunter. Danach schüttelte er sich, sodass jede Menge Speichelfäden durch die Luft flogen. Die Jungen wichen geschickt aus, doch ein Sabberfetzen landete auf Lavandas Haaren.
»Bäh! Ist ja ekelhaft! Bruno, du ungehobelter Klotz!« Sie wischte den Glibber aus ihrem Haar.
»Oh, entschukkeling! Das war keine Planabsicht!« Er schämte sich. Unglücklich versuchte er mit einem Vorderbein sein Maul zu säubern.
John grinste, während er mit dem Dolch eine weitere Frucht schälte. Der Saft der reifen Mango tropfte von seinen Fingern.
Nijano pflückte von einem Baum ein Blatt, auf dem John einige winzige Mangostücke platzierte, die er Lavanda reichte.
»Oh, danke!« Ihre Augen leuchteten, als sie das Blatt entgegennahm. Die Blumenelfe nahm ein Stückchen der Frucht in den Mund, während sie genießerisch die Augen schloss.
John sah Brunos sehnsüchtigen Blick und steckte ihm die restliche Mango ins Maul.
»Mmhh. Schmeckt leckergut!«
Nijano fragte neugierig: »Wohin fliegt ihr?«
»Bruno ist so nett und bringt mich zu einem Fest der Schmetterlinge.« Lavanda klimperte aufgeregt mit den Augen.
»Na, dann! Viel Spaß!«, wünschte der Katzenjunge.
»Auf Wiedertschüß!« Der Käfer klappte die Flügel auf.
John nickte den beiden lächelnd zu, während Bruno abhob und mit der winkenden Elfe davonflog.
Die beiden Jungen schulterten erneut ihre Beute. Mittlerweile war es dämmrig. Die Schatten wurden länger und hüllten den Wald ein. Das Heulen eines Wolfes klang sehnsüchtig aus weiter Ferne, nach einer Weile stimmte das Rudel in den Gesang ein.
»Ab, nach Hause!«, befahl Nijano. »In der Nacht ist es sicherer im Lager.«