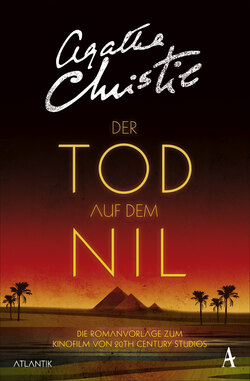Читать книгу Der Tod auf dem Nil - Agatha Christie - Страница 18
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Viertes Kapitel
Оглавление»Monsieur Poirot.«
Poirot sprang eilig auf. Er war allein auf der Terrasse sitzen geblieben, nachdem alle anderen Gäste hineingegangen waren, und hatte in Gedanken versunken auf die schimmernden schwarzen Felsen gestarrt, als der Klang seines Namens ihn wieder zurückholte.
Die Stimme ließ auf Kultiviertheit und Selbstbewusstsein schließen, eine charmante Stimme, eine Spur arrogant vielleicht.
Gleich darauf sah er Linnet Doyle in die Augen. Ihr Blick war zwingend, sie trug einen schweren roten Samtumhang über dem weißen Satinkleid, und sie war noch schöner und majestätischer, als Poirot für möglich gehalten hätte.
»Sie sind doch Monsieur Hercule Poirot?« Es war nicht unbedingt eine Frage.
»Zu Ihren Diensten, Madame.«
»Sie wissen vielleicht, wer ich bin?«
»Ja, Madame. Ich habe von Ihnen gehört. Ich weiß genau, wer Sie sind.«
Linnet nickte. Sie hatte es erwartet. Sie fuhr in ihrer charmanten, selbstbewussten Art fort: »Würden Sie mir ins Spielzimmer folgen, Monsieur Poirot? Ich muss dringend mit Ihnen sprechen.«
»Aber sicher, Madame.«
Sie lief voran, zurück ins Hotelgebäude. Er folgte. Sie ging in das leere Spielzimmer und bedeutete ihm, die Tür hinter sich zu schließen. Dann sank sie auf einen Stuhl an einem der Spieltische, und er nahm ihr gegenüber Platz.
Ohne Umschweife kam sie zur Sache. Sie sprach flüssig und ohne zu zögern. »Ich habe sehr viel über Sie gehört, Monsieur Poirot, ich weiß auch, dass Sie ein kluger Mann sind. Und zufällig brauche ich dringend jemanden, der mir hilft – ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass Sie dieser Jemand sind.«
Poirot neigte den Kopf. »Sie sind sehr liebenswürdig, Madame, aber sehen Sie, ich bin in den Ferien, und wenn ich in den Ferien bin, nehme ich keine Fälle an.«
»Das ließe sich sicher regeln.« Es sollte kein Affront sein – es war einfach der Hochmut einer jungen Frau, die noch immer alles zu ihrer Zufriedenheit zu regeln verstanden hatte. Im selben Ton fuhr Linnet Doyle fort: »Ich, Monsieur Poirot, bin Opfer einer unzumutbaren Schikane. Und das muss ein Ende haben! Ich wollte mich damit eigentlich an die Polizei wenden, aber mein – mein Mann findet, dass die Polizei in dieser Angelegenheit machtlos ist.«
»Wenn Sie das vielleicht ein wenig näher erklären möchten«, murmelte Poirot höflich.
»O ja, sehr gern. Die Sache ist sehr einfach.«
Noch immer stockte oder stammelte Linnet Doyle nicht, sondern sprach im Tonfall des kühlen, klaren Geschäftssinns. Sie brauchte nur eine kurze Pause, um sich zu sammeln und die Fakten möglichst bündig darzustellen.
»Bevor ich meinen Mann kennenlernte, war er verlobt mit einer Miss de Bellefort. Sie war auch eine Freundin von mir gewesen. Mein Mann hat die Verlobung gelöst, die beiden passten überhaupt nicht zusammen. Sie hat das – tut mir leid, wenn ich das so sagen muss – sehr schwergenommen. Aber es gibt leider Dinge, die sich nicht ändern lassen. Sie hat danach gewisse – nun ja, Drohungen ausgesprochen, um die ich mich jedoch wenig gekümmert habe und die sie, das möchte ich hinzufügen, auch nicht in die Tat umzusetzen versucht hat. Stattdessen hat sie sich offenbar darauf verlegt, uns – einfach überallhin nachzufahren.«
Poirot zog die Augenbrauen hoch. »Ah – eine recht – äh, ungewöhnliche Rache.«
»Sehr ungewöhnlich – und sehr albern! Aber eben auch – lästig.« Sie biss sich auf die Lippe.
Poirot nickte. »Ja, das kann ich mir vorstellen. Sie sind, wenn ich das richtig sehe, auf Hochzeitsreise?«
»Ja. Und zum ersten Mal passierte es in Venedig. Sie war auch da – im Hotel Danieli. Ich hielt es zuerst für Zufall. Ziemlich peinlich, aber mehr auch nicht. Aber dann haben wir sie in Brindisi auf dem Schiff entdeckt. Und es sah ganz so aus, als ob sie auch nach Palästina fahren wollte. Deshalb haben wir sie, so dachten wir jedenfalls, an Bord zurückgelassen und sind anders weitergefahren. Aber kaum kamen wir ins Mena House hier in Ägypten, da – da saß sie schon da und – wartete auf uns.«
Poirot nickte. »Und dann?«
»Wir haben den Dampfer nilaufwärts genommen. Ich – ich war fast sicher, dass wir sie an Bord auch wieder sehen würden. Als sie da doch nicht war, dachte ich, sie hat ihr – ihr kindisches Benehmen vielleicht aufgegeben. Aber kaum kamen wir hier an, da – da – saß sie wieder da und wartete auf uns.«
Poirot musterte sie eine Weile eindringlich. Sie wahrte noch immer die Contenance, aber die Knöchel der Hand, mit der sie sich an der Tischplatte festklammerte, waren weiß vor Anspannung.
»Und jetzt fürchten Sie, das geht immer so weiter?«, fragte er.
»Ja.« Sie hielt inne. »Natürlich ist die ganze Sache idiotisch! Jacqueline macht sich doch höchst lächerlich! Ich muss mich sehr wundern, dass sie nicht mehr Stolz hat – mehr Würde.«
Poirot winkte ab. »Es gibt Zeiten, Madame, da gehen Stolz und Würde – über Bord! Da herrschen andere, stärkere Gefühle vor.«
»Ja, schon möglich.« Linnet klang ungeduldig. »Aber um Himmels willen, was für einen Gewinn verspricht sie sich denn von alldem?«
»Es geht nicht immer um Gewinne, Madame.«
Etwas an Poirots Ton war Linnet unangenehm. Sie wurde rot und sagte hastig: »Sie haben recht. Es geht nicht darum, ihre möglichen Motive zu erörtern. Der springende Punkt ist einfach, dass dies alles endlich ein Ende haben muss.«
»Und was schlagen Sie zu diesem Zweck vor, Madame?«, fragte Poirot.
»Nun ja – es versteht sich ja wohl von selbst, dass – mein Mann und ich nicht länger Zielscheibe derartiger Belästigungen sein dürfen. Es muss doch für derlei irgendeine rechtliche Handhabe geben.« Sie klang wieder unduldsam.
Poirot sah sie nachdenklich an. »Hat sie Sie in der Öffentlichkeit verbal bedroht? Beleidigt? Körperliche Angriffe versucht?«
»Nein.«
»Dann, Madame, sehe ich offen gestanden nicht, was Sie dagegen tun könnten. Wenn eine junge Dame Gefallen daran findet, bestimmte Orte zu besuchen, und diese Orte sind zufällig die, an denen Sie und Ihr Mann sich aufhalten – eh bien – was soll’s? Die Luft ist für alle da! Sie dringt ja nicht in Ihre Privatsphäre ein, oder? Diese Begegnungen passieren doch immer in aller Öffentlichkeit?«
»Sie meinen, ich kann gar nichts dagegen tun?« Linnet schien es nicht fassen zu können.
»Überhaupt nichts, soweit ich es sehe«, bestätigte Poirot ruhig. »Mademoiselle de Bellefort hat das Recht auf ihrer Seite.«
»Aber – aber es macht einen wahnsinnig! Es ist doch eine Zumutung, dass man mich mit so etwas behelligen darf!«
Trocken gab Poirot zurück: »Mein Mitgefühl, Madame – zumal ich mir vorstellen kann, dass Sie nicht sehr oft behelligt werden mit solchen Zumutungen.«
Linnet runzelte die Stirn. »Es muss doch irgendwie möglich sein, das zu beenden«, murmelte sie.
Poirot zuckte die Schultern. »Sie können jederzeit abreisen – woandershin fahren«, schlug er vor.
»Dann kommt sie hinterher!«
»Sehr wahrscheinlich – ja.«
»Das ist doch absurd!«
»Ganz recht.«
»Und überhaupt, wieso sollte ich – sollten wir denn vor ihr weglaufen? Als ob – als ob –« Sie schwieg.
»Ganz recht, Madame. Als ob –! Darum geht’s, nicht wahr?«
Linnet hob den Kopf und starrte ihn an. »Was meinen Sie?«
Poirot beugte sich vor und fragte in vertraulich-sanftem Ton, aber eindringlich: »Warum macht Ihnen das so zu schaffen, Madame?«
»Warum? Das macht einen doch wahnsinnig! Eine Provokation sondergleichen! Ich habe Ihnen doch erklärt, warum!«
Poirot schüttelte den Kopf. »Nicht unbedingt.«
»Was meinen Sie?«, fragte Linnet noch einmal.
Poirot lehnte sich zurück, verschränkte die Arme und sagte fast gleichgültig, unpersönlich: »Ecoutez, Madame. Ich will Ihnen eine kleine Geschichte erzählen. Eines Abends vor einem oder zwei Monaten sitze ich in London in einem Restaurant. Am Nebentisch zwei Menschen, ein Mann und ein Mädchen. Sie sind ganz offensichtlich sehr glücklich, sehr verliebt. Sie schmieden Pläne für die Zukunft. Nicht, dass ich da etwas belausche, das nicht für mich gedacht ist; den beiden ist einfach egal, wer ihnen zuhört und wer nicht. Der Mann sitzt mit dem Rücken zu mir, also kann ich das Gesicht des Mädchens genau sehen. Ein sehr ausdrucksvolles Gesicht. Sie ist verliebt – mit Herz und Leib und Seele, und sie ist keine von denen, die sich oft und leicht verlieben. Bei ihr geht es deutlich um Leben und Tod. Die beiden sind verlobt und wollen heiraten, so stellt sich heraus, und sie besprechen auch, wo sie ihre Flitterwochen verbringen werden. Sie wollen nach Ägypten.« Er machte eine Pause.
»Und?«, fragte Linnet scharf.
»Das ist, wie gesagt, jetzt ein, zwei Monate her – aber dieses Gesicht werde ich nie vergessen. Ich weiß, ich erkenne es wieder, sobald ich es irgendwo sehe. Genau wie die Stimme des Mannes. Ich nehme an, Madame, Sie können sich denken, wo ich das eine wieder sehe und die andere wieder höre. Hier in Ägypten. Der Mann ist tatsächlich auf Hochzeitsreise – aber auf der Hochzeitsreise mit einer anderen Frau.«
Linnets Antwort war wieder scharf. »Na und? Die Tatsachen hatte ich Ihnen ja genannt.«
»Die Tatsachen, ja.«
»Also – und?«
Bedächtig fuhr Poirot fort: »Das Mädchen in dem Restaurant erzählte auch von einer Freundin – einer Freundin, da war sie ganz sicher, die sie nie im Stich lassen würde. Und diese Freundin waren, glaube ich, Sie, Madame.«
»Ja. Ich sagte bereits, wir waren befreundet.« Linnet wurde rot.
»Und sie hat Ihnen vertraut?«
»Ja.« Sie zögerte einen Augenblick und biss sich ungeduldig auf die Lippe. Als sie merkte, dass Poirot keine Anstalten machte weiterzureden, sagte sie laut und heftig: »Selbstverständlich ist das alles sehr bedauerlich. Aber so etwas kommt eben vor, Monsieur Poirot.«
»Ah ja! Doch, das kommt vor, Madame.« Er hielt inne. »Sie sind Anglikanerin, nehme ich an?«
»Ja.« Linnet sah ihn verdutzt an.
»Dann hat man Ihnen in der Kirche sicher aus der Bibel vorgelesen. Und Sie haben von König David gehört und von dem reichen Mann mit der großen Viehherde und dem armen Mann, der nur ein einziges Jungschaf besaß – und davon, wie der Reiche dem Armen sein einziges Schaf weggenommen hat. Das ist auch etwas, das eben vorkommt, Madame.«
Linnet schoss im Stuhl hoch. Ihre Augen funkelten böse. »Ich weiß schon, worauf Sie hinauswollen, Monsieur Poirot! Sie denken, ich hätte meiner Freundin, um es salopp zu sagen, den Liebhaber gestohlen. Sentimental betrachtet – und so müssen es Menschen Ihrer Generation vermutlich betrachten –, mag das sogar so sein. Aber die wirkliche und schmerzliche Wahrheit ist eine andere. Ich bestreite ja nicht, dass Jackie leidenschaftlich in Simon verliebt war, aber ich glaube, Ihnen ist bisher entgangen, dass er ihr womöglich nicht gleichermaßen zugetan war. Er mochte sie sehr gern, aber er hatte wohl schon, bevor er mich kennenlernte, das Gefühl, dass er sich geirrt hatte. Betrachten Sie das Ganze einmal mit klarem Blick, Monsieur Poirot. Simon merkt, dass er mich liebt und nicht Jackie. Was soll er machen? Den edlen Helden spielen und eine Frau heiraten, die ihm nichts bedeutet – also womöglich drei Leben zerstören? Denn ob er Jackie unter solchen Bedingungen noch glücklich machen kann, ist doch wohl fraglich. Wäre er, als er mich kennenlernte, schon mit ihr verheiratet gewesen, würde ich auch denken, es wäre seine Pflicht gewesen, bei ihr zu bleiben – obwohl ich nicht ganz sicher bin. Wenn einer von beiden unglücklich ist, leidet auch der andere. Aber eine Verlobung ist noch keine feste Bindung. Und wenn sie ein Irrtum war, dann stellt man sich dieser Tatsache doch bestimmt besser, bevor es zu spät ist. Ich gebe zu, es war sehr hart für Jackie, und das tut mir auch sehr leid – aber es ist nun mal so. Es war unausweichlich.«
»Wirklich?«
Sie starrte ihn an. »Was meinen Sie denn damit?«
»Alles sehr nachfühlbar, sehr logisch, was Sie sagen! Aber eins erklärt es nicht.«
»Und was ist das?«
»Ihr eigenes Verhalten, Madame. Wissen Sie, dass Sie verfolgt werden, könnte zweierlei bei Ihnen auslösen. Es könnte Sie entweder ärgern – ja, oder Ihr Mitleid erregen, weil Ihre Freundin so tief verletzt ist, dass sie ihr gesamtes Anstandsgefühl über den Haufen wirft. Aber so reagieren Sie nicht. Sie empfinden diese Nachstellungen als Zumutung – warum eigentlich? Es gibt nur einen möglichen Grund – Sie verspüren ein Gefühl von Schuld.«
Linnet sprang auf. »Was erlauben Sie sich! Wirklich, Monsieur Poirot, das geht zu weit.«
»Ich erlaube es mir eben, Madame! Ich werde auch weiterhin in aller Offenheit mit Ihnen sprechen. Ich behaupte, Sie haben, obwohl Sie sich alle Mühe gegeben haben, das vor sich selbst zu vertuschen, Ihrer Freundin willentlich den Mann weggenommen. Ich behaupte, Sie haben sich augenblicklich von ihm angezogen gefühlt. Ich behaupte, dass es einen Moment des Zögerns gab, in dem Ihnen klar war, dass Sie die Wahl hatten – abzulassen oder weiterzumachen. Und ich behaupte, dass die Entscheidung bei Ihnen lag – nicht bei Monsieur Doyle. Sie sind schön, Madame, Sie sind reich, Sie sind klug und intelligent – und Sie haben Charme. Mit diesem Charme können Sie jemanden für sich einnehmen, Sie können ihn aber auch zügeln. Sie hatten alles, Madame, was das Leben zu bieten hat. Das Leben Ihrer Freundin dagegen hing an einem einzigen Menschen. Das wussten Sie, und trotzdem haben Sie zwar kurz gezögert, aber nicht Ihre Hand zurückgehalten. Sie haben zugefasst und wie der reiche Mann in der Bibel dem armen sein einziges Schaf genommen.«
Eine Zeitlang herrschte Schweigen. Schließlich riss sich Linnet zusammen und sagte kalt: »All das gehört wohl kaum zum Thema!«
»O doch, es gehört zum Thema. Ich erkläre Ihnen gerade, warum die plötzlichen Auftritte von Mademoiselle de Bellefort Sie so aus der Fassung bringen. Das liegt daran, dass Sie innerlich überzeugt sind, sie ist, auch wenn sie sich für eine Frau noch so unwürdig und unpassend benimmt, im Recht.«
»Das stimmt nicht.«
Poirot zuckte die Schultern. »Sie weigern sich, ehrlich zu sich selbst zu sein.«
»Überhaupt nicht.«
Poirot erwiderte mild: »Ich möchte meinen, Madame, dass Sie immer ein glückliches Leben hatten und sich gegenüber anderen immer großzügig und freundlich verhalten haben.«
»Ich habe es jedenfalls versucht.« Erbostheit und Ungeduld verschwanden aus Linnets Gesicht. Sie klang jetzt ganz einfach – fast hilflos.
»Und deshalb bringt das Gefühl, dass Sie jemandem willentlich weh getan haben, Sie so aus der Fassung, und Sie sperren sich so sehr dagegen, es sich einzugestehen. Verzeihen Sie, wenn ich unverschämt geworden bin, aber Psychologie ist immer der wichtigste Tatbestand bei einem Fall.«
Langsam antwortete Linnet: »Selbst wenn man davon ausgeht, dass Sie recht haben – was ich nicht tue, kein Missverständnis, bitte –, was könnte man jetzt noch machen? Man kann die Vergangenheit nicht ändern; man muss doch die Dinge nehmen, wie sie sind.«
Poirot nickte. »Sie haben einen klaren Verstand, Madame. Nein, man kann Vergangenes nicht noch einmal und anders machen. Man muss die Dinge akzeptieren, wie sie sind. Und das, Madame, ist manchmal alles, was man überhaupt tun kann – die Folgen seiner vergangenen Taten auch akzeptieren.«
»Wollen Sie damit sagen«, fragte Linnet ungläubig, »ich kann sonst nichts tun – gar nichts?«
»Sie müssen wohl tapfer sein, Madame; so jedenfalls sieht es für mich aus.«
Zögernd fragte Linnet weiter: »Könnten Sie nicht – mit Jackie – mit Miss de Bellefort reden? Sie zur Vernunft bringen?«
»Doch, das könnte ich. Ich rede mir ihr, wenn Sie das möchten. Aber versprechen Sie sich nicht allzu viel davon. Ich könnte mir vorstellen, dass Mademoiselle de Bellefort so im Banne ihrer fixen Idee ist, dass nichts sie davon abbringen wird.«
»Aber wir müssen doch irgendetwas machen können, um aus dieser Klemme herauszukommen?«
»Sie könnten natürlich nach England zurückkehren, in Ihr eigenes Haus.«
»Selbst wenn, Jackie wäre vermutlich imstande, sich im Ort einzuquartieren, damit ich sie jedes Mal, wenn ich mein Grundstück verlasse, sehen muss.«
»Richtig.«
»Außerdem«, setzte Linnet langsam hinzu, »glaube ich nicht, dass Simon bereit wäre, vor ihr wegzulaufen.«
»Wie steht er denn zu der ganzen Sache?«
»Er ist wütend – einfach wütend.«
Poirot nickte und dachte nach.
»Werden Sie mit ihr reden?«, flehte Linnet ihn an.
»Ja, das werde ich. Aber meiner Meinung nach werde ich damit nichts ausrichten.«
Heftig sagte Linnet: »Jackie ist sehr eigen! Man weiß nie, was sie als Nächstes tut!«
»Sie sprachen vorhin von bestimmten Drohungen, die sie ausgestoßen hat. Würden Sie mir sagen, was für Drohungen das waren?«
Linnet zuckte die Schultern. »Sie hat gedroht, uns – nun ja, uns beide umzubringen. Jackie kann manchmal ziemlich – südländisch sein.«
»Ich verstehe«, sagte Poirot ernst.
Linnet flehte ihn noch einmal an. »Wollen Sie für mich tätig werden?«
»Nein, Madame«, erwiderte er fest. »Ich nehme keinen Auftrag von Ihnen an. Ich will gern, im Interesse der Menschlichkeit, tun, was ich kann. Das schon. Wir haben hier eine sehr schwierige und gefahrvolle Situation. Ich will gern tun, was ich kann, um sie zu klären – aber sehr zuversichtlich, was meine Erfolgschancen betrifft, bin ich nicht.«
Langsam fragte Linnet Doyle noch einmal: »Und für mich tätig werden wollen Sie nicht?«
»Nein, Madame«, sagte Hercule Poirot.