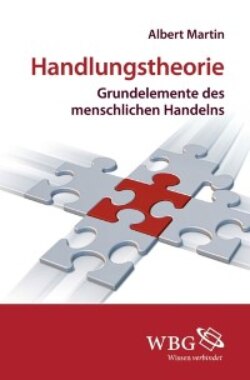Читать книгу Handlungstheorie - Albert Martin - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.1 Mengen
ОглавлениеWas wollen Menschen? Alles – und das sofort? Das sagt man zwar manchmal leichthin, in Wirklichkeit glaubt das aber keiner. Oder doch? Ausgerechnet in der Wissenschaft werden manchmal unbestreitbare Selbstverständlichkeiten wie selbstverständlich ignoriert. So findet man in einführenden Ökonomielehrbüchern nicht selten die Behauptung, die Bedürfnisse des Menschen seien grenzenlos (SLOMAN 1991, S. 3; HELMSTEDTER 1991, S. 3; SAMUELSON/NORDHAUS 2007, S. 21). Schon ein klein wenig Nachdenken zeigt, wie absurd eine solche Aussage ist: Ein in buchstäblich jeder Hinsicht beschränktes Wesen sollte alles wollen können, und selbst wenn es ungeheuer viel wollen kann, will es wirklich alles, was es sich so vorstellen kann? Fast den Charakter eines Glaubensartikels besitzt in den ökonomischen Wissenschaften außerdem die Annahme, der höchste Nutzen eines Gutes liege in dessen unverzüglichem Genuss, ein Aufschub der Möglichkeit, das den Gütererwerb motivierende Bedürfnis zu befriedigen, bedinge und rechtfertige jedenfalls eine Abzinsung des Güterwertes:
„Nur wenige Nutzentheoretiker stellen die Annahme in Frage, dass die Menschen bei der Diskontierung des Nutzens genauso verfahren wie die Banken, nämlich dass sie von dem jeweils bei einer gegebenen Verzögerung bestimmten Nutzen für jede zusätzliche Verzögerungseinheit einen gleichbleibenden Anteil abziehen.“ (AINSLIE 2005, S. 140)
Das ist insofern erstaunlich, als man im alltäglichen Leben eher eine Minderschätzung der Gegenwart beobachtet, kaum jemand verharrt im Augenblick und seinem Behagen, man strebt immer nach Zukünftigem, kaum ist die Zukunft dann zur Gegenwart geronnen, hat man schon die neue Zukunft im Visier. Doch darauf, d.h. auf die zeitliche Dynamik des Wünschens und auf die Begrenztheit des Wollens, werde ich erst weiter unten eingehen, zunächst widme ich mich der Frage, wie sehr wir viele Güter wenigen Gütern vorziehen.