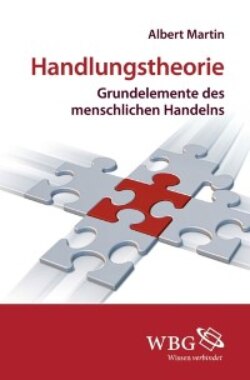Читать книгу Handlungstheorie - Albert Martin - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.2.1 Klarheit
ОглавлениеFür einen Kaufmann ist es eine Schande, wenn er nicht weiß, was seine Güter wert sind und geschäftsschädigend ist es obendrein. Der Schaden entsteht, weil klügere Kaufleute sich die Desorientierung unseres Kaufmanns zu Nutze machen werden. Sie können ihm die Waren, für die er keine rechte Einschätzung hat, zu einem günstigen Preis abkaufen, um sie ihm, zu einem späteren Zeitpunkt (wenn seine schwankende Wertschätzung einen günstigen Wert annimmt) überteuert zurück zu verkaufen. Die Möglichkeit eine entsprechende Geldpumpe anzusetzen, demonstrierten CHU UND CHU (1990) in einem Experiment. Sie nutzten dabei die Neigung von Personen, sogenannte P-Wetten niedriger zu bewerten als sogenannte $-Wetten. Eine P-Wette ist ein Wettangebot mit einer hohen Gewinnwahrscheinlichkeit, wobei allerdings die mögliche Gewinnsumme gering ist. Eine $-Wette dagegen ist ein Wettangebot mit einer geringen Gewinnwahrscheinlichkeit, aber einer hohen Gewinnsumme. Faktisch ist das zu erwartende Ergebnis (Wahrscheinlichkeit mal Gewinnsumme) für beide Wetten gleich. Zahlreiche Studien zeigen, dass Personen diesbezüglich kein „konsistentes Verhalten“ aufweisen. Vor die Wahl gestellt, ziehen sie die P-Wette vor, andererseits sind sie bereit, mehr für den Erwerb der $-Wette als für den Erwerb der P-Wette zu zahlen (CAMERER 1995). Zur Erinnerung: beide Wetten sind identisch, der Erwartungswert, d.h. das Produkt aus Wahrscheinlichkeit mal Gewinnmöglichkeit bleibt gleich, im einen Fall ist eben die Gewinnwahrscheinlichkeit höher, dafür im anderen Fall die Gewinnsumme! Chu und Chu boten ihren Versuchspersonen ein Wettpaar an (also eine $-Wette und eine P-Wette, die materiell identisch waren) und forderten sie auf, die entsprechenden Preise zu nennen, für die sie bereit wären, diese Wetten zu kaufen bzw. zu verkaufen. An die Personen, die das beschriebene inkonsistente Verhalten aufwiesen, verkauften Chu und Chu nun die $-Wette und kauften sie als P-Wetten wieder zurück. Die Versuchspersonen erreichten damit wieder ihren Ausgangszustand ohne Wetten, dafür hatten sie nun weniger Geld, denn der Kaufpreis, den sie für die $-Wette entrichtet hatten, war ja höher als der Verkaufspreis, den sie für die P-Wette veranschlagt hatten. Dazu fällt einem natürlich sofort das Märchen von Hans im Glück ein. Hans tauscht sich gewissermaßen arm, den Goldklumpen, den er für seine treuen Dienste erhalten hat, gegen ein Pferd, das Pferd gegen eine Kuh, die Kuh gegen ein Schwein, das Schwein gegen eine Gans, die Gans gegen einen schadhaften Wetzstein, den er zu guter Letzt in einen Brunnen fallen lässt: „So glücklich wie ich, rief er aus, gibt es keinen Menschen unter der Sonne. Mit leichtem Herzen und frei von aller Last sprang er nun fort …“ Als Moral der Geschichte gilt vielen die Botschaft, dass es auf Gut und Geld doch erst zuallerletzt ankäme, ein unbeschwertes Gemüt sei doch eigentlich unbezahlbar. Ein biederer Kaufmann wird dieses Märchen seinen Kindern aber allenfalls als Narrengeschichte erzählen. Vielleicht enthält sie aber doch die eine oder andere Subtilität. Immerhin macht Hans ja nicht nur sich froh, sondern alle, die mit ihm Handel treiben, ziehen frohgemut von dannen. Nun gut, es ist kein besonders edler Altruismus, Beutelschneider und Schnäppchenjäger zu beglücken, aber man kann darüber lachen.