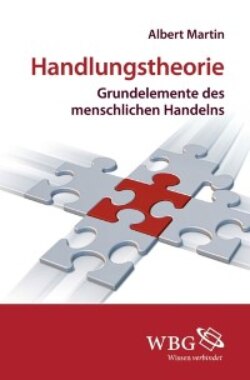Читать книгу Handlungstheorie - Albert Martin - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.1.1 Die Goldene Mitte
ОглавлениеWill man von allem immer mehr? Die Antwort ist auch hier ein klares Nein. Das wiederum haben Ökonomen schon lange erkannt. Der Privatgelehrte Hermann Heinrich Gossen begründete die Zurückhaltung des Menschen gegenüber dem Immer-mehr erstmalig mit Hilfe einer mathematischen Betrachtung. Wir begnügen uns mit seinen verbalen Ausführungen:
„Die Größe eines und desselben Genusses nimmt, wenn wir mit Bereitung des Genusses ununterbrochen fortfahren, fortwährend ab, bis zuletzt Sättigung eintritt.“ (GOSSEN 1854, S. 4f.)
In der modernen Ökonomie findet diese Einsicht etwas abgewandelt als Gesetz des abnehmenden Ertragsnutzens durchaus eine gewisse (wenngleich nicht durchgängig konsequente) Beachtung. Die Grundidee liegt, wie das Zitat belegt, im Konzept der „Sättigung“ begründet. Natürliche Bedürfnisse (essen, trinken, schlafen usw.) melden, wenn sie unbefriedigt sind, „Alarm“. In diesem Zustand gewinnt alles, was die Bedürfnisse befriedigen kann, naturgemäß eine außerordentlich hohe Wertschätzung, je mehr die Bedürfnisse jedoch „gestillt“ werden, desto mehr verlieren die Güter, die ihrer Befriedigung dienen, an Bedeutung und entsprechend an Wertschätzung. Ist die Ziege satt, mag sie kein Blatt, heißt es treffend. Ist man übersatt, dann erzeugt weitere Nahrungszufuhr sogar Widerwillen bis hin zum Ekel, ein Tatbestand, der in seiner Natürlichkeit bei kleinen Kindern noch gut zu beobachten ist.
Das Zusammenspiel von (fehlender) Sättigung und Wertschätzung gilt aber nicht nur für Grundbedürfnisse, sondern auch für die allermeisten anderen Bedürfnisse. Auch der heiß ersehnte Urlaub verliert mit zunehmender Dauer seine Reize, der glühendste Mozart-Verehrer möchte nicht Tag und Nacht Mozart-Arien hören, und – entgegen der Goetheschen Vermutung, dass man sich an der Weisheit am Ende immer mehr gelüsten werde – selbst das Bedürfnis nach immer mehr Erkenntnis nutzt sich ab. Nun ja, es gibt die Gier, z.B. nach Geld, und wie man so sagt, bekommen manche einfach „den Hals nicht voll.“ Dass aber dem Superreichen ein weiterer Euro zu seinem Vermögen ebenso oder sogar noch mehr Freude macht, wie dem Bettelarmen, sollte man denn doch nicht recht glauben. Und Ähnliches gilt wohl auch für das manchmal unersättlich scheinende Streben nach Status, Macht oder Anerkennung sowie für die Lust auf Torten und Diskothekenbesuche oder die Begeisterung für Gartenarbeit. Aber es gibt natürlich Unterschiede in der Lage des Sättigungspunkts und – wie man leider manchmal schmerzlich erfahren muss – auch Extreme. Jeder kennt wahrscheinlich Personen (oder hat zumindest schon von ihnen gehört), die von einem unstillbaren Drang nach Aufmerksamkeit, Geltung und Bewunderung beseelt sind, einem Ordnungswahn aufsitzen oder einer ungebremsten Vergnügungssucht anheimfallen, kein Lob ist dann zu überschwänglich, nichts perfekt genug und keine Lustbarkeit zu ausgefallen: Es ist nie genug. Allerdings ist das dann doch nicht der Normalfall, exzessives Bedürfnisverhalten rutscht leicht ins Pathologische, was man unter anderem daran erkennen kann, dass die Bedürfnisbefriedigung dann keinen reinen Genuss mehr bereitet, sondern nervöse, unstete oder zwanghafte Züge trägt.
Für den Normalfall gilt jedenfalls, dass Immer-mehr irgendwann nicht weiterführt: es macht die Menschen nicht glücklicher ihre Bedürfnisse zweifach oder dreifach zu befriedigen, jenseits eines bestimmten Sättigungspunktes ist dies einfach verlorene Liebesmühe. Diese Aussage lässt sich aber noch schärfer fassen. Es ist nämlich nicht nur so, dass der Grad der Befriedigung an Grenzen stößt, für eine sehr große Zahl von Bedürfnissen gilt darüber hinaus, dass nach dem Sättigungspunkt der Nutzen sogar absinkt. Und um auch diese Aussage noch zu verschärfen, soll behauptet werden, dass viele Bedürfnisse ihre optimale Befriedigung in der goldenen Mitte finden. Hieraus ließe sich dann eine empirische Fundierung des von Aristoteles vertretenen Postulats der goldenen Mitte gewinnen.
„Es ist mithin die Tugend ein Habitus des Wählens, der die nach uns bemessene Mitte hält und durch die Vernunft bestimmt wird und zwar so, wie ein kluger Mann ihn zu bestimmen pflegt. Die Mitte ist die zwischen einem doppelten fehlerhaften Habitus, dem Fehler des Übermaßes und des Mangels; sie ist aber auch noch insofern Mitte, als sie in den Affekten und Handlungen das Mittlere findet und wählt, während die Fehler in dieser Beziehung darin bestehen, dass das rechte Maß nicht erreicht oder überschritten wird.“ (ARISTOTELES, Nikomachische Ethik. Übers. von ROLFES 1995, S. 36)
Nun geht es Aristoteles nicht direkt um die Frage nach der optimalen Bedürfnisbefriedigung, sondern primär um die Ausgewogenheit von Affekten und Handlungen und insbesondere um die Tugend. Nach dem Prinzip der Goldenen Mitte ist beispielsweise Tapferkeit eine Tugend, Feigheit auf der einen, Tollkühnheit auf der anderen extremen Seite dagegen sind verwerfliche Charaktereigenschaften. Tatsächlich eignen sich die Überlegungen des Aristoteles aber wohl besser für unsere Frage nach dem Maß der Befriedigung, die Menschen erreichen können, als für Fragen der Ethik, denn – wie Aristoteles selbst feststellt – gibt es zahlreiche Affekte und Verhaltensweisen, die von sich aus schlecht oder gut sind, für die es also keine rechte Mitte gibt (z.B. Schadenfreude, Neid, Diebstahl, Gerechtigkeit, Mäßigung). Was die Mittel zur Befriedigung von Bedürfnissen angeht, gibt es dagegen ein einfaches quantitatives Merkmal – und damit auch einen sinnvollen Gebrauch des Ausdrucks „Mitte“ – nämlich die Menge des Verbrauchs bzw. des Gebrauchs eines Gutes. Weil aber „die“ Mitte nicht für alle gleich ist (mancher liebt Essen und Trinken, Lesen und Reden usw. eben mehr als andere), ist es präziser, den Begriff der Goldenen Mitte durch den etwas unhandlicheren Begriff der „eingipfeligen Nutzenfunktion“ zu ersetzen. Da es aber im Kern um denselben Gedanken geht (außer dass die Mitte eben individuell verschieden ist), soll der schönere Begriff der Goldenen Mitte beibehalten werden. Danach steigt der Nutzen des Gebrauchs oder Verbrauchs eines Gutes bis zu einem persönlichen Nutzenoptimum kontinuierlich an, um nach Erreichen des Gipfelpunktes wiederum kontinuierlich abzusinken.
Während das Konzept des abnehmenden Grenznutzens lediglich von einer Verlangsamung des Nutzenzuwachses ausgeht (mehr wird immer weniger mehr), wird hier also angenommen, dass sich der Nutzengewinn in einen Nutzenverlust verwandelt (immer mehr wird immer weniger). Sollte sich ein Gut also an einem transitorischen Punkt bzw. in einem transitorischen Moment des Gebrauchs plötzlich in ein Ungut verwandeln? Das ist wenig einleuchtend. Coombs und Avrunin (1977) schlagen eine plausiblere Begründung für den beschriebenen Nutzenverlauf vor. Danach haben viele Güter gleichermaßen sowohl positive wie negative Eigenschaften, die Verlaufsdynamik dieser Eigenschaften ist allerdings unterschiedlich: „Good things satiate, bad things escalate“ (COOMBS/AVRUNIN 1977, S. 224). In Abbildung 2.1 wird dieser Gedanke graphisch dargestellt.
Abb. 2.1: Eingipfelige Präferenzfunktion (nach HASTIE/DAWES 2001, S. 203)
Am Beispiel des Verzehrs von Marzipantörtchen lässt sich dieser Gedanke leicht nachvollziehen. Sofern man überhaupt Marzipan mag, wird man den Verzehr von zwei Marzipantörtchen normalerweise dem Verzehr von nur einem Törtchen vorziehen, drei Törtchen sind besser als zwei usw. Warum? Welche positiven Seiten hat das Verspeisen von Marzipantörtchen? Der Sättigungsaspekt und die Energieversorgung spielen beim Tortenessen normalerweise eine untergeordnete Rolle, im Vordergrund steht vielmehr der Genuss der mehr oder weniger raffinierten Geschmackskomposition. Doch dieser Genuss nutzt sich ab, das achte Stück Torte schmeckt sicher nicht mehr so gut wie das erste. Dazu kommen die negativen Seiten: Die Torte verdirbt den Appetit auf anderes, sie erzeugt, in zunehmenden Mengen genossen, Magendrücken und vor allem liefert sie im Übermaß Kalorien, was in unserer Gesellschaft von den meisten Menschen nicht geschätzt wird. Dass übermäßige Kalorienzufuhr nicht nur eine schlicht steigende, sondern eine überproportional steigende Abneigung erzeugt, kann man daran ermessen, dass die Menschen ein leichtes Übergewicht auch leicht tolerieren – wenn es 10 % beträgt – und damit kaum ein Problem haben, 20 % Übergewicht schon etwas bedenklicher finden und 40 % wohl mehr als doppelt so schlimm wie ein 20 %iges Übergewicht empfinden. Warum dennoch nicht wenige Menschen ein erhebliches Übergewicht mit sich herumschleppen und warum sich mancher trotz der eingebauten Appetitbremse Unmengen an Marzipantorte zuführt, hat in den meisten Fällen nichts mit Wohlgefühl und Behagen zu tun, sondern mehr mit einem aus der Balance geratenen Körpergefühl oder mit Kompensationsverhalten. Ansonsten kann an dieser Stelle aber festgehalten werden, dass der beschriebene Mechanismus „Abbremsen der positiven, Beschleunigen der negativen Aspekte“ bei vielem, was man tut, zum Zuge kommt: beim Autofahren und beim Urlaub machen, beim Halten von Reden und beim Anhören von Reden, beim Kaffee trinken, Bäume fällen, Lob verteilen und Lob empfangen, beim Schlafen, Gehen, Singen, Einkaufen, usw.
Der Verlauf der positiven und negativen Nutzenkurven ist zwar nicht immer gleichermaßen steil oder flach, aber doch meist so, dass ab einem bestimmten Punkt die negativen Aspekte stärker wachsen als die positiven, woraus sich, wie beschrieben, ein eingipfeliger Nutzenverlauf ergibt. Dessen ungeachtet gibt es aber auch gänzlich andere Verläufe, etwa bei Tätigkeiten, bei denen zunächst die negativen Aspekte deutlich überwiegen und erst langsam, dann aber deutlich die positiven Aspekte stark werden. Beispiele hierfür liefern die Aufgaben, zu denen man sich „aufraffen“ muss, die verlangen, dass man aus einer gewissen Lethargie herauskommt (etwas Lernen, etwas Schreiben, sich körperlich ertüchtigen, zum Theaterbesuch aufbrechen usw.) oder dass man bestimmte Verhaltensroutinen verlässt oder generell sein Verhalten ändert (das Rauchen aufgibt, freundlicher zu seinen Mitarbeitern ist usw.).
Es gibt auch „tückische“ Nutzenverläufe. Hierzu zählen vor allem diejenigen, bei denen zwar eine starke negative Komponente gegeben ist, der Nutzenzuwachs durch die gleichzeitig gegebenen positiven Komponenten allerdings ein Überschreiten des Gipfelpunktes vereitelt, was dazu führt, dass man von einem Verhalten nicht ablässt, obwohl es mit einer eindeutigen Selbstschädigung einhergeht. Hierzu zählen Suchtverhalten (z.B. Nikotingenuss) und Leidenschaften (z.B. Sammlerwut, die das Familieneinkommen auffrisst), aber auch harmlosere Angewohnheiten wie langes Aufbleiben, in der Kneipe sitzen oder übertriebener Sport.