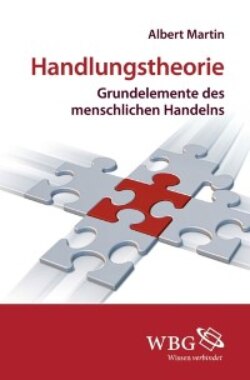Читать книгу Handlungstheorie - Albert Martin - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.1.2 Gewinn und Verlust
ОглавлениеGewinnen ist etwas anderes als Haben – und Verlieren erst recht. Menschen reagieren auf Veränderungen heftiger als auf Beständigkeit und ihr Gram über einen Verlust von, sagen wir zum Beispiel 1.000 Euro, ist größer als ihre Freude über einen Gewinn in dieser Größenordnung. Ausdruck dieser ungleichen Bewertungstendenz ist der sogenannte „Besitztums-Effekt“ (englisch: „Endowment-Effekt“), dessen Wirksamkeit in vielen Untersuchungen bestätigt wurde (KAHNEMAN/KNETSCH/THALER 1991, CAMERER 1995). Verschiedentlich wird der Besitztums-Effekt auch Thaler-Effekt genannt, nach Richard Thaler, der hierzu verschiedene Untersuchungen durchführte. In einem seiner Experimente verschenkte er am Verkaufsstand der Cornell Universität Trinkbecher mit dem Emblem der Universität. Anschließend organisierte er eine Auktion, bei der die Studierenden die Gelegenheit erhielten, ihre Becher zu verkaufen. Auf Seiten der Kaufinteressenten ergab sich ein mittlerer Nachfragepreis von $ 2,75, die Verkäufer (die die Becher ja geschenkt bekommen hatten) verlangten dagegen im Durchschnitt $ 5,25. Die Wertschätzung des Bechers steigt auf wundersame Weise einfach aufgrund des Tatbestandes, dass man ihn besitzt. Auf der Besitzerseite ist man offensichtlich nicht dazu bereit, den Preis zu akzeptieren, den man – als potenzieller Käufer – allenfalls selbst zu zahlen bereit wäre. Man kann, wenn man will, in einem derartigen Verhalten nicht mehr und nicht weniger das Wirken strategischen Kalküls erblicken, schließlich wird man als Verkäufer immer einen höheren Preis fordern, als Käufer immer einen geringeren Preis anvisieren, einfach aus der jeweiligen Interessenlage heraus (als Verkäufer will man einen Gewinn machen, als Käufer will man nicht übervorteilt werden). Der Unterschied zwischen der „willingness to pay“ und der „willingness to accept“ stellt sich damit auf Grund leicht erklärlicher Erwägungen ein. Mit dieser Interpretation wird man dem Phänomen, das sich im Besitztums-Effekt manifestiert, allerdings nicht gerecht. Die vorliegenden Studien zeigen vielmehr, dass für seine Wirksamkeit das Streben nach Gewinnerzielung nicht ausschlaggebend ist, es geht bei diesem Effekt nicht (nur) um Gewinn, im Zweifel verzichtet man nämlich lieber auf ein einträgliches Geschäft als bezüglich seiner Wertschätzung Abstriche zu machen. Nach LOEWENSTEIN/KAHNEMAN (1991) erklärt sich das nicht einfach so, dass die Attraktivität des Besitztums (aufgrund eben des Besitztums) steigt, ausschlaggebend sei vielmehr, dass es Schmerzen bereite, etwas, das man besitzt, wieder herzugeben. Eine andere Erklärung macht geltend, das man Opportunitätskosten leicht übersieht oder zumindest geringer bewertet als auszuzahlende Kosten (out of pocket costs). Schließlich entgehen dem Besitzer, da er sich weigert, von seinen überhöhten Preisvorstellungen abzulassen, Opportunitätskosten in Form des Gewinns, auf den er verzichtet. Die Geringschätzung von Opportunitätskosten findet sogar Eingang in die Rechtsprechung. COHEN/KNETSCH (1992) berichten von einem Fall, in dem ein Lkw-Fahrer einen Unfall verschuldet hat, der zu einem Produktionsausfall geführt hat. Der geschädigte Unternehmer konnte zwar in seiner Schadensersatzklage die gezahlten Löhne geltend machen, nicht aber den entgangenen Gewinn.
In der einen oder anderen Form ist uns allen der Besitztums-Effekt vertraut. Größere Besitztümer wie das eigene Haus oder unser Auto, ganz neutrale Arbeitsgeräte und Arbeitsmittel wie der eigene PC, Bücher, Schreibgeräte, selbst Gegenstände des täglichen Gebrauchs wie Tassen und Bleistifte, gewinnen an Wert, einfach weil wir sie besitzen. Wir würden sie zu den üblichen Marktpreisen keinesfalls oder nur mit Schmerzen hergeben. Aus fungiblen, „vertretbaren“, d.h. eigentlich ununterscheidbaren, austauschbaren Gütern werden nicht-fungible Güter, die ihren ganz persönlichen Wert aus idiosynkratischen Eigenschaften gewinnen, die wir ihnen völlig unbegründet zuschreiben. Etwas anders formuliert: Aus rechtlichem Besitz wächst psychologischer Besitz, die Gegenstände werden zu einem Teil des Besitzers, oder, noch etwas anders und zynischer ausgedrückt: weil wir sind, was wir haben, messen wir unserer Habe einen besonderen Wert zu, und wir geben sie nicht zum üblichen Kurs her.
Besitztums-Effekte finden sich nicht nur im Bereich schnöder materieller Gegenstände, sondern auch in der Sphäre des Mentalen, so zum Beispiel im Wert, den uns unsere Erinnerungen geben (ELSTER 1999, S. 26; TVERSKY/GRIFFIN 1991). Auch dieser Erinnerungswerteffekt ist ein Besitztums-Effekt. Jeder macht in seinem Leben gute und schlechte Erfahrungen, eine gute Erfahrung bewahrt sich in einer guten Erinnerung, die Erinnerung an schlechte Erfahrungen ist eine schlechte Erinnerung. Gute Erfahrungen („a good past“) lassen unsere Gegenwart in einem freundlicheren Licht erscheinen, d.h. eine gute Vergangenheit ist wie ein Besitz, der unsere Existenz wertvoll erscheinen lässt. Das kann wohl jeder bestätigen. Erinnert man sich an gute Zeiten, dann ertragen wir leichter die eine oder andere Mühsal, weil das Licht der (guten) Vergangenheit in unsere Gegenwart herein leuchtet und ihr ein wenig Glanz zu verleihen vermag. Andererseits kennt jeder auch den genau gegenteiligen Effekt. Gute Erfahrungen in der Vergangenheit lassen weniger gute gegenwärtige Erfahrungen als betrüblicher erscheinen als sie ohne diese Erinnerungen erschienen und umgekehrt können wir uns über eine einigermaßen angenehme Gegenwart in besonderem Maße freuen, wenn wir sie mit einer weniger angenehmen Vergangenheit vergleichen. Elster spricht in diesem Fall von der Wirksamkeit des Kontrast-Effekts. Er entsteht dadurch, dass wir die Vergangenheit als Schablone verwenden, um sie mit unserer – damit kontrastierenden – Gegenwart zu konfrontieren. Den offensichtlichen Widerspruch zwischen dem Besitztumseffekt und dem Kontrasteffekt löst Elster im Übrigen nicht auf, er macht derartige Widersprüchlichkeiten vielmehr zu einer Art wissenschaftlichem Programm. Offenbar ist es unsere je subjektive Betrachtungsweise, die unser Urteil bestimmt und zwar nicht nur bei der Bewertung von realen, sondern auch bei der Bewertung von lediglich virtuellen Gewinnen und Verlusten. Angenommen, jemand bemüht sich um zwei von ihm begehrte Objekte (zwei schöne Häuser, zwei attraktive Partner usw.) und es gelingt ihm schließlich, eines dieser Objekte tatsächlich zu gewinnen. Leider ist es das Objekt, das ihm nicht ganz so wertvoll erscheint wie das andere. Wird er sich darüber freuen? Das kommt eben darauf an. Schaut er auf den Unterschied, dann sieht er das, was er nicht bekommen hat, nämlich einen „virtuellen“ Verlust, den er real empfindet. Schaut er auf den Gewinn – schließlich handelt es sich bei dem Erworbenen ja um ein begehrenswertes Objekt – dann wird er sich daran ungeschmälert freuen können.
Die Einsicht, dass Menschen Verlusten ein größeres Gewicht beimessen als betragsmäßig gleichen Gewinnen, ist ein zentraler Bestandteil der „Prospect Theory“ von KAHNEMAN UND TVERSKY (1979; 1992). Sie sehen die Ursache für das Auseinanderfallen der Bewertung von Zugewinn und Verringerung von Gütern in der Verlustangst („loss aversion“). Eine gute Veranschaulichung hierfür liefert das folgende (Gedanken-)Experiment: Angenommen, Sie erhalten $ 1.000 und haben zwei Optionen. Mit Option A erhalten Sie weitere $ 500. Bei Wahl von Option B wird eine Münze geworfen, bei „Kopf“ erhalten Sie zusätzlich $ 1.000, bei „Zahl“ erhalten Sie keine weiteren Dollars. Wählen Sie Option A oder Option B? Angenommen, Sie befinden sich nun in der folgenden Situation: Sie erhalten $ 2.000, verbunden mit der Option A, dass sie davon $ 500 abgeben müssen, so dass Sie eine Auszahlung von $ 1.500 erwarten können. Option B beinhaltet die Chance, eine Münze zu werfen, bei „Kopf“ werden Ihnen $ 1.000 abgezogen, bei „Zahl“ erhalten sie keinen Abzug, so dass Sie die 2.000 Dollar behalten dürfen. Welche der Optionen wählen Sie in diesem Fall?
Die Forschung zeigt, dass die meisten Menschen im ersten Szenario Option A, also die sicheren $ 500 wählen, im zweiten Szenario dagegen Option B, die mit der Chance verknüpft ist, den drohenden Verlust zu vermeiden (BELSKY/GILOVIC 1999). Offenbar wiegt die angekündigte Reduzierung des auszuzahlenden Betrages so schwer, dass man bereit ist, einen noch höheren Verlust in Kauf zu nehmen, ein Risiko, das man bei der Aussicht auf einen gleichhohen zusätzlichen Gewinn nicht einzugehen bereit ist.
Dass die Aversion gegen Verluste zu nachteiligen finanziellen Entscheidungen führen kann, illustrieren Belsky/Gilovic mit folgendem Beispiel. Eine Frau („Gary“) kaufte sich Ende der 80er Jahre eine Eigentumswohnung in Boston für $ 110.000, kurze Zeit bevor der Wohnungsmarkt im Nordosten der USA zusammenbrach. Ein Jahr nach ihrem Erwerb musste sie aus beruflichen Gründen in eine andere Stadt umziehen und wollte aus diesem Grund ihre Wohnung verkaufen. Das höchste Angebot, das sie dafür erhielt, belief sich auf $ 100.000. Der sich dadurch ergebende Verlust von $ 10.000 schmerzte sie so, dass sie ihre Wohnung lieber vermietete und sich in der neuen Stadt keine neue Wohnung kaufte, sondern zur Miete wohnte. Nach einiger Zeit entschloss sie sich dann doch, die Wohnung zu verkaufen, weil sie sich in Los Angeles ein Haus kaufen wollte, wozu sie das Geld brauchte. Sie erzielte für ihre Eigentumswohnung in Boston nun nur noch einen Kaufpreis von $ 92.000. Ergänzt sei die Lehre aus diesem Beispiel noch durch die allgemeine Einsicht, dass das Auseinanderfallen von subjektiver und objektiver Wertzuweisung immer auch ausgenutzt wird: „Der Besitztums-Effekt ist den Kaufleuten durchaus bekannt. Hierin begründet liegt, warum Produzenten und Händler Probekäufe und Geldzurückgarantien anbieten“ (BELSKY/GILOVIC 1999, S. 96).
Nun sind finanzielle Verluste sicher das eine und sie mögen schmerzlich sein (selbst für diejenige Gruppe von Reichen, die trotz herber Vermögenseinbußen außerordentlich reich bleiben), das andere sind Verluste durch Trennung und Tod oder der Verlust von Gesundheit und Fähigkeiten, Verluste, die die Substanz unseres Lebens in einem ganz fundamentalen Sinn bedrohen. Zwar lässt sich auch für diese existenziellen Aspekte unseres Lebens eine Asymmetrie zwischen Gewinn- und Verlusterfahrung ausmachen, die Betrachtung von wirklich „tiefen“ Verlusten erfordert dessen ungeachtet eine entsprechend „tiefere“ Psychologie des Verlustes (ansatzweise finden sich entsprechende Überlegungen z.B. bei HARVEY 1998).