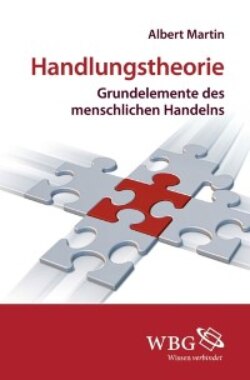Читать книгу Handlungstheorie - Albert Martin - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.3 Elemente einer Handlungstheorie
ОглавлениеWünsche und Überzeugungen sind die Kernelemente einer jeden Handlungstheorie. Wünsche liefern sozusagen den Antrieb, die Motivation, die uns bewegt. Überzeugungen dienen der Navigation, sie vermitteln uns Erkenntnisse, damit wir den besten Weg zu unseren Zielen einschlagen. Sind aber damit schon „alle wesentlichen“ Elemente des menschlichen Handelns erfasst? Wie bereits ausgeführt, bilden Überzeugungen und Wünsche das Fundament einer Minimalversion menschlichen Handelns. Um dessen Natur besser gerecht zu werden, sind drei weitere Grundelemente in die Handlungstheorie einzubeziehen. Eines davon knüpft an die Gegenüberstellung von Antrieb und Erkenntnis an, mit der nicht selten eine Gegensätzlichkeit zum Ausdruck gebracht wird (der Verstand kämpft gegen die Leidenschaft, das nüchterne Denken zügelt den haltlosen Eifer, ein klarer Blick vertreibt die Furcht usw.). Natürlich besteht diese Art Gegensätzlichkeit nicht, und zwar aus dem einfachen Grund, weil Motive und Einsichten komplementäre Funktionen erfüllen. Dennoch steckt eine gewisse Wahrheit in der Entgegensetzung, da es nicht selten zu wechselseitigen „Übergriffen“ zwischen Überzeugungen und Wünschen kommt: beispielsweise nehmen wir die Wirklichkeit gern so wahr, wie es uns am besten passt („weil nicht sein kann, was nicht sein darf“) und finden das gut, was uns vertraut ist („was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß“). Und an genau dieser Stelle kommt eine Größe zum Zug, die in der Handlungstheorie stark vernachlässigt wird: der Wille. Der Wille ist parteiisch, er verleiht den Wünschen oder Überzeugungen Dominanz; im Idealfall ergreift er Partei für die Rationalität und verhilft sowohl den (authentischen) Bedürfnissen eines Menschen als auch dessen Realitätssinn zu ihrem Recht. Bemerkenswert am Willen ist seine Doppelnatur, er hat eine motivationale Seite, die häufig auch als „Kraft“ bezeichnet wird und eine mentale Seite, die sich als „Fähigkeit“ erweist. Wir haben bereits darauf hingewiesen, dass eine solche Einteilung psychologischer Größen oft zu grob ist. Denn in der Erkenntnis liegt nicht nur eine Fähigkeit, sondern auch eine Kraft, und im Antrieb steckt nicht nur Kraft, sondern auch Fähigkeit, gleichwohl ist eine gewisse Akzentsetzung durchaus erkennbar. Der Wille vereinigt untrennbar beides: er ist ganz sicherlich eine Kraft (obwohl diese manchmal nicht sonderlich stark ist), er ist aber auch eine Fähigkeit, die als „psychologische“ Fähigkeit durchaus auf eine Stufe mit der „mentalen“ Fähigkeit (die sich auf den Erkenntnisgewinn bezieht) gestellt werden kann. Ohne den Willen, an einer Idee oder an einem Ziel festzuhalten und ohne die vom Willen bereitgestellte Energie, um Widerstände zu überwinden, erlahmen Körper und Geist; man macht nichts aus sich und richtet sich bequem im Gegebenen ein. Der Wille ist daher ein ebenso wichtiges Grundelement des Handelns wie der Wunsch und die Überzeugung.
Ein weiteres Grundelement ist die handelnde Person, ihr „Selbst“ und – in der selbstbezogenen Betrachtung der Person – ihr Selbstbild und ihr Selbstverständnis. Das Selbst ist der Kern jener Person, um deren Handeln es ja schließlich geht. In der Rational-Choice-Theorie spielt das Selbst keine Rolle, zwar lässt sich sagen, dass die Präferenzen und Überzeugungen einer Person einiges über deren Selbstverständnis aussagen, sie tun dies aber nur sehr rudimentär. Dabei ist das Selbst weit mehr als eine Nutzenfunktion; es folgt seinen eigenen Regeln, die sich nicht der Logik von Präferenzurteilen und Erwartungshaltungen unterwerfen. Häufig tun wir etwas nicht, weil es uns nützt, sondern weil es dem Bild entspricht, das wir von uns haben oder haben wollen – auch auf die Gefahr hin (oder im Wissen), dass uns diese Handlung mehr Nachteile als Vorteile einbringt. Selbstverständlich kann man auch in diesem Fall wieder und ausschließlich das Nutzenstreben am Werk sehen und beispielsweise argumentieren, das entsprechende Verhalten diene letztlich nur dem Bedürfnis nach Konsonanz oder Konsistenz. Die Einverleibung in die Nutzentheorie gelingt, wie man diesem Beispiel leicht ansieht (in anderen Fällen ist das nicht immer so leicht zu erkennen) aber nur mit Hilfe eines tautologisierenden Tricks und zeugt von einer erheblichen Ignoranz, die für zentrale Aspekte des menschlichen Handelns kein Interesse aufbringt.
Das fünfte Grundelement des Handelns ist die „Definition der Situation“. Die Definition der Situation steht für den Prozesscharakter des Willensbildungsprozesses. In ihr vereinigen sich die mentalen und psychischen Strömungen, die sich zum aktuellen Bewusstseinszustand des Handelnden verdichten. Niemand verfügt über vollkommenes Wissen, nicht einmal über das Wissen, das „eigentlich“ in ihm steckt und das er „eigentlich“ nur abrufen müsste. Der Zugriff auf die in unserem Gedächtnis gespeicherten Informationen wird durch die „psychische Apparatur“ bestimmt, die uns mitgegeben ist. Um zu verstehen, wie Gedanken geformt, wie daraus Pläne und Entscheidungen und schließlich konkrete Handlungen werden, muss man die Konstruktionsprinzipien der psychischen Ausstattung kennen. Doch auch dieses Wissen genügt nicht, um menschliches Handeln vollständig nachvollziehen zu können, weil die mentalen Werkzeuge, auf die wir bei unserem Denken und Handeln angewiesen sind, nicht einfach bereit stehen, sondern in der konkreten Handlungssituation häufig erst noch geschaffen werden müssen. Handeln entsteht während des Handelns und auf einer schmalen Basis. Es wird von wenigen „Entscheidungsprämissen“ bestimmt, die zudem nur bedingt die wahre Lage abbilden, die wir bei unserem Tun berücksichtigen sollten. Wir lösen Probleme, die wir selbst definieren. Das liegt nicht etwa nur an der uns eigenen Denkfaulheit, sondern vor allem an unserer beschränkten kognitiven Ausstattung. In Abbildung 1.2 sind die fünf Grundelemente des menschlichen Handelns aufgeführt, die in diesem Buch behandelt werden. Im Bereich der Wünsche werden dabei speziell die Präferenzen behandelt, dieser Begriff hat in der Entscheidungstheorie Tradition und drückt aus, was eine Person schätzt, was sie anstrebt und warum sie überhaupt aktiv wird. Allerdings wissen wir Menschen oft gar nicht so genau, was wir eigentlich wollen und auch bei der Wertschätzung dessen, was wir uns wünschen, sind wir nicht selten wankelmütig.
Abb. 1.2: Grundkonzepte der Handlungstheorie
Im Bereich der Überzeugungen befassen wir uns speziell mit der Unsicherheit, die das menschliche Denken und Handeln begleitet. Denn die Überzeugungen, die unser Handeln bestimmen, sind nicht in Stein gemeißelt, sondern oft undeutlich, unbestimmt und ungewiss. Zu fragen ist daher, in welcher Weise Unsicherheit das Handeln beeinflusst und wie Menschen mit Unsicherheit umgehen. Bezüglich der drei weiteren Grundelemente des Handelns sind jeweils Akzentuierungen genannt, die diese in Richtung Erkenntnis und Antrieb setzen. So bildet sich der Wille einerseits aus festen Einsichten, die man nicht preisgeben kann und andererseits aus einem Geltungsanspruch, der sich gegen widerstreitende Kräfte zu behaupten sucht. Ähnlich geht es beim Selbst einerseits um die ganzheitliche Einordnung des Handelns und um den Sinnbezug des eigenen Tuns, andererseits um die Bedeutung (im Sinne der Bedeutsamkeit), die eine Person für sich einfordert. Die Definition der Situation schließlich bestimmt sich einerseits aus spezifischen Wahrnehmungen, die dazu dienen, die gegebene Handlungssituation zu analysieren, andererseits aus einem eher diffusen und nicht immer in aller Deutlichkeit spezifizierbaren motivational-emotionalen Komplex, der den psychologischen Hintergrund des Handelns bildet. In der Definition der Situation zeigt sich beispielhaft, wie geistige und gemüthafte Prozesse zusammenstimmen und dass sie sich nur schwer voneinander isolieren lassen.
Dieses Buch erhebt nicht den Anspruch, eine völlig neue und in sich geschlossene Handlungstheorie zu präsentieren. Wie der Titel schon sagt, geht es vor allem darum, wichtige Bestandteile einer aussagekräftigen Handlungstheorie vorzustellen und zu erläutern. Die Erörterung der empirischen Erkenntnisse und theoretischen Einsichten in den einzelnen Kapiteln verfolgt nicht zuletzt auch die Absicht, die abstrakten Konstrukte der Handlungstheorien mit Anschauung auszustatten. Es wäre schön, wenn dieses Buch einen Beitrag zu der Frage liefern würde, welche Kontur eine erst noch zu entwickelnde allgemeine Handlungstheorie annehmen sollte – und könnte.