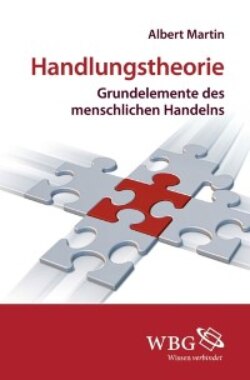Читать книгу Handlungstheorie - Albert Martin - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.1 Grundprobleme der Handlungstheorie
ОглавлениеAlle Wissenschaften – die Naturwissenschaften partiell ausgenommen – befassen sich mit dem menschlichen Handeln. Handlungstheoretische Ansätze sind in den Geisteswissenschaften ebenso zu finden wie in der Ökonomie, in der Philosophie des Geistes, der Psychologie und Psychiatrie, Politologie, Soziologie und Sozialpsychologie, den Geschichtswissenschaften, Kommunikationswissenschaften, Arbeitswissenschaften, in der Personalwirtschaftslehre, Anthropologie, Ethnologie, der angewandten Philosophie, Pädagogik, Theologie und den Kulturwissenschaften (als kleine Auswahl aus der Überfülle der Literatur seien genannt: ARCHER 2000; DAVIDSON 1990; ESSER 2002; ETZRODT 2003; GRUNDMANN 1999; HECKHAUSEN/HECKHAUSEN 2010; KIRSCH 1998; KLUCKHOHN 1962; KRAMPEN 2000; LENK 1977; LUTHANS 2011; MARTIN 2003; MIEBACH 2006; MÜNCH 2007; WRIGHT 1979; RAUSCH 1998; SEARLE 2001; VYGOTSKIJ 2002; WEISE u.a. 2005; O’DONNELL 2010). Angesichts einer solchen Vielfalt an Zugängen ist es nicht verwunderlich, dass sich schon allein die Verständigung darüber, was genau gemeint ist, wenn von menschlichem Handeln gesprochen wird, als schwierig erweist. Umso schwieriger wird auch eine Einigung darüber, wie eine Theorie des Handelns aussehen könnte.
Und auch das große Fragenspektrum, mit dem sich eine Handlungstheorie konfrontiert sieht, trägt nicht zu einer Klärung dieser Fragen bei. Erklärt werden soll, warum Menschen etwas sofort tun, etwas später tun, etwas gar nicht tun; warum sie sich anstrengen, ermüden, sich „gehen lassen“, sich beherrschen, die Schule schwänzen, sich weiterbilden, Stress empfinden; warum sie freundlich, kooperativ, süchtig, unpolitisch sind, bösartig lächeln, etwas riskieren, sich belügen, Tabus brechen, Trittbrett fahren, jemandem helfen oder misstrauen, Kriege beginnen, Feindschaften beenden, stolpern, sich versprechen, ein Unternehmen gründen, einen Beruf wählen, Heiratsanträge machen, jemanden beleidigen, zur Wahl gehen, Mitarbeiter entlassen, Bonuszahlungen abschaffen, Regeln befolgen, brechen und ersetzen, unverantwortlich, leichtsinnig, gedankenlos handeln oder sinnlose Taten verüben; warum sie aggressiv, behutsam, einfühlsam, gleichgültig und arglos, ruhelos, träge oder begeistert sind, sich um nichts oder um alles kümmern, sich abwenden, aufmerken, eine vage Idee verfolgen, etwas nicht wahrhaben wollen, auf etwas bestehen usw. usw.
Dabei ist es nicht nur die große thematische Breite, die sich bei der Entwicklung einer Theorie als schwierig erweist. Drei weitere Herausforderungen seien kurz angesprochen.
Erstens enthalten viele Fragen eine starke Aufforderung, sich mit jenen Erklärungen zu befassen, die unmittelbar an den Phänomenen ansetzen, sodass der Umweg über eine allgemeine und damit notwendigerweise abstrakte Handlungstheorie unangebracht scheint. Beispielhaft sei das Suchtverhalten genannt, bei dem ja vor allem interessiert, warum Menschen süchtig werden. Erst an zweiter Stelle wird gefragt, warum diese Menschen ihrem inneren Drang nach Suchtbefriedigung immer wieder nachgeben. Obwohl beide Fragen mit Hilfe handlungstheoretischer Überlegungen angegangen werden können, neigt man – jedenfalls bei der ersten Frage – dazu, nach milieu- und persönlichkeitsbedingten Erklärungen zu suchen.
Zweitens werden bei der Erklärung von Verhaltensweisen oft sehr unterschiedliche Ebenen angesprochen. So geht es beispielsweise bei der Frage, warum man sich dazu „entschließt“, über bestimmte Dinge nicht mehr nachzudenken, um Mikroprozesse der Gefühlsregulation. Demgegenüber betrifft die Überlegung, ob man endlich die lang ersehnte Weltreise antreten soll, eher pauschale Aspekte der Urteilsfindung, also so handfeste Punkte wie die finanziellen Möglichkeiten oder Informationen über die politische Lage in den anvisierten Reiseländern.
Und drittens ist das Erkenntnisinteresse sehr unterschiedlich. Will man beispielsweise wissen, ob jemand trotz psychischer Beeinträchtigungen eigenverantwortlich zu handeln vermag, dann werden andere erkenntnispragmatische Dimensionen angesprochen als wenn es darum geht, warum sich Mitglieder einer bestimmten Berufsgruppe mehr und Mitglieder anderer Berufsgruppen weniger um ihre berufliche Weiterqualifizierung kümmern.
Angesichts dieser Komplexität fragen sich viele Forscher, ob es überhaupt gelingen kann, eine Handlungstheorie zu entwickeln, die befriedigende Erklärungen für alle Facetten des menschlichen Verhaltens liefert. Und ebenso zwiespältig beantwortet sich die Anschlussfrage: Ist es überhaupt sinnvoll, dies anzustreben? Die Meinungen dazu sind geteilt. Sehr skeptisch äußert sich beispielsweise Harold KELLEY (2000). Die kreativsten und besten Köpfe der Sozialpsychologie hätten sich, so seine Diagnose, keine Zeit dafür genommen, eine allgemeine Theorie des menschlichen Sozialverhaltens zu entwickeln (und schon gar nicht eine allgemeine Handlungstheorie). Zwar seien so bedeutsame Ansätze wie die Dissonanztheorie, die Balancetheorie und die Reaktanztheorie entstanden, dabei handele es sich aber jeweils um Ein-Motiv-Theorien und sie lieferten daher auch kein „big picture“ des Forschungsgegenstandes. Kelley sieht auch keinen Weg, dies zu ändern. Ihm erscheint es aussichtslos, die Sozialpsychologie allgemein theoretisch zu bestimmen. Er empfiehlt seinen Kollegen stattdessen, je nach Fragestellung bereichsspezifische Theorien zur Anwendung zu bringen. Damit verglichen klingt der Anspruch anderer Forscher wesentlich weniger bescheiden. Dietrich Dörner und Kollegen beispielsweise formulieren sehr selbstbewusst:
„Wir haben in der Theorie zusammengebracht Hypothesen über Denkprozesse, Gedächtnisstrukturen und Gedächtnisprozesse, emotionale Prozesse, Aggressions- und Fluchtverhalten und über Motivationen … Wir sind … der Meinung und glauben dokumentiert zu haben, daß eine Integration verschiedener Gebiete der Kognition, der Motivation und der Emotion notwendig ist.“ (DÖRNER/REH/STÄUDEL 1983, S. 446)
In diesem Zitat deuten sich zwei grundsätzliche Probleme an, die sich der Entwicklung einer befriedigenden Handlungstheorie in den Weg stellen. Das erste Problem ergibt sich aus der großen Komplexität, mit der man sich konfrontiert sieht, wenn man in einer einzelnen Theorie Aussagen vereinen will, die sich fundiert sowohl mit den Motivationen als auch mit den gedanklichen Vorgängen und dazu noch mit den emotionalen Facetten des menschlichen Handelns befassen. Die Versuchung ist groß, der Komplexität der Realität eine gleichermaßen komplexe Theorie an die Seite zu stellen. Normalerweise gewinnt man damit jedoch nicht viel, da der Grenz-Erkenntnis-Nutzen (wenn man das so sagen darf) durch die Komplexitätsanreicherung von Theorien abnimmt. Von einer Theorie, die die Realität im Maßstab 1:1 abbilden soll, kann man nicht viel erwarten, im besten Fall erreicht man mit ihrer Hilfe lediglich eine Beschreibung des ohnehin Offensichtlichen. Theorien sollen die tieferen Schichten der Wirklichkeit ergründen, sich also nicht mit der Vielfalt der Phänomene befassen, sondern deren Entstehen beschreiben, sich mit den Tiefenstrukturen der Realität befassen. Aus dieser Aufgabenstellung heraus ergibt sich auf der einen Seite eine Komplexitätsentlastung für den Theoretiker, die er allerdings auf der anderen Seite dadurch erkauft, dass er sich den Mühen unterziehen muss, die die frustrierende Suche nach den fundamentalen und allgemeinen Gesetzmäßigkeiten des menschlichen Handelns mit sich bringt.
Das zweite Problem ergibt sich daraus, dass unser Handeln sehr stark von autonomem Nachdenken und eigenem Willen geprägt ist, zusätzlich aber auch von unbewussten und schwer zu durchschauenden Prozessen „gesteuert“ wird. Im ersten Fall handeln wir nach mehr oder weniger abgewogenen, jedoch klar benennbaren Gründen, im zweiten Fall sind wir Ursachen ausgesetzt, die „im Hintergrund“ wirken und uns in gewisser Weise fremdbestimmen. Wie diese so unterschiedlichen Phänomene miteinander vermittelt werden können, ist höchst umstritten. Nicht wenige Handlungstheoretiker „lösen“ dieses Problem definitorisch auf, indem sie die jenseits des Erwägungshandelns laufenden unbewussten Prozesse aus dem Handlungsbegriff ausgrenzen. Handeln, das sich aus affektiven Voreingenommenheiten, aus quasi-reflexhaften Impulsen, aus einem diffusen Erleben, aus schwer greifbaren Regungen speist oder in habitualisierten Routinen verankert ist, wird dann aus der Betrachtung ausgeschlossen und als bloßes „Verhalten“ disqualifiziert. Handeln ist danach „intentional“, ein bewusster Vorgang, der auf Einsicht, Kontrolle, Zielorientierung, Zwecksetzung, Sinnstreben baut (RAUSCH 1998). Für die Erforschung des menschlichen Handelns ist mit solchen definitorischen Ausgrenzungen wenig gewonnen, denn das menschliche Handeln ist unteilbar. Ein bewusstes und zielstrebiges Handeln in Reinform gibt es nicht. Unser Handeln wird immer auch bestimmt von unbewussten und der Handlungssteuerung entzogenen Prozessen. Damit soll aber nicht gesagt sein, dass es unmöglich ist, deutliche Akzentsetzungen im Handeln zu erkennen. Manchmal reagiert man im buchstäblichen Sinne „emotional“, ein andermal eher wie ein „kühler Stratege“ usw. – aber die Versuche, spezifische Handlungstypen zu identifizieren (VON CRANACH 1994; JUNG 2001; WEBER 2005), stoßen an ihre Grenzen, weil der Nachweis, dass die damit bezeichneten Handlungsweisen eigenen Gesetzmäßigkeiten folgen, kaum gelingen dürfte, sie bilden lediglich spezifische Ausformungen, die sich von den Prozessen, die den Handlungs- und Bewusstseinsstrom lenken, nicht abkoppeln lassen.
Was folgt daraus für die Handlungstheorie? Wie kann sie dem Problem begegnen, dass menschliches Handeln zu komplex ist, um es aus einer einzelnen Perspektive heraus begreifen zu können? Und wie kann sie mit dem Problem umgehen, dass sich im Handeln das selbstbestimmte Vorgehen mit fremddeterminierten psychologischen Abläufen vermengt? Wahrscheinlich gibt es keine endgültig befriedigende Lösung für diese beiden Probleme, wohl aber geeignete Strategien, die dabei helfen, mit ihnen umzugehen. Dem Komplexitätsproblem begegnet man am besten durch Einfachheit. Eine Handlungstheorie sollte nicht zu komplex sein, sie sollte sich auf möglichst wenige, dafür aber grundlegende Elemente des menschlichen Verhaltens konzentrieren. Der menschlichen Natur wird man am ehesten gerecht, indem man zunächst die rationale Seite des Menschen akzentuiert, wobei allerdings auf Übertreibungen verzichtet werden sollte. Der sich daran anknüpfende Ausbau der Handlungstheorie in Richtung größerer Komplexität muss sich mit dem Prozesscharakter des menschlichen Denkens und Tuns und mit der „Architektur“ oder „Konstitution“ der menschlichen Psyche befassen. Ganz zwanglos löst sich mit dieser Betrachtung auch das zweite der beiden oben herausgestellten Probleme, die Trennung der gedanklich selbstbestimmten und physiologisch-psychologisch fremdbestimmten Handlungen: Gedankliche Prozesse und psychische Prozesse sind eng aufeinander bezogen und miteinander verwoben und bringen gemeinsam das hervor, was uns Menschen zu unserem Tun veranlasst.