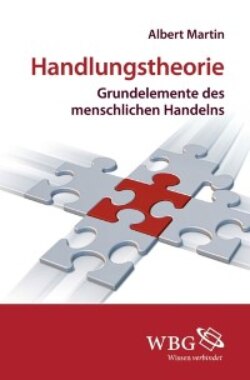Читать книгу Handlungstheorie - Albert Martin - Страница 19
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.3.2 Zukünftige Werte
ОглавлениеManchmal ist es unser Geschmack von heute, der uns den Genuss von morgen kostet. Wenn wir Entscheidungen treffen, dann zielen diese auf Ergebnisse, die in der Zukunft liegen. Doch wie können wir wissen, was wir in der Zukunft mögen? In aller Regel gehen wir davon aus, dass sich unsere Präferenzen nicht ändern. Wer ein Literaturstudium beginnt, erwartet, dass er sich auch noch in zehn oder zwanzig Jahren gern mit Literatur beschäftigt, wer ein Lehramtsstudium ergreift nimmt an, dass sein Interesse am Schulunterricht Bestand haben wird, wer als 25-Jähriger eine Ehe eingeht, meint, dass er auch als 40-Jähriger noch dieselben Eigenschaften an einer Frau schätzt (und – nebenbei bemerkt – dass sich auch seine Frau nicht ändert, und dass er nach wie vor ihrer Wertschätzung sicher sein kann). Doch man irrt sich leicht und zwar nicht nur darüber, wie sich die zukünftige Situation darstellen wird (das Urlaubsparadies ist sehr irdisch, der Partner hat Eigenheiten, mit denen man nicht gerechnet hat, mit der angestrebten Beförderung verknüpfen sich vielleicht mehr Geld und ein höheres Ansehen, aber auch erhebliche Arbeitsbelastungen, Verantwortung und Verdruss), sondern auch und nicht zuletzt über die eigenen zukünftigen Präferenzen. Bekanntlich empfinden viele Personen die Ruhe ihres Ruhestandes, nach der sie sich gesehnt haben, dann als eher öde und bedrückend; der junge Forscher, der sich zu Beginn seiner Laufbahn begeistert in heftige Diskussionen mit seinen Kollegen wirft, kann dem schließlich nichts mehr abgewinnen, weil er merkt, dass er doch lieber seine eigenen Gedanken erst mal für sich allein entwickelt und sie sich nicht gern vorschnell zerreden lässt; aus einem Saulus wird ein Paulus, aus einem Jünger ein Verräter.
Menschen tun sich schwer damit, vorauszusehen, welche Werte, Ziele und Bedürfnisse sie in der Zukunft haben werden. Ebenso schwer ist vorauszusehen, wie man in bestimmten Situationen reagieren wird, wie man zum Beispiel mit Versuchungen umgeht. Diesbezüglich hat man häufig ein idealisiertes Bild von sich und unterschätzt die Macht der jeweiligen physio-psychisch-sozialen Befindlichkeit (HASTIE/DAWES 2001, S. 205). Kaum einer weiß zum Beispiel, wie er auf Beleidigungen des Chefs reagieren wird, bevor er diese Situation erstmals erlebt. Auch und vor allem machen wir uns oft falsche Vorstellungen davon, welche Empfindungen wir haben werden, wenn wir in andere Lebensverhältnisse geraten. Das zeigen Studien über das Lebensgefühl von Menschen nach einer drastischen Veränderung ihrer Lebenssituation. Personen, die – positiv – einen Haupttreffer im Lotto hatten und Personen die – negativ – einen Unfall hatten, der ihnen eine Querschnittslähmung eintrug, richten sich nach einer gewissen Zeit der Euphorie bzw. des Leids auf die neue Situation ein und sind dann im Wesentlichen so zufrieden oder unzufrieden wie vordem. Wer auf einen Lottogewinn hofft, wird das nicht glauben, er malt sich die Situation des Reichtums in den schönsten Farben, wer sich vorstellt, eine erhebliche körperliche Beeinträchtigung zu erleiden, wird nicht behaupten, dass ihm das gleichgültig wäre, weil er auch dann so froh oder unfroh wäre wie jetzt auch schon. Das ist verständlich, weil wir uns natürlich von dem einschneidenden Ereignis stark beeindrucken lassen. In einer Studie, über die Kahneman berichtet, wird diese Neigung sehr schön illustriert (KAHNEMAN 2000b). Darin geht es um den Umzug eines Ehepaares. Die neue Wohnung war viel besser (in einem anderen Szenario: viel schlechter) als die alte Wohnung. Gemessen wurde die Qualitätsveränderung anhand einer ganzen Reihe von Merkmalen wie der Lage, der Ruhe, der Länge des Winters usw. Die Versuchsteilnehmer wurden darum gebeten, eine Einschätzung über das Wohlbefinden des Ehepaars abzugeben, und zwar für die ersten Monate nach dem Umzug und für die Zeit nach drei und nach fünf Jahren nach dem Umzug. Die Einschätzungen veränderten sich praktisch nicht. Das ist einigermaßen überraschend, denn tatsächlich passt man sich ja an eine neue Situation an und das Wohlbefinden pendelt sich im Lauf der Zeit auf das Normalmaß ein. Wissen wir das nicht? Weshalb täuschen wir uns in der Voraussage unserer Befindlichkeit? Verantwortlich hierfür ist – so Kahneman –, dass sich die Menschen bei ihren Voraussagen primär am Moment der Veränderung orientieren („Veränderungsregel“). Wenn wir einen Lottogewinn machen, wenn wir in eine schönere Wohnung ziehen, einen attraktiven Partner gewinnen oder wenn wir einen erheblichen materiellen oder ideellen Verlust erleiden, dann erleben wir das ganz intensiv und dieses Erlebnis prägt sich ins Gedächtnis ein. Dazu kommt, dass wir recht häufig irgendwelchen Veränderungen ausgesetzt sind und sich die damit verbundenen Gefühle ebenfalls häufig einstellen. Dagegen nehmen wir selten einen Vergleich von Zuständen vor, der sich zudem nicht so einfach gestaltet, weil sich unterschiedliche Situationen nicht so ohne Weiteres miteinander vergleichen lassen. Die Orientierung an den Veränderungserlebnissen ist möglicherweise der Grund dafür, warum manche Menschen geradezu neurotisch mit der Anhäufung von Dingen beschäftigt sind, die sie, nachdem sie sie erworben haben, kaum noch beachten. Es geht dann gar nicht um die neuen Möbel, das neue Mobiltelefon, um die doch so interessante neue Bekanntschaft, um neue Schuhe oder neue Hüte, an diese Dinge gewöhnt man sich rasch, sie vermehren nicht unser Glück, es ist der Moment der Aneignung, der Übergang von einem vermeintlich schlechteren zu einem vermeintlich besseren Status, der unser Erwerbsverhalten motiviert.
Dass man sich an das Bessere oder auch an das Schlechtere gewöhnt, verweist auf die Wirksamkeit von Anpassungsmechanismen. Dabei sind zwei Fälle zu unterscheiden. Im ersten Fall kommt es zu einer Anpassung des Erlebens, also der Wertschätzung und der Gefühlslage in der neuen Situation. Man freut sich zwar anfangs über die neue Situation (z.B. über eine neue größere, schönere und bequemere Wohnung), richtet sich dann allerdings darauf ein, bis man sie schließlich kaum noch wahrnimmt, man fühlt sich schließlich ebenso wohl oder unwohl wie in der vorigen Situation. Im zweiten Fall kommt es zwar tatsächlich zu einer dauerhaften Steigerung des Lebensgefühls, ohne dass damit allerdings auch die Zufriedenheit steigt. Das liegt an den höheren Ansprüchen, die sich aus der neuen Lage heraus entwickeln: man verlangt mehr, man ist gewissermaßen nicht mehr so leicht zufrieden zu stellen. Bezogen auf das Wohnungsbeispiel heißt das, dass man sich durchaus und auch dauerhaft wohler in der neuen Wohnung fühlt, sich darüber freut, wenn morgens die Heizung von selbst anspringt und man nicht mühevoll Feuer machen muss, dass man die Möglichkeiten schätzt, wegen der großzügigeren Räumlichkeiten mehr Freunde einzuladen usw., aber man nimmt dies als selbstverständlich hin, so dass sich kein Zufriedenheitsgewinn einstellt. In diesem zweiten Fall passt man also sein Anspruchsniveau an: man verlangt mehr, um zufrieden zu sein. Im ersten Fall passt sich dagegen das Erlebensniveau an die neue Situation an, so dass man die „objektive“ Verbesserung gar nicht mehr empfindet.
Bei der Unterscheidung der beiden Fälle geht es nicht um den Gegensatz von Gedanken und Gefühlen, eine Erhöhung des Anspruchsniveaus führt nicht einfach nur zu einer bornierten Haltung, sie geht durchaus mit einer nicht nur konstatierten, sondern auch lebhaft empfundenen Unzufriedenheit einher. Wenn man die unzufriedene Person darauf hinweist, dass sich ihre objektive Empfindungslage doch verbessert hat (unser Beispiel mit der bequemeren Wohnung), dann wird man nicht erwarten dürfen, dass sie ihren Irrtum einsieht, sich besinnt und plötzlich wieder zufrieden ist. Es gibt also zwei verschiedene Quellen gefühlter Unzufriedenheit, die gleichzeitig auftreten und damit ihre Wirkung verstärken können. Steigt das Anspruchsniveau, dann entsteht Unzufriedenheit aufgrund unerfüllter Ansprüche, sinkt das Empfindungsniveau, dann braucht es häufigere, vielfältigere oder intensivere Erlebnisse, um zu einer Bedürfnisbefriedigung zu gelangen.
Die Dynamik der damit verbundenen Verhaltensprozesse kann leicht auf unerquickliche Pfade führen. So kann eine Anspruchsniveausteigerung den oben bereits skizzierten Unzufriedenheits-Zirkel anstoßen, eine Senkung des Erlebnisniveaus führt unter Umständen in eine „hedonistische Tretmühle“. Der Unzufriedenheitszirkel (oder die „Unzufriedenheits-Tretmühle“) entsteht aus der Orientierung an der Transformationsregel, also an der Orientierung des Moments der Veränderung. Ein neues Paar Schuhe kann durchaus einen Moment des Glücks bedeuten. Dieser Zustand wird zwar kaum dauerhaft anhalten, dafür bleibt die positive Erinnerung an den glückhaften Moment der Veränderung, dem damit eine Wertschätzung zuwächst, die sich leicht verselbständigen kann. Was zählt ist dann primär der Kaufakt und die schnell vergängliche Befriedigung danach und nicht der tatsächliche Genuss, den man sich durch den Besitz an dem Neuerworbenen verspricht. So häuft man Gut auf Gut, knüpft ständig neue Partnerschaften, kämpft sich von Karrierestufe zu Karrierestufe und wird damit doch nicht zufriedener. Die Dynamik des Unzufriedenheitszirkels wird sehr stark von den zuletzt gemachten Erfahrungen bestimmt. Das Erlebnisniveau, das für den Einstieg in die hedonistische Tretmühle (BRICKMAN/CAMPBELL 1971) bestimmend ist, umgreift dagegen einen längeren Erfahrungshorizont. Es pendelt sich auf den Durchschnitt aller vergangenen Erfahrungen ein, was zwangsläufig dazu führt, dass die Steigerung der Befindlichkeit (z.B. aufgrund eines Wohnungswechsels, wegen eines Karriereschritts, weil man einen neuen Partner gefunden hat) nicht von Dauer sein kann, sondern sich auf das vorige Niveau hin absenkt. Auch eine weitere Verbesserung der Situation (durch weiteren sozialen Aufstieg usw.) führt diesbezüglich nicht weiter, weil ja auch dann die Abwärtsspirale wieder in Gang kommt (KAHNEMAN 2000a; 2000b).
Abschließend wollen wir nochmals auf unseren Ausgangspunkt zurückkommen, die Schwierigkeit, die eigenen Präferenzen zu verstehen. Zeitlich gesehen zielt diese Frage zwar in zwei Richtungen (in die Bewertung der Vergangenheit und die Voraussage unserer zukünftigen Nutzenvorstellungen), sie hat dessen ungeachtet ein und dieselbe sehr allgemeine Antwort. Sie lautet: Wir gründen unsere rück- und vorausschauenden Bewertungen nicht auf eine Analyse der tatsächlichen Situationen in ihrer ganzen Komplexität, sondern auf prototypische Erfahrungen, die wir mit den jeweiligen Situationen verknüpfen (vgl. Abbildung 2.3).
Abb. 2.3: Vergangenheits- und zukunftsbezogene Nutzenbeurteilung
Bei der Zukunftsbewertung spielt, wie beschrieben, die Transformationsregel eine wichtige Rolle, d.h. Menschen reagieren vor allem auf Veränderungen und es sind diese Veränderungserfahrungen, die sich „prototypisch“ ins Gedächtnis einprägen. Bei der Beurteilung vergangener Ereignisse kommen die zuletzt gemachten Erfahrungen und die stärksten Empfindungen zum Zuge. Die Plausibilität dieser „Peak-End Rule“ (FREDRICKSON/KAHNEMAN 1993; KAHNEMAN 2003) spricht wohl für sich. Eine intensive Erfahrung ist ein starker Situationsmarker, ein Fußballspieler wird in seiner Erinnerung daher eher ein Spiel positiv bewerten, in dem er das turnierentscheidende Tor erzielt hat als ein beliebiges Spiel, in dem er zwar vielleicht eine bessere Leistung gezeigt hat, ansonsten aber wirkungslos blieb. Und um bei diesem Beispiel zu bleiben: Wird das Tor in der letzten Minute erzielt, dann wirkt das sicher stärker nach, als wenn es irgendwann im Laufe des Spiels fällt.