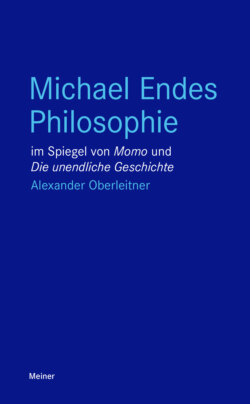Читать книгу Michael Endes Philosophie - Alexander Oberleitner - Страница 19
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.War Michael Ende ein Gegner des logischen (begrifflichen) Denkens?
ОглавлениеWenn wir Michael Endes zahlreiche Reflexionen – sei es in protokollierten Diskussionen, Interviews oder Briefen – über Möglichkeiten und Gefahren des begrifflichen oder auch logischen Denkens in ihrer Gesamtheit betrachten, so stoßen wir zuweilen auf eine gewisse Skepsis, die manchmal sogar an Ablehnung zu grenzen scheint. Daß Ende gern die »Verkopftheit« seines Jahrhunderts beklagte, wissen wir bereits aus Phantasie/Kultur/Politik. Was damit gemeint ist, wird an anderer Stelle desselben Gesprächs deutlicher, wo es um die tieferen, historischen Ursachen des Problems geht:
Mit Sokrates hat im Grunde das argumentierende Denken angefangen, das die Vorsokratiker noch nicht kannten. […] Man kann sagen, daß das heraklitische Denken dem asiatischen, dem zenbuddhistischen Denken viel verwandter ist als irgendeinem begrifflichlogischen Denken von heute. Die Sokratiker haben eigentlich angefangen zu glauben, man könne durch das logische Argument zu Wahrheiten gelangen und mit diesen Wahrheiten etwas Festes, etwas »Objektives« in der Hand haben. Aus diesen Überlegungen heraus hat sich dann im 16. Jahrhundert das nur noch quantifizierende Denken ergeben. Man hielt nur noch das für wahr, was zählbar, meßbar oder wägbar war, und leugnete schließlich sogar die Wirklichkeit aller Qualitäten, weil die eben nicht durch ein quantifizierendes Denken zu fassen sind. […] Im naturwissenschaftlichen Weltbild von heute wird nur noch das für wahr gehalten, was ein einzelnes, farbenblindes Auge von der Welt wahrnimmt, und auch davon nur das, was sich in Zahlen ausdrücken läßt, alles andere ist reine Illusion. Die Farben Rot oder Blau existieren in Wirklichkeit nicht, sie werden nur subjektiv von unserem Gehirn erzeugt – was wir wahrnehmen, sind da in Wirklichkeit nur lange oder kurze Lichtwellen, die unsere Sehnerven entsprechend stimulieren. Schwingungen, die man in Zahlen ausdrücken kann.
Im Grunde wird alles zur Illusion erklärt, was Qualität ist […]. Als Musterbeispiel dafür könnte man etwa Bücher anführen wie Jenseits von Freiheit und Würde des amerikanischen Verhaltensforschers Skinner oder Zufall oder Bestimmung des französischen Chemikers Monod.68
Diese Passage hat Kowatsch offenbar derart beeindruckt,69 daß sie das gesamte Schaffen Endes kurzerhand als einen Versuch zur »Überwindung des abstrakt-begrifflichen Denkens«70 deutet. Hätte sie recht, wäre eine Untersuchung wie die vorliegende schlichtweg hinfällig. Das Werk eines Schriftstellers »in der Tradition des Antirationalismus«71, dessen Helden am »Intellektualismus der modernen Welt«72 leiden, einer begrifflich-intellektuellen Analyse zu unterziehen, gar nach seinem philosophischen Denken zu fragen, wäre nicht nur absurd, es käme geradezu einer posthumen Insultation Endes gleich, die auch keinerlei sinnvolle Ergebnisse zeitigen könnte.
Sehen wir uns das obige Zitat genauer an, so fällt als erstes auf, daß Endes Stellungnahme selbst im Rahmen und in der Form abstrakt-begrifflicher Argumentation verläuft, womit er, wenn wir Kowatsch folgen, eine grobe Inkonsequenz beginge – würde er sich doch gerade auf jene Art der Ratio stützen, die er zu stürzen versuchte. Aber geht es hier wirklich um das Denken in Begriffen? Viel eher hat man den Eindruck, daß sich Ende gegen die Allmacht der erfahrungswissenschaftlichen Methodik wehrt, die nur gelten läßt, was »zählbar, meßbar oder wägbar« ist, gegen jenes »nur noch quantifizierende Denken«, das »alles zur Illusion erklärt, was Qualität ist«. Eine Absage an das begriffliche Denken schlechthin, wie von Kowatsch impliziert, sähe anders aus. So sind auch die Werke von Skinner und Monod, die Ende hier nennt, Paradebeispiele nicht etwa für das »begriffliche Denken«, sondern für die Hybris einer naturwissenschaftlichen Ideologie, die sich selbst als Schluß- und Gipfelpunkt menschlicher Geistesgeschichte ausgibt.73
Die erdrückende Dominanz der erfahrungswissenschaftlichquantifizierenden Methode ist für Ende freilich nur eine Seite der Medaille. Wie wenig später im selben Gespräch klar wird, wo er die Allgegenwart des »Machbarkeitskriterium[s]«74 als ein Grundübel unserer Gesellschaft brandmarkt, verfolgt für ihn jene Ideologie der Quantifizierung stets ganz bestimmte, materialistisch definierte Interessen. Hocke/Neumahr treffen es also wesentlich genauer als Kowatsch, wenn sie Endes eigentliches Angriffsziel im »zweckhaft-rationalen Denken«75 verorten. Sein Gedankengang (den wir übrigens in Momo wiederfinden werden) ist deutlich genug auszumachen: Jede Verzweckung setzt Quantifizierung voraus; das Einzigartige als Einzigartiges kann niemals verzweckt werden. Was diese Verzweckung für Ende konkret bedeutete, damit wird sich der zweite Teil der vorliegenden Untersuchung zu beschäftigen haben; dort wird sich zeigen, inwieweit für ihn jenes Quantifizieren der historischen Wirksamkeit des Kapitalismus den Boden bereitete – jenes Kapitalismus, der zeitlebens im Zentrum seiner »Zivilisationskritik« stand, bei Kowatsch jedoch kurioserweise kaum Erwähnung findet.
Auch an anderer Stelle in Phantasie/Kultur/Politik, wo Ende sich kritisch über das »kausallogische Denken« äußert, geht es ihm keineswegs um eine Absage an die Ratio, sondern um die Abwehr der angemaßten Allmacht der Erfahrungswissenschaften:
[…] Kultur entsteht nicht aus einer materialistischen Weltanschauung heraus. Unser ganzes Denken ist aber noch immer – vor allem auch das naturwissenschaftliche Denken – aus dem Materialismus des 19. Jahrhunderts geprägt. […] Das rein kausallogische Denken zum Beispiel ist in bestimmten Bereichen berechtigt. In der Physik, in der Chemie. Wenn ich aber auch den Menschen nur als kausales Gebilde sehe, als ein in Kausalitäten eingebundenes Wesen, dann kann ich keine Wertvorstellungen entwickeln, dann ist alles Reden von Kultur […] leeres Phrasendreschen.76
Mit diesem Gedankengang – die Verhinderung von Kultur durch die Hybris der materialistisch-naturwissenschaftlichen Ideologie – haben wir bereits einen Kern des Endeschen Denkens erreicht, auf den im Rahmen dieser Einleitung noch nicht entsprechend eingegangen werden kann. Nur soviel sei hier angedeutet, daß das Schaffen eines gedanklichen Freiraums für die menschliche Kreativität, aus der jede Kultur im tieferen Sinne entspringt, zweifellos ein ganz zentrales Anliegen des Autors war. Wenn also Ende hier im Grunde, wie etwa auch im Gespräch mit Joseph Beuys, »das Schöpferische im Menschen außerhalb der Kausalität stell[t]«,77 so läßt sich dies nicht einmal als Kritik an der naturwissenschaftlichen Methodik schlechthin (die in ihrem Bereich ja durchaus Berechtigung hat), schon gar nicht aber als schwärmerische Absage an das logische Denken deuten.
Um jenes Mißverständnis, das aus Ende einen »Antirationalisten« machen möchte, vollends auszuloten, sei hier noch ein kurzer Blick auf sein Verhältnis zur Romantik geworfen. Es besteht kein Zweifel, daß Endes Werk dieser literarischen Tradition, die er als »einzig original deutsche Kulturleistung«78 verstand, viel verdankt.79 Im Gespräch mit Dieter Zimmer betont er ausdrücklich:
Ich knüpfe ganz bewußt an romantische Traditonen an. Wenn Sie Romantik als eine Frage der gesamten Haltung und nicht als eine Stimmungssache nehmen, bin ich Romantiker.80
Diese Selbsteinschätzung ist freilich weit weniger eindeutig, als sie klingt, drängt sich doch sogleich die Frage auf, von welchen »romantischen Traditonen« hier die Rede ist. Die Romantik nämlich war eine ausgesprochen »ambivalente Bewegung« (Christian von Wernsdorff81), die nicht nur divergierende, sondern geradezu gegenläufige Strömungen hervorbrachte. Während sich die Frühromantik (Schlegel, Novalis) keineswegs der Ratio an sich, sondern lediglich »dem herrschenden Rationalitätstypus, der ökonomischen Verwertbarkeit, widersetzt«,82 wobei sie »viele Positionen der Aufklärung übernimmt und weiterbildet, sodaß eine Konitinuität der Entwicklung besteht«,83 tritt erst die Hochromantik (Brentano, Eichendorff) in jenen »deutlichen Gegensatz zur Aufklärung«,84 der heute meist als konstituierendes Element der Romantik schlechthin gilt.85
Welche dieser so grundverschiedenen romantischen Traditionen war es nun, der Ende sich verbunden fühlte? Für Kowatsch steht zweifelsfrei fest, daß Ende »mit seiner Kritik an der Moderne an die Hochromantik an[knüpft]«86. Belege für diese Einschätzung, die ihre gesamte Arbeit durchzieht, vermag sie nicht anzuführen. Mehr noch: Ihre mit Abstand wichtigste Sekundärquelle, Phantasie/Kultur/Politik, widerspricht ihrer Darstellung völlig. Wenn Ende dort eine »Mutation im Denken«87 fordert, so stimmt er Erhard Eppler ausdrücklich zu, der präzisiert:
Wenn eine ganze Kultur in der Weise wie die unsere auf dem rationalen Denken aufgebaut ist, dann kann eine solche Mutation, wie wir sie alle sehen, nicht antirational, nicht irrational sein, sondern sie müßte die Ratio im Hegelschen Sinne wieder aufheben. Das heißt aber auch, sie mitnehmen und aufbewahren […]. Es geht nicht darum, die Aufklärung rückgängig zu machen, sondern die Aufklärung über sich selbst und ihre Wirkungen aufzuklären.88
Mit der aufklärungsfeindlichen Position der Hochromantik läßt sich dies ebensowenig in Einklang bringen wie mit der These vom »Antirationalimus« Endes. Jene »Aufklärung der Aufklärung«, die hier gefordert wird, läßt sich durchaus als deren Vertiefung verstehen. Dazu paßt auch, daß der Venunftbegriff Endes, zumindest nach dem Zeugnis der Unendlichen Geschichte, ein dezidiert positiver ist. Als der Antiquar Koreander keinerlei Erstaunen über Bastians phantásische Abenteuer zeigt, fragt ihn dieser verblüfft:
»Dann glauben Sie mir also?« […]
»Selbstverständlich«, antwortete Herr Koreander, »jeder vernünftige Mensch würde das tun.« (UG 426)
Natürlich gilt es stets zu unterscheiden zwischen der Meinung eines Schriftstellers und jener, die er seinen Geschöpfen in den Mund legt. Tatsächlich entsprechen etwa die abwertenden Bemerkungen Koreanders über Kinder an anderer Stelle (UG 6) mit Sicherheit nicht der Position des Autors. Daß aber Ende diese klassische Figur des Alten Weisen (eng verwandt mit dem Archivarius Lindhorst aus E. T. A. Hoffmanns Der goldene Topf, weitschweifiger mit dem Gandalf von Tolkiens Der Herr der Ringe) mit all seiner eigenen phantásischen und philosophischen Kompetenz ausgestattet hat, erscheint mir unbestreitbar. Die Bemerkung Koreanders ist jedenfalls deutlich genug: Vernünftig ist, wer inneres, »subjektives« Erleben in die Wirklichkeit miteinbezieht (anstatt, wie man anfügen könnte, diese auf materiell faßbare oder erfahrungswissenschaftlich quantifizierbare »Fakten« zu reduzieren)89. Muß noch betont werden, daß dies nie und nimmer eine Flucht ins Ir- oder gar Antirationale bedeuten kann?