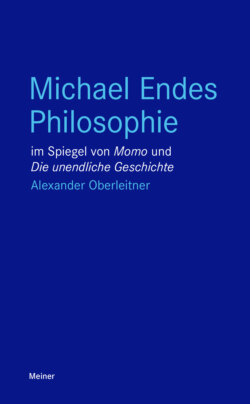Читать книгу Michael Endes Philosophie - Alexander Oberleitner - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.Auswahl bisher vorliegender Veröffentlichungen zum Forschungsbereich
ОглавлениеDie Michael-Ende-Forschung, schon zu Lebzeiten des Autors ein weites Feld, hat nach seinem Tod 1995 noch an Bedeutung zugenommen und ist mittlerweile kaum mehr zu überblicken. Indes geht die überwiegende Mehrzahl jener Untersuchungen, die ein Mindestmaß an Seriosität aufweisen,16 von primär literaturwissenschaftlichen Fragestellungen aus, welche für die vorliegende Arbeit unter Umständen hilfreich, aber letztlich nur von marginalem Interesse sein können. Hierzu sei exemplarisch Claudia Ludwigs Dissertation »›Was du ererbt von deinen Vätern hast …‹ Michael Endes Phantásien-Symbolik und literarische Quellen« (Frankfurt 1997) genannt. Obwohl darin den Einflüssen v. a. fernöstlicher Philosophie auf Endes Werk großer Platz eingeräumt wird, ist es doch nicht die Intention der Autorin, die Verarbeitung dieser Einflüsse durch Ende kritisch zu durchleuchten oder gar nach einer »Philosophie« Endes zu fragen.
Des weiteren gibt es eine Reihe von Arbeiten über Ende, die im Grenzbereich zwischen Literaturwissenschaft und Soziologie anzusiedeln sind, so etwa die Diplomarbeit der Germanistin Eva-Maria Kowatsch, »Zivilisationskritik in Michael Endes Werken ›Die unendliche Geschichte‹ und ›Momo‹« (Wien 1995). Thematisch kommt diese Untersuchung der vorliegenden vielleicht noch am nächsten, ohne aber nach den philosophischen Grundlagen jener »Zivilisationskritik« zu fragen – was freilich auch nicht ihre Aufgabe sein kann. Dennoch nimmt es wunder, wie konsequent Kowatsch die Tatsache ignoriert, daß es sich bei Ende fast ausschließlich um Kapitalismuskritik handelt. Dies bleibt im Rahmen dieses Abschnitts noch zu erörtern.
Eine andere Art von Sekundärliteratur zu Endes Werk bewegt sich zwischen Literaturwissenschaft und Psychologie, wie z. B. Christian von Wernsdorffs »Bilder gegen das Nichts. Zur Wiederkehr der Romantik bei Michael Ende und Peter Handke« (Neuss 1983). Von Wernsdorff versucht u. a., die Verankerung von Endes Bilderwelt in den Grunderfahrungen der menschlichen Psyche aufzuweisen, ein Ansatz, der sich für die geplante Arbeit als nicht unfruchtbar erweisen mag, der aber einer philosophischen Fragestellung natürlich nicht genügt.
Sucht man hingegen nach dezidiert philosophischen Herangehensweisen an Endes literarisches Schaffen, so wird man noch am ehesten bei jenen Autoren fündig, die sich mit dem bereits erwähnten Konnex zwischen Endes Romanen und fernöstlichen Philosophien wie dem Buddhismus oder Daoismus beschäftigen. Vor allem Sôiku Shigematsus »Momo erzählt Zen« (Berlin 1991) ist hier zu nennen. Indes bleibt Shigematsus Buch, bei all seiner Kenntnis von Endes Werk, doch in erster Linie eine Einführung in den Zen-Buddhismus, dessen Grundlagen anhand ausgewählter Zitate aus »Momo« erläutert werden – ganz ähnlich jenem anderen Werk Shigematsus,17 welches Saint-Exupérys »Der kleine Prinz« zum selben Zweck heranzieht. Ein tieferes Eindringen in die Gedankenwelten Endes findet also nicht statt und ist vom Autor auch gar nicht intendiert.18
Diese kurze Zusammenschau mag genügen, um Tilman Schröder zwar nicht grammatikalisch, wohl aber inhaltlich zuzustimmen, wenn er meint: »Eine […] umfassende Würdigung vom Denken Michael Endes steht noch aus.«19 Nicht weniger als eine solche – kritische – Würdigung soll die vorliegende Untersuchung leisten.