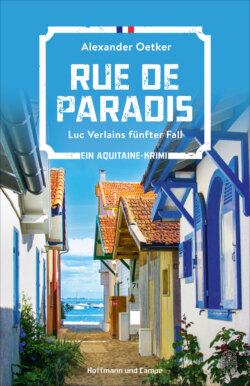Читать книгу Rue de Paradis - Alexander Oetker - Страница 4
Prolog Nacht des 12. März Philippe Deschamps
ОглавлениеEr sah mit sorgenvoller Miene aus dem Fenster, allerdings ohne wirklich etwas erkennen zu können. Es regnete seit Stunden, nein, es regnete nicht, es goss, so heftig, dass es ein einziges Krachen war, Wasser gegen Glas. Weltuntergangsstimmung.
Maire Deschamps war kein Mann, der ohne Grund Besorgnis verspürte. Er trug die Bürgermeisterschärpe des kleinen Ortes seit fast zwanzig Jahren – da hatte er genug erlebt, um ein winziges Problem nicht mit einer großen Katastrophe zu verwechseln. Das hier war nur schlechtes Wetter.
Die Wiederwahl im nächsten Jahr – die zu verlieren, das wäre eine Katastrophe. Obwohl nicht einmal klar war, dass überhaupt irgendjemand den Mumm haben würde, gegen ihn anzutreten.
Andererseits: Er konnte sich nicht erinnern, wann es zum letzten Mal anderthalb Tage durchgeregnet hatte – und zwar so, als seien sämtliche Schleusen des Himmels geöffnet worden.
Der Zivilschutz hatte einige Stunden zuvor den Bericht von Météo France an alle Bürgermeister des Département Gironde verschickt. Darin stand, dass in etwa die gleichen Regenmengen erwartet wurden wie sonst im ganzen Monat Februar – und zwar nur für diesen einen Tag.
Er trank das kleine Glas Rotwein aus, das Brigitte ihm vorhin ins Arbeitszimmer gebracht hatte, dann ging er leise in den Flur, nahm die schwere Öljacke vom Garderobenhaken und stieg in seine dunkelblauen Gummistiefel.
»Du gehst noch raus?«, fragte Brigitte aus dem Wohnzimmer.
»Ja, ich muss zum Leuchtturm, ich will sehen, wie sich das Wetter entwickelt«, rief er zurück.
»Müssen wir uns Sorgen machen?«
»Unsinn«, sagte er.
»Rufst du mich an, wenn du mehr weißt?«
»Natürlich!«
Genervt öffnete er die Tür, und sofort schlug ihm die Gischt des Regens ins Gesicht. Er zog den Reißverschluss der Jacke höher und stapfte hinaus. Unter der weißen Pergola hindurch, am Pool vorbei, über die Terrasse, von der aus sie am Nachmittag noch einen atemberaubenden Blick aufs Meer gehabt hatten, unter tiefblauem Himmel. Nun war nur noch Nacht und Regen.
Er hatte seinen stolzen Range Rover ein paar Meter neben dem Haus geparkt, doch als er endlich auf dem weichen Ledersitz saß, war er bereits komplett durchnässt. Er startete den Motor, und sofort gingen auch die blauen Xenonscheinwerfer an, das scharfe Licht verlor sich in dem Geflirr aus dem ihm fast waagerecht entgegenpeitschenden Wasser, er setzte zurück, die Reifen drehten ein paarmal durch, weil der Boden so aufgeweicht war, dann aber griffen sie doch, und der Wagen zog an, den kleinen Berg und die Rue de Paradis hinunter, links und rechts die Häuser, deren Lichter schwach gelb glommen, müde Zeugen einer düsteren Nacht. In der Senke angekommen, fuhr er an der Kreuzung nach links, es war kein Mensch unterwegs, kein Auto, niemand, kein Wunder, bei diesem Unwetter. Im Radiosender France Inter überschlug sich die Stimme der jungen Ansagerin beinahe.
»Sturm Yvette hat auf seinem Weg von den Kanarischen Inseln deutlich an Kraft gewonnen. Er trifft in diesen Stunden auf Frankreichs Westküste. Es werden so seit langer Zeit nicht mehr gemessene Windgeschwindigkeiten von …«
Wütend stellte er den Sender ab. Katastrophenberichterstattung. Amateure. Er bog nach rechts auf die Départementale 106, die die Halbinsel in der Mitte durchschnitt. Die Scheibenwischer waren kurz vorm Aufgeben, es war ein absoluter Blindflug, doch Philippe Deschamps hoffte einfach, dass seines das einzige Auto war, das in diesem unwirtlichen Moment im Süden des Cap unterwegs war. Wenigstens gelang es ihm, sich an seinem Ziel zu orientieren, denn auf das helle Licht in zweiundfünfzig Metern Höhe war auch bei diesem Wetter Verlass. Es flackerte ringsum, alle fünf Sekunden, ein gespenstisches Bild in gewisser Weise, aber so wusste er, wohin er fahren musste. Nach weiteren zwei Minuten bremste er und parkte den Wagen auf dem Stellplatz, der für die Angestellten des Leuchtturms reserviert war. Er stieg aus und rannte über den schmalen Vorplatz. Das Tor stand offen, also war Albert schon da. Über ihm ragte der Leuchtturm in die Höhe, diese schlanke rot-weiß gestrichene Schönheit, die das Markenzeichen des Cap Ferret war. Sonst standen hier die Touristen Schlange, um später die Aussicht auf die spitze Halbinsel zu genießen. Heute Nacht aber war der Leuchtturm wirklich das, wofür er einst gebaut worden war: ein Lebensretter. Falls sich bei diesem Sturm überhaupt ein lebensmüder Kapitän auf See befand. Deschamps bezweifelte es. Er öffnete die knarzende Metalltür und betrat den düsteren Vorraum. Nur das rote Notlicht glomm matt, es roch nach Moder. Er stieg die Treppenstufen hinauf, der Regen perlte von seiner Jacke und machte auch die steinerne Wendeltreppe zu einem Zeugen der Sintflut draußen. Der Leuchtturm war im Normalfall nicht mehr besetzt. Wie die meisten phares entlang der Küste war er mittlerweile unbewohnt, sein Licht wurde automatisch gesteuert. Nur der Leuchtturm draußen in der Gironde-Mündung, der Phare de Cordouan, wurde auf seinem Gezeiteneiland noch Tag und Nacht von zwei Männern bewacht, deren Hauptaufgabe es allerdings war, die Eintrittskarten der Touristen abzureißen. Hier am Cap Ferret hingegen hatten nur drei Leute den Schlüssel, die ab und zu nach dem Rechten sahen: Albert, der Leiter der Feuerwehr und Wasserwacht, außerdem der Monteur von der Beleuchtungsfirma – und er, Philippe Deschamps, der Bürgermeister der Gemeinde Cap Ferret, einer von elf kleinen Ortschaften, die sich auf der Halbinsel befanden. Je höher Deschamps stieg, sich mit den Händen an den hellen Sandsteinwänden abstützend, desto heftiger pfiff der Sturm. Wie aus Reflex zählte er jedes Mal aufs Neue, wenn er den Leuchtturm erklomm. Er wusste, wie viele Stufen es sein mussten, deshalb fluchte er, weil es diesmal, als er die letzte Treppenstufe nahm, nur zweihundertsiebenundfünfzig waren – er musste sich verzählt haben. Und ausgerechnet jetzt musste er über so einen Unfug nachdenken. Draußen vor der Scheibe war der Panorama-Umgang für die Touristen, doch nur ein Irrer hätte jetzt die Tür geöffnet. Philippe Deschamps hingegen schloss die kleine Tür in der Wand auf und stieg noch drei weitere Stufen empor, bis er in der Lichterhalle stand. Oben zuckte das Leuchtfeuer unter seiner Glaskuppel, darunter, der Bart gekämmt, die Uniformjacke allerdings falsch geknöpft, stand Albert und sah durch sein Fernglas hinaus.
»Na, Monsieur le Pompier«, begann Philippe ironisch, »bist du heute Nacht noch auf einen Einsatz aus, dass du dich so fein zurechtgemacht hast?«
»Sieh doch selbst, Philippe«, sagte der Leiter der freiwilligen Feuerwehr der Halbinsel, »so etwas sehen wir hier nicht alle Tage.«
Er reichte Philippe das Fernglas, und der beugte sich vor und starrte in die Nacht. Es war wirklich unglaublich. Obwohl Vollmond hätte sein müssen, war der Himmel tiefschwarz. Die dicken Schichten der Wolken rasten am Firmament entlang, als würden finstere Mächte sie anschieben. Die Bäume, von denen hier oben nur die Kronen zu sehen waren, wurden hin- und hergeworfen, dass es ein Wunder war, dass sie nicht einfach abknickten.
»Dort«, sagte Albert leise und zeigte gen Westen. »Sieh doch …«
Philippe richtete das Fernglas in die Richtung, die ihm der Feuerwehrmann wies. Westen. Da waren nur noch wenige Bäume, dafür begann ein weißes Feld, von hier oben konnte man meinen, es sei Schnee, doch er wusste natürlich, dass es die Düne war, die dort hinüberführte, erst hoch hinauf und dann wieder steil bergab, dorthin, wo es wieder ganz schwarz war, dort, wo der Ozean begann.
Doch es war gar nicht so schwarz wie vermutet, befand Philippe, der nun mit dem Fernglas die Strecke abfuhr, die er als den Küstenstreifen ausmachte. Es war vielmehr ein weißes Gekabbel, als sei da draußen ein großer Kampf im Gange. Wo sonst die Wellen in ästhetischer Gleichmäßigkeit an den Strand liefen, was von hier oben besonders majestätisch aussah, warfen sie sich jetzt übereinander, drängten gegeneinander, es war ein Auf und Ab – und die Wellen stiegen viel höher, als er es jemals zuvor gesehen hatte.
»Merde«, sagte er leise und spürte Alberts Atem in seinem Nacken. Er wandte sich um.
»Das sieht schlimm aus, wenn du mich fragst«, sagte der Feuerwehrmann. »Und hier … Es ist eine Warnung des Innenministeriums.« Er reichte dem Bürgermeister ein Fax. Der überflog es.
»Wir sollen den Küstenstreifen evakuieren?«, fragte er ungläubig.
»So steht es da.«
»Aber es ist mitten in der Nacht.«
»Der Sturm hat offenbar erst in den letzten zwei Stunden an Kraft gewonnen. Paris sagt, dass ihre Meteorologen ihn so nicht vorausgesehen haben. Zudem sollte er deutlich weiter südlich anlanden. Nun trifft er uns am stärksten.«
Noch einmal hob Philippe Deschamps das Fernglas an, betrachtete eine Weile das Meer, während der Sturm draußen an die Fenster schlug, dass er Angst hatte, sie würden jeden Moment bersten. Dann wandte er sich um und betrachtete lange das dunkle Bassin, das auf der anderen Seite der Halbinsel lag. Erst nach Minuten, in denen keiner der beiden Männer sprach, senkte er das Fernglas wieder und sah den Feuerwehrmann entschieden an.
»Albert, es ist ein Sturm. Ein fieser Sturm, sonst nichts. Wir haben schon schlimmere Sachen überstanden.«
»Ich kann mich nicht erinnern, dass wir so einen Sturm schon mal hatten. Das ist ein waschechter Orkan.«
»Trotzdem. Wir schaffen das.«
»Aber …«, stammelte der Pompier, »aber meinst du nicht, wir sollten etwas unternehmen? Die Anordnung aus Paris ist doch mehr als deutlich.«
Philippe Deschamps schüttelte knapp den Kopf und betrachtete Albert aus zusammengekniffenen Augen. So ein Bär von einem Mann. Fast zwei Meter Körpergröße maß er, hatte Hände, Schenkel und Oberarme wie ein Holzfäller, die Gemeinde hatte eine extragroße Uniform für ihn bestellen – und bezahlen müssen. Dazu das dichte graue Haar, der graue Vollbart, die buschigen Brauen, alles an dem Mann war riesig. Und doch war er eine solche Mimose, dass es kaum auszuhalten war. Philippe fragte sich wieder einmal, wie um alles in der Welt Dominique es mit ihm aushielt, mit so einem Weichei.
»Pass auf, ich sage dir jetzt, wie es ist, mein lieber Monsieur Peronne«, sagte Philippe eine Spur zu laut, doch er hatte das Gefühl, er käme nur so gegen den Lärm an, der von draußen hereinschallte. »Unsere Häuser, meines und auch deines, dürfen nicht da stehen, wo sie stehen. Das weißt du ganz genau. Wenn wir jetzt alle Männer zusammentrommeln, um die gesamte Straße zu evakuieren, dann wird das nicht ohne großes Protokoll ablaufen. Dann rückt die Gendarmerie an, dann müssen wir Berichte schreiben, und dann wird sich der Präfekt auf einmal sehr dafür interessieren, warum es hier in der Naturschutzzone so viele Bauten gibt. Verstehst du? Wir können das nicht machen. Und deshalb gehen wir jetzt nach Hause – oder du gehst wie sonst auch in die Bar in L’Herbe – und morgen früh ist der ganze Spuk vorbei. Verstanden?«
Albert Peronne ließ sich seine Worte offenbar durch den Kopf gehen, er sah zu Boden, als schaffe er es nicht, Philippes Blick standzuhalten. Weichei.
Nach einer Weile nickte er stumm. »Ich hoffe, du hast recht.«
»Was soll denn passieren?«, fragte Deschamps. »Meinst du, dass wir alle absaufen?« Dann lachte er schallend. »Ach, komm, ich kann auch noch ein Glas vertragen. Los, fahren wir.«
Ohne auf den anderen zu warten, nahm er die Stufen der Treppe. Ein Cognac im »L’Escale« am Fähranleger würde ihn wieder aufwärmen. Nach den ersten fünfzig Treppenstufen hielt er inne. Von oben drang eine gedämpfte Stimme zu ihm herab. Er versuchte, den heftigen Wind auszublenden, der von außen das alte Gemäuer umtoste. Albert würde doch nicht seinen Anweisungen zuwiderhandeln? Hatte er das Weichei doch unterschätzt?
Doch dann fing er die paar Worte auf, die ihn beruhigten: »Dominique, weckst du Charlotte, und kommt ihr dann in die Bar am Hafen? Wir warten dort, bis der Sturm aufhört.«
Kurze Zeit später hörte Philippe das Geräusch von schweren Stiefeln auf der Treppe und stieg seinerseits weiter herunter.