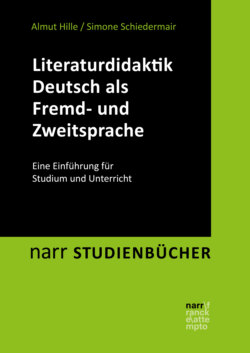Читать книгу Literaturdidaktik Deutsch als Fremd- und Zweitsprache - Almut Hille - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Wie verläuft der Leseprozess?
ОглавлениеDetaillierter betrachtet ist das Lesen ein komplexer interaktiver und konstruktiver Prozess, der auf zwei Teilprozessen beruht: dem Dekodieren und Wiedererkennen von grafischen Zeichen und Wörtern sowie der Bedeutungskonstruktion durch die Lesenden. Im Verlauf des Prozesses kommt es, wie in der aktuellen Leseforschung vorausgesetzt wird, zu interaktiven Wechselwirkungen zwischen beiden Teilprozessen. Von den Lesenden werden nicht nur grafische Zeichen (z. B. Buchstaben) identifiziert und zu Wörtern kombiniert, sondern auch semantische und referenzielle Zusammenhänge zwischen Wörtern, Sätzen und satzübergreifenden Bedeutungseinheiten hergestellt und damit mögliche Bedeutungen eines Textes konstruiert (vgl. Westhoff 1997: 46ff., Bimmel 2002: 115). Für die Bedeutungskonstruktion und damit das Verstehen eines Textes sind nicht nur das Sprachwissen der Lesenden, sondern auch ihr Weltwissen und ihr Wissen um Textfunktionen von Bedeutung (Lindauer/Schneider 2007: 110f.).
Es gibt verschiedene Modelle des Leseprozesses, in denen die zwei Teilprozesse – das Dekodieren und Wiedererkennen von grafischen Zeichen und Wörtern sowie die Bedeutungskonstruktion durch die Lesenden – unterschiedlich gewichtet werden. Außer Frage steht inzwischen jedoch, dass beide in interaktiven Wechselwirkungen zueinander stehen und in der Bedeutungskonstruktion durch die Lesenden Beziehungen zwischen Textsignalen, neuen Informationen und bereits vorhandenem Wissen hergestellt werden.3
Der Leseprozess verläuft auf drei Ebenen, die nicht vollständig voneinander zu trennen sind. Während auf der Wortebene die Phonem-Grafem-Zuordnung und die Worterkennung erfolgen, werden auf der Satzebene sogenannte Propositionen, d.h. kleinere semantische Einheiten analysiert; es kommt zu lokalen Kohärenzbildungen. Auf der Textebene erfolgen globale Kohärenzbildungen; unter Rückgriff auf Textartenkenntnisse können Makrostrukturen gebildet und auch Darstellungsstrategien und mögliche Textintentionen erkannt werden.
In der kognitionspsychologisch orientierten Leseforschung werden im Anschluss an grundlegende Studien seit den 1970er Jahren hierarchie-niedrige bzw. hierarchie-höhere Teilprozesse des Lesens unterschieden. Als hierarchie-niedrig gelten Prozesse wie die Worterkennung sowie die syntaktische und semantische Analyse von Wortfolgen; als hierarchie-höher gelten Prozesse wie die satzübergreifende Analyse von Textstrukturen und die Herstellung globaler Kohärenz unter Rückgriff auf bereits vorhandenes Weltwissen. Den PISA-Tests und dem in ihnen modellierten Begriff von Lesekompetenz liegt die Unterscheidung von textimmanenten und wissensbasierten Verstehensleistungen zugrunde (Hurrelmann 2007: 23).
Fasst man das Lesen nicht vorrangig kognitionstheoretisch, sondern in der weiteren kulturwissenschaftlichen und bildungstheoretischen Perspektive etwa der Lesesozialisationsforschung als „konstruktiven Akt der Bedeutungszuweisung zu einem Text“ (Hurrelmann 2007: 24) auf, wird deutlich, dass neben den genannten Prozessen auch motivational-emotionale und kommunikativ-interaktive Dimensionen zu berücksichtigen sind. Die motivational-emotionale Dimension umfasst die Mobilisierung positiver Erwartungen gegenüber dem Lesen an sich oder den ausgewählten Texten, die erfolgreiche Überwindung von Schwierigkeiten beim Lesen, das Involviertsein beim Lesen (Neugier, Spannung, Genuss) und die Ausbalancierung der entstehenden Gefühle. In der kommunikativ-interaktiven Dimension ist der Austausch mit anderen über das Gelesene, oft auch als Anschlusskommunikation bezeichnet, aufgehoben (Hurrelmann 2007: 24). Motivierend können hier Lektüregespräche sein, die alle Beteiligten als gleichwertige Gesprächsteilnehmer*innen verstehen, wie es etwa im Heidelberger Modell des literarischen Unterrichtsgesprächs vorgesehen ist (vgl. dazu Steinbrenner et al. 2014, Mayer 2017, Heizmann 2018).
Die Lesesozialisation (in der Familie, im Freundeskreis, in Schule, Ausbildung und Studium) ist natürlich auch ein Aspekt, der das Lesen beeinflusst. Zur fremd- und zweitsprachlichen Lesesozialisation liegen bislang kaum Forschungsergebnisse vor. Angenommen wird jedoch, dass die muttersprachliche Lesesozialisation auch Einfluss auf das fremd- und zweitsprachliche Lesen hat: Einstellungen zum Lesen, Erfahrungen und Wertschätzungen werden übernommen (Biebricher 2008: 14).