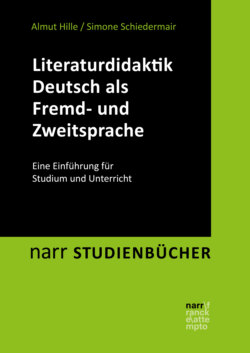Читать книгу Literaturdidaktik Deutsch als Fremd- und Zweitsprache - Almut Hille - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Was unterscheidet das Lesen in der L2 vom Lesen in der L1?
ОглавлениеProzesse wie die Worterkennung und die syntaktische wie semantische Analyse von Wortfolgen verlaufen bei kompetenten Leser*innen in der L1 weitgehend automatisiert. Sie erreichen so eine hohe Lesegeschwindigkeit, auch „Leseflüssigkeit“ genannt. Prozesse wie die satzübergreifende Analyse von Textstrukturen und die Herstellung globaler Kohärenz verlaufen weniger automatisiert. Auch kompetente Leser*innen (in der L1) stehen hier vor immer neuen Herausforderungen, bedingt etwa durch die Komplexität eines Textes, durch semantische Leerstellen oder Textinformationen, die kaum mit dem vorhandenen Weltwissen verknüpft werden können.
Beim Lesen in der L2 sind bereits Prozesse wie die Worterkennung und die syntaktische wie semantische Analyse von Wortfolgen als weitgehend nicht automatisiert zu betrachten. Grafologische Zeichen und Wörter müssen, besonders von weniger kompetenten Leser*innen, mitunter mühsam entziffert werden. Sie lesen Wort für Wort. Die syntaktische Analyse von Wortfolgen, auch eine Voraussetzung für semantische Analysen, kann etwa durch wenig ausgeprägte Kenntnisse der Syntax und des Kasussystems in der L2 Deutsch erschwert sein. Semantische Analysen können Schwierigkeiten bereiten, wenn etwa Wörter nicht in ihren verschiedenen Bedeutungsmöglichkeiten bekannt sind und auch der Kontext nicht für die (korrekte) Erschließung der Bedeutung eines Wortes oder einer Wortfolge genutzt werden kann. Das Erkennen des Kontextes stützt sich auf das verfügbare Weltwissen der Lesenden. Es muss aktiviert und in der Bedeutungskonstruktion auf der Satz- und Textebene mit Textsignalen und (neuen) Informationen aus dem Text verknüpft werden. Beim Lesen in der L2 steckt darin die möglicherweise besondere Herausforderung, bislang erworbenes eigenes Wissen, das – wie in der L1 – auch vom sozio-kulturellen Hintergrund der einzelnen Leser*innen abhängig ist, in Frage zu stellen, zu modifizieren und zu ergänzen. Es müssen neue Zusammenhänge abgeleitet und neue, unbekannte, vielleicht fremd erscheinende Gegenstände in ihren möglichen Bedeutungen erschlossen werden (vgl. zusammenfassend zum Lesen in der L2 Ehlers 1998: 179–186).
Unbestritten ist: Auch kompetentere Leser*innen lesen in der L2 langsamer als in der L1. Auffälligstes Merkmal des Lesens in der L2 ist eine geringere Lesegeschwindigkeit. Empirische Studien zeigen insgesamt eine um ca. 30 % verringerte Lesegeschwindigkeit (Ehlers 1998: 167).4
Eine Grundannahme der fremd- und zweitsprachlichen Leseforschung ist, dass neben der allgemeinen sprachlichen Kompetenz in der L2 und der Verfügbarkeit von (angemessenem) Weltwissen auch die Lesefertigkeit in der L1 einen Einfluss auf die Lesekompetenz in der L2 besitzt. Intensiv wird die Frage diskutiert und in empirischen Studien zu gewichten versucht, welche der Variablen – die allgemeine sprachliche Kompetenz in der L2 oder die Lesefertigkeit in der L1 – größeren Einfluss auf die Lesekompetenz in der Fremd- bzw. Zweitsprache hat. Unterschieden werden die sogenannte Schwellenhypothese und die Interdependenzhypothese (vgl. etwa Ehlers 1998: 111–117).
Die Schwellenhypothese geht davon aus, dass eine bestimmte Schwelle an fremd- bzw. zweitsprachlicher Kompetenz erreicht oder überschritten sein muss, um in der L1 ausgeprägte Lesefertigkeiten und möglicherweise -strategien auf die L2 übertragen zu können. Eine genaue Bestimmung dieser Schwelle ist jedoch kaum möglich, da sie sich unter verschiedenen Bedingungen verändert.
Die Interdependenzhypothese verweist darauf, dass fehlende fremd- bzw. zweitsprachliche Kompetenz durch eine hohe Lesekompetenz in der L1 ausgeglichen werden kann, wenn ein Transfer von Lesefertigkeiten und -strategien von der L1 auf die L2 stattfindet. Eine Studie wie von Christine Biebricher zum Lesen in der Fremdsprache Englisch (2008) zeigt jedoch, dass auch kompetentere Leser*innen in der L2 nicht dieselbe Lesekompetenz wie in der L1 aufweisen. Dies wird auf geringer ausgeprägte Sprachkompetenzen, geringer ausgeprägte Diskurskenntnisse und ein geringeres Ausmaß an Kontakt mit der Schriftsprache in der L2 zurückgeführt (vgl. auch Ehlers 1998: 179–186).