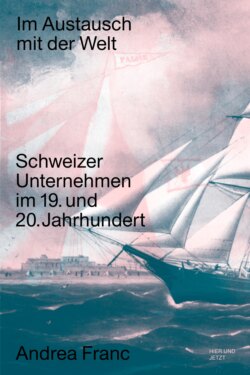Читать книгу Im Austausch mit der Welt - Andrea Franc - Страница 14
Der Triumph des Liberalismus (1830–1869) Die Grundlagen des Wohlstands
ОглавлениеEine der raren internationalen Studien über die Geschichte der Schweiz trägt den Titel «The Triumph of Liberalism» (1988). Der amerikanische Historiker und Professor an der Stanford University, Gordon A. Craig, beschreibt darin vor allem die Rolle Zürichs als Motor der wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Modernisierung, nicht nur der Schweiz, sondern ganz Europas. Die Schweiz sei Vorbild und Labor gewesen für das liberale «nation building» in Europa. Auch für die britischen Freihändler galt die Schweiz als Vorbild. Bürger in den Nachbarstaaten der Schweiz forderten in wiederum schmerzhaften Revolutionen um das Jahr 1830 moderne Nationalstaaten. Derweil bewahrten Schweizer Kaufleute ihr in der Zeit der Kontinentalsperre erworbenes Misstrauen gegenüber ihren europäischen Nachbarn. Sie fokussierten weiterhin auf aussereuropäische Märkte auf dem ganzen Globus. Gleichzeitig verhinderten die politische Souveränität der einzelnen Kantone und das Fehlen eines Zentralstaates die imperiale Expansion. Die Schweiz kolonialisierte als eines der wenigen Länder Europas keine Gebiete im globalen Süden.
Die politischen Unruhen in den Nachbarstaaten führten auch im 19. Jahrhundert zu einem steten Zustrom von politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Flüchtlingen aus ganz Europa, sodass der Schriftsteller Gottfried Keller auf einem Spaziergang durch Zürich ein Sprachengemisch hörte, wie wir es im 21. Jahrhundert kennen. Die europäischen Flüchtlinge waren wiederum zentral für die Bewahrung und Weiterentwicklung der schweizerischen Industrie. Einer von zahlreichen Immigranten war beispielsweise der Apotheker Heinrich Nestle aus Frankfurt, der nach politisch heiklen Aktivitäten mit seiner Burschenschaft in den 1830er-Jahren als Wandergeselle nach Vevey kam und seinen Namen zu Henri Nestlé änderte. Nestlé war Angestellter in einer Apotheke in Vevey und unternahm nebenbei Versuche in einem eigenen kleinen Labor. Nach verschiedenen anderen Produkten und manch gescheiterten Unternehmungen brachte er schliesslich «Henri Nestlé’s Kindermehl» auf den Markt. Dieses Säuglingsmilchpulver legte den Grundstein für den noch heute bestehenden Schweizer Lebensmittelkonzern Nestlé. Nestlés Biografie illustriert nicht nur die liberale Epoche der Schweizer Wirtschaftsgeschichte ab 1830, sondern auch die zentralen Aspekte Immigration, Innovation und die Bedeutung von Bildung, insbesondere im Bereich der angewandten Technologie. So gründete der junge Bundesstaat in Zürich 1855 das Eidgenössische Polytechnikum, die heutige ETH Zürich. Zudem entstanden in dieser Zeit nebst den bereits seit dem Spätmittelalter bestehenden Universitäten Basel und Genf weitere kantonale Universitäten, darunter 1833 die Universität Zürich und 1834 die Universität Bern.
In der als Regeneration bekannten politischen Phase nach 1830 wurde auch ein Grundstein für die hohe Allgemeinbildung in der Schweiz gelegt. Die eidgenössischen Orte schrieben in ihren neuen Verfassungen der 1830er-Jahre die Unentgeltlichkeit der Primarschule für alle Kinder fest. Zudem entstanden Lehrerseminare und weiterführende Sekundarschulen. Im Roman «Leiden und Freuden eines Schulmeisters» von 1838 hat der Berner Schriftsteller Jeremias Gotthelf eine solche Dorfschule beschrieben. Albert Ankers Gemälde «Die Dorfschule von 1848» von 1896 bildet ebenfalls ein Beispiel ab. Diese Klassiker zeigen die Bedeutung des Faktors Humankapital für die wirtschaftliche Entwicklung der Schweiz auf. Denn der wirtschaftliche Fortschritt und der Wohlstand resultierten in vielen Regionen der Schweiz nicht gleichzeitig mit der Einführung der Dorfschulen und der Lehrerausbildung, sondern erst Jahrzehnte später. Humankapital wie Bildung muss über Generationen hinweg aufgebaut, verankert und danach gepflegt und verbessert werden.
Während in Zürich um 1830 ein «goldenes Zeitalter» anbrach und die Moderne Einzug hielt, blieben andere Landesteile, etwa das Wallis, das Tessin oder Bereiche der Innerschweiz, weiterhin in den sozialen und landwirtschaftlichen Strukturen des Ancien Régime verhaftet. Daher hatten die kleinen, industriearmen Kantone auch keine Handelskammern, während die Handelskollegien in Zürich, St. Gallen oder Basel bedeutende Arbeit leisteten. Der als Kulturkampf bekannte Konflikt zwischen der liberalen Moderne und dem katholisch geprägten Konservatismus zeichnete sich in der Schweiz bereits kurz nach 1830 ab. Auch hier war die Schweiz Vorreiterin und nahm mit den Jesuitenkonflikten der 1840er-Jahre und mit dem Sonderbundskrieg 1847 zwischen katholisch-konservativen und liberalen Kräften den Kulturkampf im restlichen Europa um das Jahr 1870 vorweg. 1833 lehnte eine Mehrheit der katholisch-konservativen Kantone der Eidgenossenschaft einen ersten Entwurf für eine Bundesverfassung ab. Erst ein – wenn auch moderater – Bürgerkrieg 1847, die nachfolgende Bundesverfassung von 1848 und Verfassungsrevisionen sicherten 1874 sowie 1891 die föderalen Rechte der einzelnen Kantone ab und stellten ein friedenssicherndes Gleichgewicht her, das dem Kulturkampf in der Schweiz den Wind aus den Segeln nahm. Das in der Bundesverfassung mehrfach verankerte Ständemehr hat auch noch im 21. Jahrhundert bei eidgenössischen Volksinitiativen den Ausschlag gegeben. Es ist sozusagen ein Relikt aus Zeiten, als liberale und konservative Kantone Sonderbünde innerhalb des Schweizer Staatenbundes bildeten und in der Schweiz die Spaltung drohte. Die friedenssichernde Wirkung des Ständemehrs bestätigt etwa der Politökonom Silvio Borner:
Denn im Rückblick auf unsere äusserst erfolgreiche Vergangenheit gibt es zahlreiche Entscheidungssituationen, in denen sich der instinktive Verzicht auf bzw. die systematische Vermeidung von politisch-ökonomischen Anpassungen an veränderte internationale Umweltbedingungen als segensreich erwiesen hat.1
Eine der letzten Sitzungen der eidgenössischen Tagsatzung, 1847.
Die «Dorfschule» von Albert Anker, 1896. Zahlreiche Kantone hatten in den 1830er-Jahren die allgemeine Schulpflicht in ihren Verfassungen verankert.
Als 1870 der Schweizerische Handels- und Industrieverein gegründet wurde, stand vom Bundeshaus lediglich der heutige Westflügel.
Die Industrialisierung schuf eine neue soziale Schicht von Arbeitgebern und Arbeitnehmern mit neuen Bedürfnissen und Anliegen an die staatlichen Rahmenbedingungen. Doch der helvetische Föderalismus – die auch in den 1830er-Jahren weiterhin bestehenden kantonalen Währungen seien nur als ein Beispiel genannt – setzte der Industrialisierung Grenzen und verlangsamte das Tempo des wirtschaftlichen Wachstums. Der Triumph des Liberalismus in der Phase von 1830 bis etwa 1874 wäre nicht möglich gewesen ohne den Einbezug beziehungsweise die Zusicherung von Rechten an die konservativen, landwirtschaftlich geprägten Kantone. Der Einbezug der ländlichen, konservativen Bevölkerung in den staatlichen und damit auch den wirtschaftspolitischen Entscheidungsprozess hat wohl in verschiedenen Belangen, nicht zuletzt in der Europapolitik, eine Spaltung der Gesellschaft oder gar Sezessionsbestrebungen, wie sie in manchen anderen europäischen Staaten an der Tagesordnung sind, verhindert.
Im Übergang vom Staatenbund Schweiz nach dem Wiener Kongress 1815 bis zur Bildung und Gründung des Schweizer Bundesstaates 1848 und dessen Weiterentwicklung 1874 und 1891 wandelten sich die tonangebenden kantonalen kaufmännischen Direktorien von Zürich, St. Gallen, Basel oder Genf, Lausanne und Neuenburg von quasi-staatlichen Institutionen zu privaten Vereinen. Mit dem Rückgang der Zünfte und dem Vormarsch der Handels- und Gewerbefreiheit begann der Aufschwung der freiwilligen Verbände sowohl für Gewerbetreibende wie auch für Industrielle, Arbeiter oder Kaufleute. Während der Bundesstaat Form annahm und seine Kompetenzen und Leistungen ausbaute, wurde die Wirtschaft zunehmend zur Privatwirtschaft. Bereits in den Verfassungsänderungen der 1830er-Jahre hatten zwölf Kantone die Handels- und Gewerbefreiheit eingeführt. 1848 ging das Zollwesen an den Bund über. Mit der Revision von 1874 wurde schliesslich die Handels- und Gewerbefreiheit in der ganzen Schweiz eingeführt und damit die freie Marktwirtschaft in der Bundesverfassung verankert. Weiterhin stand damit die Schweiz als Verfechterin des Freihandels auf dem europäischen Kontinent allein da, und auch als Modell des modernen Verfassungsstaates, wie er heute üblich ist und von zahlreichen Entwicklungsländern während der Dekolonisierungsphase der Nachkriegszeit übernommen wurde, ging sie mit nachhaltigem Beispiel voran.
Mit der Vereinheitlichung des Binnenmarktes und der Währung von 1848 ging eine Welle von Gründungen moderner Geschäftsbanken in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts einher, darunter beispielsweise der Schweizerischen Kreditanstalt in Zürich 1856. Gleichzeitig brachte die Industrialisierung eine neue, moderne Schicht der Arbeiterklasse. Auch diese soziale Gruppe war international durch Ideen und Schriften vernetzt. 1832 revoltierten mit dem sogenannten Usterbrand zunächst Heimweber gegen die Einführung von Maschinen, in den folgenden Jahren kam es an verschiedenen Orten zu organisierten Streiks. Der Kanton Glarus, eine Hochburg der Textilindustrie, erliess bereits 1862 ein Fabrikgesetz, das den 12-Stunden-Tag vorschrieb. Eine wirtschaftspolitische Konstante bildete der Protektionismus in Europa. Auch nach dem Ende der Kontinentalsperre und dem Wiener Kongress blieben die Absatzmärkte Europas für die Schweiz trotz politischen Friedens schwer zugänglich. Nach der Julirevolution von 1830 kam eine leichte Besserung vonseiten Frankreichs, und zumindest die Durchgangszölle wurden aufgehoben. 1834 entstand unter der Führung Preussens der Deutsche Zollverein. Deutschland wurde damit nach Grossbritannien und Frankreich zum drittgrössten Wirtschaftsraum in Europa.