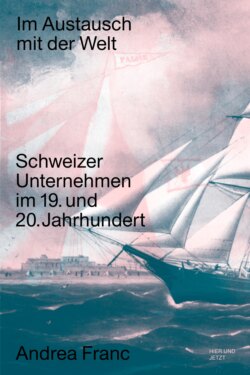Читать книгу Im Austausch mit der Welt - Andrea Franc - Страница 19
Der Schweizer Franken
ОглавлениеSolange die Schweiz ein Bund souveräner Kantone war, lag das Münzregal bei den Kantonen, wobei die Westschweiz Franken verschiedener Münzfüsse und die Ostschweiz den Gulden benutzte. Für Kaufleute herrschte ein äusserst mühsames Währungswirrwarr. Erst die Bundesstaatsgründung 1848 brachte den einheitlichen Schweizer Franken, allerdings gaben weiterhin private Banken Frankennoten aus. Erst 1891 übernahm der Bund das Banknotenmonopol, das er aber erst nach der Gründung der Schweizerischen Nationalbank (SNB) im Jahr 1905 und dem Aufbau des Zentralbankbetriebs ab 1910 ausüben konnte. Ein erster Versuch zu einer eidgenössischen Währung war in der Helvetischen Republik erfolgt. Ab 1799 sollte mit dem Schweizer Franken auf der Basis des Berner Münzfusses die nationale Währung vereinheitlicht werden, was aber auch am Edelmetallmangel scheiterte. Nach der Mediation verfügten die Kantone wieder über das Münzregal. Die Tagsatzung versuchte zwar, einen einheitlichen Münzfuss festzulegen, aber bis zur Münzreform des Bundesstaates kursierten – neben zahlreichen anderen Münzen – Franken von unterschiedlichem Gehalt, Gepräge und Gewicht. Bis 1848 galten in der Schweiz daher kantonale Währungen. Die Zahl der Banken stieg zwischen 1830 und 1850 von 74 auf 171. Der Bund übernahm 1848, wie in der neuen Verfassung vorgesehen, das Münzregal und legte mit dem Franken, der in 100 Rappen aufgeteilt war, die Silberwährung fest. Damals wurde auch die noch heute bestehende Stückelung der Münzen in Fünfliber, Zwei- und Einfränkler sowie in die Rappenmünzen festgelegt. Einzig der Einräppler wurde per Ende des Jahres 2006 offiziell aus dem Umlauf genommen.
Die kriegsbedingte Währungskrise von 1870 verhalf den seit einem halben Jahrhundert von verschiedenen Notenbanken herausgegebenen Banknoten, die zuvor wenig Anklang gefunden hatten, zum Durchbruch. Gegenüber den Währungen der wichtigsten Handelspartner wie etwa Deutschland, Grossbritannien, Frankreich oder die USA, hat der Schweizer Franken stetig an Wert zugenommen. Vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs erhielt man für 100 Schweizer Franken beispielsweise knapp 20 Dollar – im Jahr 2020 erhielt man nur etwa 105 Dollar. Auf eine erste Bewährungsprobe wurde der Franken 1936 gestellt, als ihn die SNB gegen den Willen des Vororts um dreissig Prozent abwertete. Diese Entscheidung erwies sich aber im Rückblick als richtig und hätte sogar früher erfolgen sollen. Eine weitere Probe kam im Januar 1973, als das SNB-Direktorium das Bretton-Woods-System mit festen Wechselkursen verliess. Seit der Einführung des Euro im Jahr 2000 steht der Franken dauerhaft unter Druck; eine Situation, die sich in naher Zukunft nicht ändern wird. Die hohe Bewertung des Schweizer Frankens ist einerseits ein Zeichen für das globale Vertrauen in die politische Stabilität der Schweiz, andererseits für die Schweizer Exportwirtschaft auch eine ständige Herausforderung.