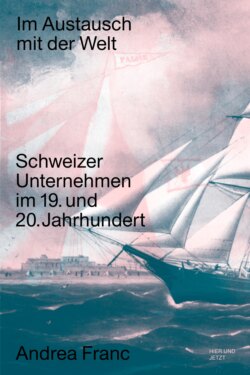Читать книгу Im Austausch mit der Welt - Andrea Franc - Страница 9
Das «Freihandelsabkommen» von Marignano Aussenwirtschaft, Unternehmertum und Bürgerkorporationen
ОглавлениеAls die Genfer Wirtschaftsprofessorin und Präsidentin der neoliberalen Mont Pèlerin Society, Victoria Curzon-Price, zu Beginn des 21. Jahrhunderts gefragt wurde, was denn die Vorteile der Schweiz in der Globalisierung seien, holte sie weit aus: bis zur Reichsunmittelbarkeit der Urkantone Uri, Schwyz und Unterwalden. Die Schweiz sei wohlhabend geworden aufgrund ihrer traditionellen Offenheit gegenüber der Welt und der Wahrung der Handelsfreiheit, so Curzon-Price. Genau diese Freiheit hätten sich die drei Schweizer Urkantone bereits im 13. Jahrhundert erstritten, als sie vom Heiligen Römischen Reich die Reichsunmittelbarkeit erhielten: das Recht, vor keinem fremden Vogt, sondern direkt vor dem Kaiser vor Gericht zu stehen. Wie kommt eine Ökonomin im 21. Jahrhundert dazu, mit der Reichsunmittelbarkeit im Mittelalter die Rolle der Schweiz in der Globalisierung zu erklären? Nun, Ökonomen wissen, dass ein Land «gute» Institutionen braucht, um wohlhabend zu werden und diesen Wohlstand zu bewahren. Im Bestseller «Why Nations Fail» (2012) zeigen Daron Acemoğlu und James A. Robinson anhand zahlreicher Beispiele aus der ganzen Welt und über verschiedene Jahrhunderte hinweg, wie «gute» Institutionen Ländern Frieden und Wohlstand brachten und «schlechte» Institutionen Länder in den Ruin führten. Gemäss Curzon-Price verfügt die Schweiz über vortreffliche Institutionen, um in der Globalisierung zu bestehen, und diese Institutionen hätten sich seit dem Mittelalter herausgebildet. Die traditionell gewachsenen Schweizer Institutionen basierten auf dem ursprünglichen Verständnis von Freiheit als Selbstverwaltung auf möglichst lokaler, tiefster Ebene.
Es ist kein Zufall, dass der Mythos Rütli – so sehr sich Schweizer Historiker schon früh bemühten, Mythos und historische Mittelalterforschung auseinanderzuhalten – in Schriften des Liberalismus und Neoliberalismus zur Referenz wurde. Dies weniger vonseiten liberaler Schweizer Denker, als insbesondere durch Intellektuelle im Exil, die sich in der Schweiz nicht nur mit Reisen und Ferienaufenthalten eine neue Heimat schufen, sondern sich mit der Schweizer Geschichte auch eine neue Vergangenheit aneigneten. Bekannt sind etwa die Treffen der neoliberalen Mont Pèlerin Society in der Nachkriegszeit in Seelisberg, von wo aus die aus den USA angereisten Exilökonomen einen Spaziergang zur Rütliwiese unternahmen. Dieser mythische Ort und die Legende des Rütlischwurs eignen sich einfach zu gut zur Symbolisierung der Freiheitsidee: Kein Königspalast oder Regierungsgebäude symbolisiert das liberale Staatsverständnis, sondern die leere Rütliwiese. Sie darf von allen Menschen jederzeit betreten werden und erwacht auch erst so zum Leben. Die liberalen Kritiker der Zentralstaatsidee stilisierten das Rütli zum Gegenstück des Palastes von Versailles, des Reichstags, des Kremls oder der Verbotenen Stadt in Peking. Zudem war die Rütliwiese nur ein gelegentlicher Ort der Versammlung – und symbolisierte für Liberale nicht nur das Konzept der direkten Demokratie, sondern auch des Föderalismus.
Gegen Ende des 18. Jahrhunderts entdeckten europäische Denker die Schweizer Geschichte mit ihren Mythen und stilisierten die Schweiz zur Wiege der Freiheit. Spannenderweise stimmte auch der Kommunist Karl Marx in die Lobgesänge über die Schweizer ein: «seit fast sechs Jahrhunderten Wächter der Freiheit» seien sie. Die Rütliwiese wurde – in einer eigentlich nicht haltbaren Verknüpfung – zum mythischen Ort des Liberalismus und im 20. Jahrhundert des Neoliberalismus. Dichterinnen und Denker reisten zum Vierwaldstättersee, darunter Germaine de Staël oder Lord Byron. In Deutschland schrieb derweil Friedrich Schiller das Theaterstück «Wilhelm Tell» (1804) und lieferte damit sozusagen das Drehbuch für die republikanischen Revolutionen im Europa des 19. Jahrhunderts. Schillers «Tell» wurde während des Zweiten Weltkriegs am Zürcher Schauspielhaus ununterbrochen aufgeführt. In Deutschland verbot hingegen Hitler das Stück im Jahr 1941. Schiller hat den Eidgenossen auf dem Rütli denn auch die viel zitierten Worte in den Mund gelegt:
Wir wollen sein ein einzig Volk von Brüdern,
in keiner Not uns trennen und Gefahr.
Wir wollen frei sein, wie die Väter waren,
eher den Tod, als in der Knechtschaft leben.
Was bei Schiller unter dem Eindruck der Französischen Revolution und der Napoleonischen Kriege dramatisch als ein Kampf der Eidgenossen gegen die Knechtschaft der Habsburger beschrieben wurde, war jedoch eine für die Verhältnisse der Zeit friedliche und langsame Herausbildung von Institutionen. Vom 13. bis ins 19. Jahrhundert entwickelten sich in den einzelnen eidgenössischen Orten und Städten eine Vielzahl von Selbstverwaltungsformen. Insbesondere in den Urkantonen verwalteten Korporationen Wälder, Weiden, Gewässer oder Wege gemeinsam, daher auch der Begriff «Allmend» für öffentlichen Boden, der allen gemeinsam gehört. Aus diesen Korporationen entstanden politisch autonome Gemeinden, deren alteingesessene Familien die Nutzungsrechte besassen. Zuzüger, Hintersassen genannt, hatten oft keine Bürgerrechte. Erst nach der Gründung des Bundestaates 1848 erhielten alle Einwohner der Schweiz nach mehreren Anläufen das Bürgerrecht einer Gemeinde. In vielen Schweizer Gemeinden bestehen jedoch bis heute Bürgerkorporationen mit ansehnlichem Wald- oder Feldbesitz, der an sogenannten Banntagen abgeschritten wird. Manche Bürgergemeinden betreiben soziale Einrichtungen wie etwa Pflege- und Altersheime. Gleichzeitig ist in der Schweiz aufgrund der korporativen Tradition die politische Gemeinde als kleinste Selbstverwaltungseinheit nicht nur für Land und Infrastruktur, sondern auch für ihre Einwohnerinnen und Einwohner und damit für das Sozialwesen zuständig.
Die Rütliwiese. Fotografie von Werner Friedli, 1948.
Diese Selbstverwaltung auf kleinstmöglicher Ebene entdeckten liberale Denker erst spät, im 20. Jahrhundert, als einen weiteren zentralen Aspekt der «guten» Schweizer Institutionen. Ökonomen im 20. Jahrhundert sprachen von Föderalismus, Dezentralismus oder auch von «small is beautiful». Anstatt gegen die Knechtschaft durch eine Obrigkeit zu kämpfen, wurden in den Schweizer Kantonen Institutionen gegründet, welche die Entscheidungsmacht an der tiefstmöglichen Stelle hielten. Das Beispiel der Gemeindeautonomie hob SHIV-Direktor Gerhard Winterberger in der Nachkriegszeit gerne als Paradebeispiel des Schweizer Staatswesens hervor: Solange eine kleine Gemeinde selbst über ihr Schicksal entschied, konnte keine Obrigkeit Macht über die Gemeinde missbrauchen und umgekehrt konnten selbstverwaltete Gemeinden für ihre Missstände keine Obrigkeit verantwortlich machen. Damit entstand eine spontane Ordnung, in der die jeweils kleinstmögliche Institution oder sogar eine Einzelperson Verantwortung übernehmen musste, was nicht nur zu Frieden, sondern auch zu Wohlstand führte.
In den ersten Jahrhunderten der Eidgenossenschaft bildeten die einzelnen Orte, das heisst Uri, Schwyz und Unterwalden sowie danach Luzern, Zürich, Glarus, Zug und Bern, Bündnisse. Bis 1513 kamen Freiburg, Solothurn, Basel, Schaffhausen und Appenzell dazu. Gesandte dieser souveränen Orte trafen sich bei Bedarf, um Geschäfte zu erledigen. Ab dem 17. Jahrhundert wurde die Versammlung der Gesandten der eidgenössischen Orte «Tag» genannt, woraus sich der Begriff «Tagsatzung» ableitete. Bis zur Gründung des Bundesstaates 1848 war die Schweiz – abgesehen vom Unterbruch durch Helvetik und Mediation zwischen 1798 und 1813 – ein Staatenbund und die eidgenössische Tagsatzung die Versammlung der Staaten, damals Orte genannt. Einer der eidgenössischen Orte hielt jeweils den Vorsitz und lud zur Tagsatzung ein («setzte den Tag»), dieser Ort wurde der «Vorort» genannt. Die Tagsatzung beschäftigte sich unter anderem mit der Absicherung der Handelsrechte der eidgenössischen Orte. Dies vor allem gegenüber Frankreich, der wirtschaftlichen Grossmacht Europas im Spätmittelalter und in der Frühen Neuzeit. Die Willkür Frankreichs konnte die spätmittelalterlichen Orte auf dem Gebiet der heutigen Schweiz teuer zu stehen kommen. Genf, das sich im 15. Jahrhundert Ludwig XI. nicht unterordnen wollte, musste erleben, dass der König den französischen Kaufleuten den Besuch der internationalen Messe in Genf verbot und stattdessen Lyon offiziell als Messestadt einsetzte. Damit verlor unter anderem die freiburgische Tuchmanufaktur ihren Umschlagplatz an der Genfer Messe, was das Ende dieses Industriezweigs in der Saanestadt bedeutete – dies auch, weil England hohe Zölle auf die Wollausfuhr einführte und die englische Wolle zu teuer für den Import nach Freiburg wurde. Der europaweite Freihandel war somit für gewisse Schweizer Regionen bereits im Spätmittelalter bedeutsam. Freihandelsabkommen wurden dann auch zu einem Kerngeschäft der Tagsatzung, die nach der Niederlage von Marignano die Handelsfreiheit der Eidgenossenschaft in der Frühen Neuzeit sicherte.
Marignano ist bekannt für die Schlacht im Jahr 1515, welche die Eidgenossen gegen den König von Frankreich verloren und in deren Nachgang sie auf Expansionskriege verzichteten. Die Niederlage führte zu einem bedeutenden «Freihandelsabkommen». In diesem Ewigen Frieden von 1516 sicherte Franz I. von Frankreich der Eidgenossenschaft freien Zugang zum französischen Absatzmarkt zu. Im Gegenzug durfte Frankreich in den eidgenössischen Orten Söldner ausheben. Die Schlacht von Marignano bildete den Auftakt zu einer mehrere Jahrhunderte dauernden Phase des Freihandels zwischen der Eidgenossenschaft und der damaligen Grossmacht in Europa: Frankreich. Dies war umso wichtiger, als auf den Ewigen Frieden folgend die Reformation nicht nur religiöse, soziale und politische Umwälzungen brachte, sondern auch für die wirtschaftliche Entwicklung der Schweiz bedeutende Folgen hatte. Wirtschaftliche Anliegen, insbesondere die Freiheit der eidgenössischen Kaufleute, waren sozusagen die Triebfeder der Anerkennung der Souveränität der eidgenössischen Orte durch die europäischen Grossmächte und letztlich der Bildung des Schweizer Staates. Die Tagsatzung schickte ad hoc Gesandte etwa an den französischen Königshof, die für die Schweizer Kaufleute intervenierten. Auch zum Westfälischen Frieden von 1648 war der Bürgermeister von Basel, Johann Rudolf Wettstein, ursprünglich nur angereist, um zu erreichen, dass die Basler Kaufleute nicht mehr vor das Gericht des Heiligen Römischen Reichs zitiert würden, sondern einzig der Basler Gerichtsbarkeit unterstünden. Erst ein französischer Gesandter brachte Wettstein auf die Idee, über die Souveränität der Schweiz zu verhandeln. Somit nahm mit dem Westfälischen Frieden von 1648 die Reichsunmittelbarkeit ein Ende und die Souveränität der Eidgenossenschaft, damals noch ein loser Verbund kleiner Orte, ihren Anfang. Nebenbei hob der Westfälische Frieden für die reformierten Gebiete das Zinsverbot der katholischen Kirche auf und legte damit einen frühen Grundstein für den Finanzplatz Schweiz. Die im Westfälischen Frieden garantierte Souveränität war politisch, die Eidgenossenschaft wurde somit erst recht zum Exilland Europas, doch gerade dadurch begann ein wirtschaftlicher Boom sondergleichen. Hugenottische Flüchtlinge aus ganz Europa brachten wirtschaftliche Innovation und Netzwerke in die Schweiz, sodass die Schweiz im 18. Jahrhundert und damit am Vorabend der Französischen Revolution das am stärksten industrialisierte Land Europas war. Aus einem Land der Kaufleute und Söldner war kurz vor der napoleonischen Ära ein Industrieland geworden.
Kaum hatte also die Eidgenossenschaft ihre Ansprüche auf Expansion mit der Schlacht von Marignano im Jahr 1515 aufgegeben, so strömten aufgrund der Reformation umgekehrt gut ausgebildete und unternehmerische Protestanten aus Frankreich, Italien und den deutschen Landen, aber auch aus Ungarn, Spanien oder England in die Schweizer Orte. Diese Glaubensflüchtlinge brachten nicht nur ihr Kapital in Form von Vermögen mit, sondern auch Humankapital in Form von Wissen über Industrie und Finanzwesen sowie Erfahrung. Die innovativen Ideen wurden von den bürgerlichen Mittelschichten aufgenommen, vor allem in Genf, Neuenburg, der Waadt und im Aargau. Weshalb in teure Expansionskriege investieren, wenn Vermögen und Innovation von allein in die Schweiz kamen? Die kantonalen Handelskammern – und somit im weitesten Sinne Economiesuisse – gehen auf Kommissionen zurück, welche die eidgenössischen Orte bildeten, um die Refugianten zu betreuen. In vielen Fällen waren die ersten kantonalen Handelskammern also Wirtschaftskommissionen, die dafür zu sorgen hatten, dass die protestantischen Glaubensflüchtlinge ihr Vermögen und ihr Know-how in der Schweiz optimal zur Geltung bringen konnten. Während die Hugenotten Seidenbandmanufakturen, Bankhäuser und Uhrenwerkstätten eröffneten, blieben die Wirtschaftskommissionen bestehen und stellten die Institutionen bereit, die für eine reibungslose Wirtschaftstätigkeit vonnöten waren. So waren die kantonalen kaufmännischen Direktorien beispielsweise noch bis zum 18. Jahrhundert um den Postdienst besorgt, stellten Regelungen und Schiedsgerichte auf und dienten auch als Förderer von Forschung und Entwicklung, so etwa mit Preisausschreiben, Prämien und Beiträgen. Die kantonalen Handelskammern bildeten sich als Rahmeninstitutionen für die Industrialisierung der Schweiz aus. Das 17. Jahrhundert brachte eine zweite Welle von Flüchtlingen, diesmal hauptsächlich aus Frankreich, wo 1685 der Sonnenkönig Ludwig XIV. das Edikt von Nantes widerrief, das den Hugenotten Schutz garantiert hatte. In dieser zweiten Welle der Verfolgung von Protestanten in Europa kamen allein aus Frankreich innert weniger Jahre über 60 000 Flüchtlinge in die Schweiz, die damals etwa eine Million Einwohner aufwies. Mehrere weitere Tausend folgten aus Italien und Deutschland. Viele von ihnen reisten allerdings weiter in die Pfalz, nach Böhmen oder Preussen.
Aus wirtschaftlicher Sicht waren die Aufnahme von Glaubensflüchtlingen sowie der Ewige Frieden mit Frankreich eine bedeutende Weichenstellung für den Aufstieg der Schweiz zur wohlhabendsten Nation Europas. Noch dominierte die Handels- und Wissenschaftsnation Niederlande, doch dank den hugenottischen Familien wurde die Schweiz zu einem Knotenpunkt in den europaweiten Bank- und Handelsnetzwerken, die sich von Genf über Basel nach Amsterdam und London erstreckten. Im 18. Jahrhundert entwickelten sich in der Ostschweiz und dem Jurabogen die Textil- und die Uhrenindustrie im Verlagswesen, dies teilweise basierend auf den seit dem Mittelalter bestehenden Textilindustrien. Unternehmer belieferten Bauernfamilien mit Rohstoffen wie Baumwolle, die sie aus England importierten, und exportierten die in Heimarbeit hergestellten Baumwollstoffe wiederum nach Europa und in die neue Welt, nach Amerika, Asien und Afrika. Der föderale, auf lokale, tiefstmögliche Entscheidungsgewalt ausgerichtete Staatenbund der Alten Eidgenossenschaft erwies sich als immun gegen die institutionellen Fallstricke, über welche die europäischen Grossmächte in der Frühen Neuzeit stolperten: den Absolutismus und den Merkantilismus. In Frankreich trug der Sonnenkönig Ludwig XIV., der von 1643 bis 1715 absolutistisch herrschte, mit der Vertreibung der Hugenotten und zahlreichen, wirtschaftlichen Verboten zum Niedergang Frankreichs als wirtschaftliche Grossmacht in Europa bei. Doch auch Grossbritannien verbot im 18. Jahrhundert die Verarbeitung von Baumwolle, um die einheimische Fabrikation von Wolle, Leinen und Flachs zu schützen. So wurde die Schweiz im 18. Jahrhundert aufgrund der wirtschaftlichen Fehlentscheide absolutistischer Herrscher und merkantilistischer Planer zeitwiese zum führenden Exportland für Baumwollprodukte. Auch auf intellektueller Ebene hatte sich die Theorie des Merkantilismus europaweit durchgesetzt. Tatsächlich glaubten viele europäische Denker, der Staat müsse die Wirtschaft lenken und Wirtschaftszweige schützen.
Mangels eines obrigkeitlichen Zentralstaates blieb die Schweiz von dieser Plan- und Schutzpolitik verschont und bildete im 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts tatsächlich eine freihändlerische Insel in Europa. Einzig die Berner Handelskammer, der «ständige Kommerzienrat», versuchte sich kurzzeitig mit merkantilistischer Wirtschaftspolitik. Diese brachte jedoch der Berner Wirtschaft keinen Schaden, da sich Bern gleichzeitig als europaweit bedeutendster institutioneller Anleger positionierte und auf dem Londoner Finanzmarkt dermassen erfolgreich war, dass Bern im 18. Jahrhundert kaum Steuern erheben musste. 1798 beschlagnahmte allerdings die französische Armee den Berner Staatsschatz. Während der Berner Grosse Rat bis zur Französischen Revolution vor allem mit Geldgeschäften erfolgreich war, fand die Industrialisierung der Schweiz anderswo statt: in der Ostschweiz sowie im Jura. Bis Mitte des 18. Jahrhunderts erarbeiteten die kaufmännischen Direktorien und Obrigkeiten der verschiedenen eidgenössischen Orte Gewerbegesetze, um für die boomende Textil- und Uhrenindustrie Rahmenbedingungen zu schaffen. Zudem arbeiteten die eidgenössischen Orte zusammen, sodass etwa innereidgenössische Zölle tief gehalten wurden und die Schweizer Manufakturen nicht verteuerten. Die Eidgenossenschaft war im 18. Jahrhundert ein Tigerstaat Europas: Gut ausgebildete Handwerker produzierten zu tiefen Löhnen Konkurrenzprodukte für den Weltmarkt.
Plakat der Wirtschaftsförderung für die Abstimmung zum Uhrenstatut 1961.
Die wirtschaftliche und politische Staatsbildung der Schweiz ging einher mit der Identitätskonstruktion auf ideeller Ebene: Die Schweizer sahen sich selbst als ein Volk einfacher Bauern, das arm war und hart arbeitete, aber «auserwählt» war. Bereits im 15. Jahrhundert, im «Weissen Buch von Sarnen», wird die Geschichte von Willhelm Tell und der Gründung der Eidgenossenschaft als Allegorie auf die biblische Geschichte von David und Goliath erzählt. Die armen, aber frommen, edlen Schweizer Bauern lehnten sich darin gegen die europäischen Feudalherren auf wie der Hirtenjunge David gegen den Riesen Goliath. Der bescheidene Bauer diente als Handlanger direkt dem Herrgott. Während in der Schweiz wie in keinem anderen Land Europas die Industrialisierung und das Finanzwesen Fuss fassten, entstand gleichzeitig die nationale Identität der Schweiz als Land der einfachen Bauern und Hirten. Diese Selbstdefinition trug die Schweiz im Rahmen der Geistigen Landesverteidigung unter der Losung «Schweizerart ist Bauernart» durch den Zweiten Weltkrieg und prägte in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts die Europapolitik. Vorortsdirektor Gerhard Winterberger unterschrieb Briefe an seinen Mentor, den in Genf unterrichtenden Ökonomieprofessor Wilhelm Röpke, mit «Ihr Hirtenknabe» und gab sich damit selbst unumwunden die Rolle Davids. Dass die umliegenden europäischen Grossmächte und die sich gerade bildende EWG Goliath sei, steht ebenso in Winterbergers Schriften: Ein Beitritt der Schweiz zur EWG würde «der Schweiz den Todesstoss versetzen und unsere politische Lebensform auslöschen», schrieb Winterberger 1960. Der «geistige Habitus der Bergbauern» habe die Schweiz erfolgreich durch die Jahrhunderte getragen, während die europäischen Adligen auf die Schweizer als Bauerntölpel heruntersahen, aber eigentlich neidisch waren auf deren Freiheit. Diesen Neid der europäischen Aristokratie auf die freien Schweizer hat Friedrich Schiller in seinem Theaterstück über Wilhelm Tell der Stauffacherin in den Mund gelegt, die ihren Mann anstachelt:
Er ist dir neidisch, weil du glücklich wohnst,
ein freier Mann auf deinem eignen Erb’.
Denn er hat keins.
Vom Kaiser selbst und Reich trägst du dies Haus zu Lehn,
du darfst es zeigen.
Dieses Bild des einfachen Bauern, Hirten oder Holzfällers, der lieber in Armut lebt und hart arbeitet, als vor fremden Vögten niederzuknien, bestimmt bis heute die Wirtschaftspolitik der Schweiz. Die Beschwörung der Widerborstigkeit der einfachen, aber freien Eidgenossen war insbesondere in der Zeit des Absolutismus und der politischen Wirren bedeutsam, als Schweizer Kaufleute sich nicht an die merkantilistischen Schutzgesetze der Grossmächte hielten und exportieren fast zwangsläufig schmuggeln bedeutete. Geschmuggelt haben Schweizer Kaufleute im Ancien Régime nicht nur Indiennes (bunt bedruckte Baumwollstoffe), Uhren und Tabak, sondern auch in Europa verbotene oder zensurierte Bücher. Wirtschaft und Weltanschauung, der Austausch von Waren oder Ideen, waren untrennbar miteinander verbunden. Die Französische Revolution von 1789, die dem Zeitalter des Absolutismus buchstäblich die Halsschlagader durchtrennte, machte den Export von Waren und Ideen aus der Schweiz für die kommenden zwei Jahrzehnte noch lebensgefährlicher. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts waren viele Regionen der Schweiz trotz halsbrecherischer Schmuggeltätigkeit der Schweizer Kaufleute verarmt. Napoleons Wirtschaftsblockade war noch effektiver als seine militärischen Verwüstungen.
Die Französische Revolution brachte nicht nur – wie alle europäischen Revolutionen – innert weniger Jahre Tausende von Flüchtlingen in die Schweiz, sondern auch neue Ideen, die von Schweizer Politikern vertreten und mancherorts freiwillig, mancherorts erst nach dem Einfall französischer Truppen unter Zwang umgesetzt wurden. Im April 1798 löste die Helvetische Republik die Alte Eidgenossenschaft ab. Laut der neuen Verfassung waren alle eidgenössischen Kantone politisch gleichgestellt, und alle über zwanzigjährigen Männer – mit Ausnahme der Juden – erhielten das Aktivbürgerrecht. Die Helvetik, die Umbruchphase zwischen 1798 und der Mediation Napoleons 1803, setzte den vielen verschiedenen, über Jahrhunderte gewachsenen regionalen politischen Abhängigkeiten sowie den unterschiedlichsten Rechtsformen für Einwohner der Schweiz ein radikales Ende. Die Helvetische Republik drohte im Bürgerkrieg zu zerfallen. Die neuste historische Forschung geht davon aus, dass die Mediationsverfassung Napoleons für den Weiterbestand der Schweiz als Staat in Europa verantwortlich ist. Hauptsächlich machte Napoleon die Zentralgewalt in der helvetischen Verfassung rückgängig und verfügte wiederum eine föderale Form, das heisst die Souveränität der Kantone. Es ist somit eine Ironie der Geschichte, dass ausgerechnet der Föderalismus, das Alleinstellungsmerkmal des Schweizer Staates, von einem der blutigsten Diktatoren der europäischen Geschichte bestimmt wurde.