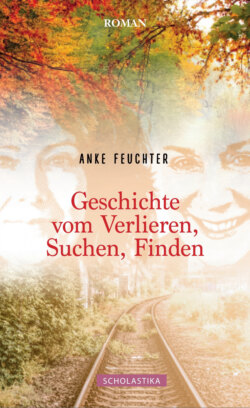Читать книгу Geschichte vom Verlieren, Suchen, Finden - Anke Feuchter - Страница 17
11
ОглавлениеKatrin erwachte mit einem immensen Glücksgefühl in der Brust. Sie sandte einen innigen Gedanken zu Matthieu und hoffte, er würde ihn empfangen. Mit einem Satz sprang sie aus dem Bett.
Die Dusche herrlich, es duftete der Tee, der Toast war knusprig und die Marmelade süß: Katrin war verliebt. Die Welt sang ihr ein Lied.
Colette trat mit geschlossenen Augen vor den Spiegel. Wenn sie sie jetzt gleich öffnete, würde sie das Dorian-Gray-Syndrom einholen: Tränensäcke, tiefe Falten, dunkle Augenringe. Zu viel getrunken, zu wenig geschlafen und zu all dem noch geheult.
Überraschung. Sie sah nicht nur frischer aus als sonst, sondern auch beschwingter. Sie schenkte ihrem Spiegelbild ein Lächeln.
Matthieu griff nach seinem Handy auf dem Nachttisch: Keine neue Nachricht. Katrin hatte ihm keine SMS geschickt. Ein gutes Zeichen. Sie schien keine Klette zu sein. Das sprach für sie, und Matthieu rief sich ihr Bild in sein Gedächtnis, wie sie gestern in den Zug gestiegen war. Er mochte sehr, was er da vor seinem inneren Auge sah. Zufrieden drehte er sich auf den Rücken und streckte wohlig seufzend Arme und Beine aus.
François linste unter seiner Schlafmaske hervor und schaute auf den Wecker. Es war Zeit zum Aufstehen. Der gestrige Abend mit Colette gehörte ins Stundenbuch ihrer Freundschaft. Eine Viertelstunde Extraschlaf gönnte er sich noch. Matthieu würde ihm sicher etwas Kaffee warmstellen.
Johannes war gerädert. Das Formulieren einer Antwort auf Colettes Nachricht hatte ihn die halbe Nacht den Schlaf gekostet und die andere Hälfte dann verfolgt durch wirre Träume. Herausgekommen war dabei noch keine Zeile. Johannes musste sich eingestehen, dass er keine Ahnung hatte, wie er Colette begegnen sollte, und sei es nur via Facebook-Messenger.
Als er vor der dritten Tasse extra starken Kaffees immer noch keine passende Formulierung gefunden hatte, begann Johannes sich zu fragen, warum er nach den Jahrzehnten ihrer Trennung, dieses immer drängender werdende Bedürfnis verspürte, sie wiedersehen zu wollen.
Lange saß er vor den Resten seines Frühstücks und schaute durch das Fenster auf die einsame Linde im Hinterhof, die sich gelb gefärbt hatte. Wie kompliziert war es, Deutscher zu sein, dachte er. Drei Jahre nach dem Krieg geboren. Eltern, die mitten in einem ersten Krieg des 20. Jahrhunderts auf die Welt gekommen waren. Wieso denke ich jetzt daran, fragte sich Johannes. Er wollte doch an Colette schreiben. Hier ging es doch um sein privates Leben und nicht um Schuld und Geschichte. Und doch ging es darum, auch darum, immer wieder.
Oktober 1967. Johannes saß im Zug nach Paris und fühlte sich, als könne er endlich hinter sich lassen, was ihn sein Leben lang, so lang wie er sich jedenfalls erinnern konnte, bedrückt hatte. Dem Deutschsein entfliehen. In eine andere Sprache einziehen, als würde man eine zweite Chance bekommen. Nicht mehr zu jenem Land gehören, das Nazi-Deutschland gewesen war. Nicht mehr im Hörsaal sitzen und sich fragen, ob der Professor vorne auf der Estrade auch einer von denen gewesen war, die Hitler ihren ‚Führer‘ nannten. Nicht mehr die satten Sprüche selbstzufriedener Kommilitonen hören, die verächtlich abwinkten, wenn Johannes auf das Thema Nationalsozialismus zu sprechen kam. Er wollte nicht mehr in Deutschland leben. Er wollte kein Deutscher sein. Wollte sein Deutschsein ablegen. Von Frankreich erhoffte Johannes sich eine neue Identität.
Als er wenige Wochen nach Beginn des Semesters Colette sah, hüpfte sein Herz zum ersten Mal beim Anblick einer Frau. Er hatte sich seit einiger Zeit Fragen gestellt: War er vielleicht schwul?
Nein, war er nicht.
Colettes unbefangene und kecke Art, ihr selbstbewusstes und zugleich nahezu scheues Auftreten schien Johannes ungeheuer begehrenswert. Er wollte diese Frau. Weil sie so war, wie sie war – und weil sie Französin war.
Johannes überwand seine Schüchternheit.
Er holte sich eine rabiate Abfuhr. Weil er Deutscher war.
Colette gab ihm nicht einmal die Gelegenheit, ihr zu erklären, wie er selbst zu seinem Land stand und was seine Meinung war.
„Genau deshalb bin ich doch hier!”, hätte er rufen wollen.
Natürlich tat er dergleichen nicht.
Als sie dann doch ein Paar wurden, war Johannes glücklich.
Sehr glücklich. Er vergaß dennoch nie, dass selbst seine Coco es für eine Hypothek des Schicksals hielt, einen deutschen Pass zu haben.
Warum waren sie 1973 nach Deutschland gegangen? Hätte ihre Liebe weiter bestehen können, wenn er nicht seine Uni-Karriere zu diesem Zeitpunkt als oberste Priorität betrachtet hätte?
Johannes erhob sich endlich und ging auf den Balkon, um in der kühlen Luft tief durchzuatmen. Die morgendlichen Nebel über den bewaldeten Hügeln hatten sich gelichtet. „Dort kochen die Hasen Kaffee”, hatte seine Großmutter früher erzählt. Selbst ihr vertraute er als Erwachsener nicht mehr.
Nein, die Beziehung mit Colette wäre auch in die Brüche gegangen, wenn sie in Frankreich geblieben wären, dessen war sich Johannes sicher.
Er musste nach Deutschland zurück.
Solange Johannes sich nicht mit der Schuld und der Unfähigkeit, eine positive Identität aufzubauen, auseinandergesetzt hatte, konnte er ohnehin nicht mit jemandem leben.
Es war mit den Jahren besser geworden.
Johannes hatte seinen Idealen entsprechend gehandelt und gelebt, stets Position bezogen, auch an der Universität, deren Geschichte im Dritten Reich keine sehr ruhmreiche gewesen war.
„Je suis Allemand”, war für ihn kein quälender Satz mehr, der zwingend einen Nachhall von Scham und Schuldgefühl mit sich brachte.
Jetzt, da er niemanden mehr brauchte, der ihm seine Herkunft verzieh, wurde die Sehnsucht nach Colette so stark, dass er sich nicht vorstellen mochte, sie nicht wiedersehen zu können.
So etwas schrieb man nicht in einer Facebook-Nachricht.