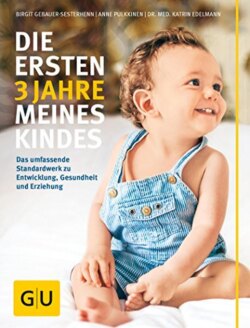Читать книгу Die ersten 3 Jahre meines Kindes - Anne Pulkkinen - Страница 18
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Babys im Fokus der Wissenschaft
ОглавлениеLange hat sich die Hirnforschung erst für Kinder ab dem dritten Lebensjahr interessiert, also ab dem Alter, in dem sie ihre ersten Sätze sprechen können. Heute dagegen stehen schon Neugeborene und Babys im Interesse der Wissenschaft. Dabei haben die letzten 20 bis 30 Jahre erstaunliche Fakten und Ergebnisse ans Licht gebracht. Die 90er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts wurden in den USA sogar zum »Jahrzehnt des Gehirns« ernannt. Und die Hirnforschung ist noch lange nicht am Ziel. Die nahe Zukunft wird für die Entwicklungspsychologie und Frühpädagogik mit großer Wahrscheinlichkeit weitere interessante Erkenntnisse bringen.
Eine rasante Entwicklung
Schon wenige Wochen nach der Zeugung beginnt der Aufbau des Gehirns: Etwa 250 000 Nervenzellen entstehen pro Minute. Bei der Geburt beträgt die Zahl der Zellen etwa 100 Milliarden – fast so viel wie die Sterne der Milchstraße.
Das Gehirn eines neugeborenen Babys wiegt ungefähr 400 Gramm (das entspricht etwa dem Gehirn eines ausgewachsenen Schimpansen). Nach nur einem Jahr ist das Gewicht auf etwa 1100 Gramm gestiegen, bei Fünfjährigen wiegt es sogar schon 90 Prozent eines Erwachsenengehirns (etwa 1350 Gramm). Das Gehirn wächst analog zu den Erfahrungen, die ein Kind macht.
Ein Neugeborenes verfügt bereits über alle erforderlichen Nervenzellen. Gut entwickelt sind all jene, die für die biologischen Grundfunktionen verantwortlich sind, wie Blutkreislauf, Atmung und Reflexe. Die Großhirnrinde dagegen – unter anderem zuständig für Denken, Sprache, Gedächtnis und Mathematik – ist noch unterentwickelt. Damit die erforderlichen Bahnen und Schaltungen der Nervenzellen entstehen können, braucht das Gehirn von Anfang an Erfahrungen, welche die Entwicklung anregen und fördern. Babys und Kleinkinder sind daher auf die Außenwelt angewiesen.
INFO
Das Gehirn als Verkehrspolizist
Das Gehirn leistet in den ersten drei Jahren enorme Arbeit. Da jede neue Erfahrung und Entdeckung synaptische Verbindungen entstehen lässt, aus denen im Lauf der Zeit ein Netzwerk oder neuronales Grundmuster entsteht, müssen neue Erfahrungen und Entdeckungen sortiert und verglichen, geordnet, weitergeleitet und lokalisiert werden. So können Lernspuren entstehen. Die Aufgabe des Gehirns gleicht dabei der eines Verkehrspolizisten, der Autos, Motorräder und Fahrräder koordiniert, ohne die Fußgänger zu übersehen. Wenn die Organisation nicht gelingt (bei Störungen), läuft das Leben ungeordnet – so wie das Verkehrschaos in einer Großstadt bei Ampelausfall und ohne Polizisten.
WIEDERHOLEN IST WICHTIG
Damit neuronale Verknüpfungen entstehen, müssen Babys und Kleinkinder die Möglichkeit haben, immer wieder das Gleiche zu hören, zu spielen oder mit dem gleichen Material zu experimentieren, etwa mit Fingerfarben oder Knetmasse. Fehlt dem Gehirn dieses stete Wiederholen, macht es sich keine Mühe, etwas abzuspeichern, und vergisst. Den Kindern wird bei den Wiederholungen nicht langweilig: Kleine Kinder erfreuen sich vielmehr am immer selben Lied oder Verslein, ziehen selbst stets dasselbe Bilderbuch aus dem Regal hervor.
Vielleicht ist Ihr Nachwuchs schon ein bisschen größer? Dann werden Sie bald erleben, wie der Spaziergang zum Spielplatz oder zum Bäcker zum »Spazierenstehen« wird. Ihr Sprössling will immer auf derselben Mauer balancieren und zum hundertsten Mal die Steine im Vorgarten des Nachbarn sortieren. Kinder unter drei Jahren sind in gewisser Weise eben recht konservativ. Doch nur so lernen sie – so wie aus einem Trampelpfad in einer Wiese nach und nach ein breiter Weg wird, wenn man nur oft genug darübergeht.
Wenn Sie also wieder einmal das Lieblingslied Ihres Schatzes anstimmen, denken Sie daran, dass Sie in diesem Moment einen fundamentalen Beitrag zur Entwicklung seines Gehirns leisten. Auch wenn Sie erfahren, dass die Kleinen in der Kinderkrippe nun schon die vierte Woche hintereinander mit Wasser spielen (richtig wäre: experimentieren), können Sie sicher sein, dass die Erzieherinnen dabei die Erkenntnisse der neuesten Hirnforschung berücksichtigen – und nicht faul sind.
Trotz allem sind Kinder unter drei Jahren auch »Bildungsnomaden«: Sie bleiben in ihrer Entwicklung nicht lange auf derselben Stelle stehen, sondern ihre Interessen und Gedanken ziehen weiter wie Schäfchen, die eine Wiese abgegrast haben. Auf diese Weise bekommt das Gehirn neue Nahrung, und das Lernen geht weiter. Denn so wichtig es für die Entwicklung des Gehirns ist, ein und dieselben Dinge vielfach zu wiederholen: Genauso wichtig ist es auch, ab und zu einmal etwas ganz anderes zu machen als gewohnt. Lassen Sie Ihr Kind doch einmal versuchen, sich die Zähne mit der anderen Hand zu putzen oder rückwärts zu laufen – oder probieren Sie es selbst. Gar nicht so einfach, aber für das Gehirn ist es eine wertvolle Übung.
Zeit zum Kuscheln, Zeit zum Lernen: Bilderbücher »erklären« Kindern die Welt, in der sie leben.
INFO
Der Mensch lernt sein Leben lang
Die alte Binsenweisheit »Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr« hat längst an Gültigkeit verloren. Heute spricht man von Neuroplastizität: Es ist das ganze Leben lang möglich, neue Schaltungen zwischen den Nervenzellen herzustellen. Der Mensch kann bis ins hohe Alter lernen. Zugegeben, mit 60 Jahren fällt es schwerer, eine Fremdsprache zu lernen als mit zehn. Die einst hohe Plastizität (Formbarkeit) der Nervenzellen ist bei Erwachsenen je nach Übungsgrad weniger ausgeprägt. Doch in Rente gehen die Synapsen nie.
Kompetent von Anfang an
Bis weit über die Mitte des vergangenen Jahrhunderts hinaus verglich man Neugeborene und wenige Wochen alte Babys mit unbeschriebenen Blättern und sprach von den »dummen ersten drei Monaten«. Die folgenden Beispiele zeigen jedoch deutlich, dass schon die Jüngsten äußerst kompetent sind:
• Wissenschaftler haben herausgefunden, dass man französische und deutsche Babys am Ton des Neugeborenenschreiens unterscheiden kann. Eine weitere Studie belegt, dass Neugeborene eine Geschichte erkennen, die man ihnen in der Schwangerschaft zweimal täglich vorlas.
• Schon Neugeborene können mimische Gesten nachahmen (zum Beispiel Zunge-Rausstrecken). Die zellulären Vermittler dieses Imitationsverhaltens entdeckten Hirnforscher bereits vor rund 20 Jahren; sie werden Spiegelneuronen (Nachahmneuronen) genannt und ermöglichen es Babys, von Anfang an mit ihren Bindungspersonen zu kommunizieren. Damit sie nicht verkümmern oder ganz verloren gehen, brauchen die Spiegelneuronen stetig »Nahrung« in Form von wechselseitigen Spiegelkontakten.
• Dass Babys akustisch unterscheiden können, ob jemand in ihrer Muttersprache oder in einer Fremdsprache mit ihnen spricht, weiß man schon seit Längerem. Jetzt haben kanadische Forscher herausgefunden, dass sie dies im Alter von vier bis sechs Monaten sogar an den Lippen und an der Mimik ablesen können. Allerdings verliert sich dieses Talent nach dem achten Monat wieder, es sei denn, die Kinder wachsen zweisprachig auf.
• Selbst Neugeborene erkennen ein menschliches Gesicht; sie bringen das »Gesichtsschema« offensichtlich mit auf die Welt. Als Erkennungsmerkmale dienen Augen, Nase und Mund. Zeigt man ihnen eine Punkt-Punkt-Komma-Strich-Zeichnung, weckt diese ihr Interesse. Dreht man das Bild, sind sie irritiert.
• Neugeborene Babys, deren Mütter in den letzten Schwangerschaftswochen viele anishaltige Lebensmittel gegessen haben, reagieren, wenn es um sie herum nach Anis duftet. Sie erinnern sich vermutlich an den Geruch, weil sie im Mutterleib in einem aromatisierten »Aniswasser« geschwommen sind.
INFO
Wettstreit der Synapsen
Die Anzahl an Synapsen, also der Kontaktstellen zwischen zwei Nervenzellen oder einer Nerven- und Muskelzelle, ist beim Zweijährigen größer als beim Erwachsenen. Schließlich weiß das Gehirn am Anfang noch nicht, welche neuronalen Verbindungen das Kind nutzen wird. Doch unter den Synapsen herrscht in den ersten Jahren (und noch einmal während der Pubertät, in der das Gehirn abermals zur »Baustelle« wird) ein knallharter Konkurrenzkampf. Nur jene, die häufig aktiviert werden, überleben; nutzlose Leitungen werden ausgemustert (im Englischen gibt es dafür den schönen Ausdruck »Use it or lose it«). Die Verbindungen, die das Kind nicht nutzt, verkümmern oder verschwinden – so wie der Greifreflex: Neugeborene schließen ihre Hände ganz fest, wenn man ihre Handflächen berührt. Bis zum fünften Monat geht dieser Reflex ins bewusste Greifen über; die ursprünglichen Synapsen werden nicht mehr benötigt. Ein ganz natürlicher Vorgang. Fortschritt ist nicht nur Aufbau, sondern auch Abbau.