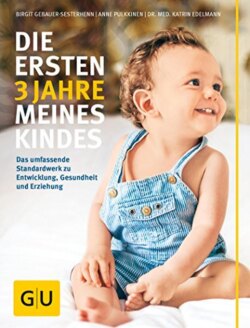Читать книгу Die ersten 3 Jahre meines Kindes - Anne Pulkkinen - Страница 21
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Der Förder-Boom
ОглавлениеDie zweijährige Sarah lebt mit ihren Eltern in einer Großstadt. Ihre Mutter ist halbtags berufstätig, ihr Vater arbeitet bis spätabends. Sarah besucht eine private zweisprachige Kinderkrippe (Deutsch/Englisch), in der es viele unterschiedliche Förderangebote gibt. Um 14 Uhr holt ihre Mutter Sarah ab. Am Montag bringt sie sie direkt zur musikalischen Frühförderung. Am Dienstag fahren die beiden zuerst nach Hause, von wo sie um 15.30 Uhr zur vorbeugenden Ergotherapie starten. Mittwoch und Donnerstag sind ebenfalls fest verplant. Freitagabend, Sarah und ihre Mutter kommen gerade vom Töpferkurs nach Hause, treffen sie eine Nachbarin mit ihrem zweieinhalbjährigen Sohn. Sie erzählt ihnen freudestrahlend, dass sie gerade zwei Stunden im Wald waren. »Dafür haben wir keine Zeit. Aber zum Glück habe ich mit Sarah donnerstags eine Stunde ›Durch unseren Stadtpark‹ gebucht. So kommt sie an die frische Luft und sieht einige Pflanzen und Bäume.«
Zugegeben: Dieses Beispiel ist etwas übertrieben, aber leider doch noch recht nah an der Realität vieler Familien. Eltern wollen das Beste für ihr Kind. Doch spätestens seit den Ergebnissen der Pisa-Studie machen sich viele ernsthaft Gedanken darüber, ob ihr Kleines ausreichend für die hohen Anforderungen unserer Leistungs- und Kompetenzgesellschaft gewappnet ist. Man kann beobachten, dass Eltern ihre Kinder heutzutage immer öfter so früh und so viel wie möglich fördern wollen. Die »Fernsehkindheit« vergangener Generationen ist längst einer »Autokindheit« gewichen: Das Mama-Taxi kutschiert den Nachwuchs von einem Kurs zum anderen. Um ja keine wertvolle Zeit zu verlieren oder gar den Anschluss zu verpassen, müssen die Kinder alle denkbaren Förderangebote besuchen. Man könnte daher durchaus auch den Begriff »Förder-Kindheit« einführen. Dabei sollte Lernen doch ohne Druck und Zwang geschehen. Fachleute meinen, dass Kinder, deren angeborene Entdeckerfreude und Neugierde in den ersten Jahren nicht durch Förderwahn unterdrückt wird, diese Lust am Lernen auch später in der Schule beibehalten.
Schon die Kleinsten können helfen. Sie lernen dabei und werden selbstbewusster: »Schau, was ich kann!«
Weniger ist mehr
Würden Sie einen Kinderarzt danach fragen, könnte seine Diagnose lauten: »Ich beobachte mit Sorge die sich immer weiter verbreitende Epidemie bei den Kleinen – Förderitis.« Politiker und Wissenschaftler dagegen fordern spätestens seit Pisa mehr Bildung und Lernen für Kinder unter drei Jahren. Und tatsächlich schlummert in den ersten Jahren ein enormes Entwicklungspotenzial.
Doch wenn kleine Kinder so viel und leicht lernen, wäre es dann nicht die logische Konsequenz, den Schuleintritt nach vorn zu verlegen? Könnten sie so zum Beispiel eine zweite Sprache nicht ganz leicht nebenbei lernen, anstatt sich als Drittklässler damit zu quälen?
Im Zuge solcher Überlegungen wurden bereits die ersten Kinderkrippen als nonformale Bildungsorte bezeichnet (ein formaler Lernort ist eine Schule). Doch sollten sie wirklich zu offiziellen Lernorten werden? Die Antwort lautet eindeutig »Nein«. Forscher in Windeln brauchen keine ausgeklügelten Lernprogramme – weder zu Hause noch bei der Tagesmutter oder in der Krippe. Und sie brauchen auch keine extra Kurse. Die neueste Hirnforschung beweist sogar eindeutig, dass zu viel Förderung, besonders unter Druck und ohne Spaß, genau das Gegenteil bewirken kann: Das Lernen im Gehirn wird blockiert beziehungsweise Erfahrenes nicht gespeichert. Genau wie die mangelnde Stimulation (Deprivation) führt auch die Reizüberflutung je nach individuellem Typ zu einer dauerhaften Schädigung (geistige Rückentwicklung, Regression). Kein Wunder: Pausen- und gnadenlose Förderung wirkt sich auf Kinder nicht weniger negativ aus als Stress und Dauerbelastung am Arbeitsplatz auf Erwachsene. Das Gehirn gerät in Unruhe und Erregung, wenn es unter Zwang, Angst, Verunsicherung und Druck lernen soll.
Wenn über Bildungsförderung für unter Dreijährige gesprochen wird, müssen vor allem auch folgende Punkte beachtet werden, weil sie die Basis bilden, die Lernen erst möglich machen:
Geborgenheit
Sicherheit
Vertrauen
Bindung
Darüber hinaus ist es wichtig, dass Eltern ein Bewusstsein für die Entwicklungsschritte ihres Nachwuchses entwickeln. Genug Zeit und eine abwechslungsreiche (Lern-)Umgebung tragen ebenfalls zu Bildung und Lernen bei. Individuelle Förderung bedeutet demnach für Eltern nichts anderes, als sich täglich Zeit zu nehmen, um gemeinsam mit dem Baby zu spielen. Nur ein Kind, das sich sicher fühlt und geliebt wird, kann lernen.
Kneten, Mehl auf den Boden rieseln lassen, ab und zu auch mal probieren: So macht Lernen Spaß.
IM ALLTAG LERNEN
Jüngere Kinder lernen und bilden sich ganz oft in gewöhnlichen Alltagssituationen: Lassen Sie Ihr Kind zum Beispiel, sobald es dies selbst kann, Teller und Besteck zum Tisch tragen (das schult Ordnung und mathematisches Verständnis), die Wäsche sortieren (kognitive Fähigkeit), Obst und Gemüse schneiden (Feinmotorik) oder im Garten Blumen einpflanzen (Alltagsfertigkeiten). Geschieht dies alles in einer entspannten, freundlichen Atmosphäre und mit sprachlicher Begleitung, tun Sie viel für die geistige Bildung Ihres Kindes.
Bei der richtig verstandenen Förderung sind Herz und Verstand gefragt. Eine stabile emotionale Bindung ist die Basis für das frühe Lernen, sei es zu Hause, in der Krippe oder bei der Tagesmutter. Erwachsene brauchen keine Experten sein, sondern lediglich Entwicklungsbegleiter und Assistenten. Helfen Sie daher nicht zu vorschnell, damit Ihr Kind es erst einmal selbst probieren kann. Unterstützen Sie es aber liebevoll, wenn es nicht weiterkommt. Und beantworten Sie seine neugierigen Fragen einfühlsam und aufmerksam.
Es ist zwar gewiss nicht immer eine leichte Aufgabe, die richtige Balance zwischen der Eigenaktivität des Kindes und der Herausforderung vonseiten der Eltern zu finden. Aber die Mühe lohnt sich auf jeden Fall.
WAS BEDEUTET BILDUNG UNTER DREI?
Vor etwa 200 Jahren führte Wilhelm von Humboldt (1767–1835) den Begriff der »Bildung« in der deutschsprachigen Pädagogik ein. Jetzt hat die Bildung auch die unter Dreijährigen erreicht, und damit stehen viele Eltern unter Druck: Wie viel Förderung brauchen Babys und Kleinkinder? Die Devise lautet: Fördern ja, aber spielerisch mit Kopf, Herz und Hand.
Die 16 Monate alte Larissa zum Beispiel baut aus bunten Bauklötzen einen Turm – Stein auf Stein. Der vierte Baustein sitzt, die Statik stimmt noch. Der fünfte jedoch bringt den Turm zum Einstürzen. Die junge Baumeisterin beginnt von vorn. Ihr Freund Simon, zwei Jahre, sortiert währenddessen die Wäscheklammern nach Farben. Die beiden Kinder setzen sich mit der Welt auseinander und bilden sich dabei. Bildung, besonders im Alter unter drei Jahren, lässt sich nämlich durch drei einfache Worte definieren: die Welt verstehen. Einige Bildungsforscher sprechen von der Selbstbildung zur Aneignung der Umwelt. Das Kind bildet sich selbst.
Junge Kinder entwerfen wie echte Forscher Hypothesen über die Welt und überprüfen sie anschließend. Sie sind von Geburt an fähig, sich geistig mit der Welt auseinanderzusetzen. Aus den Erfahrungen, die sie machen, schaffen sie die »Grammatik des Lebens«: Durch Beobachten lernen Kinder zum Beispiel, dass man sich grüßt, wenn man anderen Menschen begegnet. Man sagt »Guten Tag«, »Grüß Gott«, gibt sich die Hand, küsst sich oder reibt die Nasen aneinander – je nachdem, wo man wohnt.