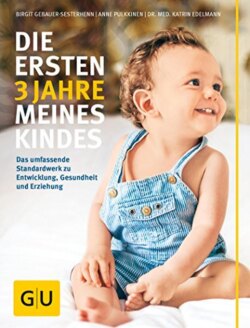Читать книгу Die ersten 3 Jahre meines Kindes - Anne Pulkkinen - Страница 20
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Früh übt sich
ОглавлениеGehirnentwicklung, Bindung und Lernen sind voneinander abhängig und müssen daher in den ersten drei Jahren in engem Kontext betrachtet werden. Dabei ist es für die (spätere) Leistungsfähigkeit des Gehirns entscheidend, welche vorgeburtlichen Erfahrungen das Kind gemacht hat und wie das unmittelbare soziale Umfeld nach der Geburt aussieht (Bonding und Bindung, >). Bildung beginnt am ersten Tag – und gerade auf den Anfang kommt es an. Das zeigt beispielsweise eine amerikanische Studie aus der Mitte der 70er-Jahre des vorigen Jahrhunderts. Darin wurden Eltern gefragt, wann ihre Babys ihrer Einschätzung nach die Welt (Umgebung) wahrnehmen könnten. Die wenigsten antworteten, dass ihr Kind dies bereits mit zwei Monaten täte. Als die Forscher zu einem späteren Zeitpunkt die Entwicklung aller Studienteilnehmer untersuchten und verglichen, stellte sich jedoch heraus: Die Kinder, deren Eltern von der frühen Auffassungsgabe ihrer Babys überzeugt waren, waren auch am weitesten entwickelt, weil sie durch angemessene Anregungen frühzeitig genug »Futter« für das Gehirn erhalten hatten.
Lernen mit allen Sinnen
Anders als beim Erwachsenen, der auch über Wissensvermittlung lernt, ist das frühkindliche Gehirn für aktives Lernen und Erkunden geschaffen. Damit sich neue Strukturen, Vernetzungen und Bahnen entwickeln können, muss es zudem möglichst gleichzeitig auf unterschiedliche Arten angeregt werden – zum Beispiel durch die Stimulation des Sinnes-, Bewegungs- und Emotionszentrums. Und: Studien zeigen, dass ein positiver emotionaler Kontext – freudige, erregte Grundhaltung – den Einspeicherungsvorgang im Gehirn unterstützt. Wenn Sie also mit Ihrem Kind singen oder ihm eine Fantasiegeschichte erzählen und Sie sich dazu beide bewegen (zum Beispiel im Takt schunkeln oder auf den Knien reiten), kommt das einem regelrechten Gehirnjogging gleich.
Durch Fernsehen oder spezielle Lern-DVDs für Babys wird der Nachwuchs dagegen nicht klüger. Es fehlt die Stimulation des emotionalen und sozialen Zentrums; statt etwas zu erleben, sind die Kleinen nur passive Zuschauer. Dadurch fehlt ihnen, was die Engländer so treffend mit »Learning by doing« bezeichnen. Es ist, als würden Sie als Beifahrer an einen unbekannten Ort chauffiert. Müssten Sie die Strecke eine Woche später selbst fahren, hätten Sie höchstwahrscheinlich Orientierungsprobleme.
Amerikanische Untersuchungen zeigen sogar, dass langer und unkontrollierter Fernsehkonsum in den ersten drei Jahren das spätere Lernen negativ beeinflussen kann. Die »TV-Kinder« haben im Vorschulalter kognitive und sprachliche Defizite, bewegen sich weniger und zeigen weniger Interesse daran, sich aktiv mit ihrer Umwelt auseinanderzusetzen. Kein Wunder, sie waren ja lange Zeit nur passiv beteiligt.
Schlaf schützt vor zu vielen Reizen
Babys und kleine Kinder lernen den ganzen Tag viel – und vieles gleichzeitig. Daher ist die Frage, ob es für das Gehirn nicht irgendwann zu viel wird, durchaus berechtigt. Doch die Sorge ist unbegründet. Wenn Kinder nicht zum Lernen gezwungen werden und sie in einer abwechslungsreichen Umgebung (aber ohne Reizüberflutung) aufwachsen, verfügen sie über eine natürliche Schutzfunktion, damit ihr Gehirn nicht überlastet wird: Sie schlafen viel.
Je jünger der Nachwuchs ist, desto mehr Schlaf braucht er. Bedenken Sie nur, was ein Krabbelkind allein zwischen dem morgendlichen Aufwachen und dem Vormittagsschlaf alles entdeckt und erprobt. Diese Erfahrungen werden beim Schlafen, genauer gesagt in der Traumschlaf- oder REM-Phase (>), verarbeitet; das Gehirn selbst schläft dabei nicht, sondern arbeitet fleißig weiter.
Sicher haben Sie auch schon einmal beobachtet, dass sich Ihr Kind nach einem intensiven Spiel (Spiel, Forschung und Lernen sind synonyme Begriffe für das frühkindliche Tun) kurz hinlegt und ausruht.
Wo bleiben die Erinnerungen?
Babys und Kleinkinder lernen in kurzer Zeit enorm viel. Das junge Gehirn kann viele Informationen speichern und wieder abrufen. Aber warum können wir Erwachsene uns nicht an diese wichtige Zeit erinnern? Wie waren unsere ersten Schritte? Wann habe ich mit dem Sprechen begonnen? Wann konnte ich auf einem Bein stehen? Wann habe ich keine Windeln mehr gebraucht? An die Kindergartenzeit haben wir zumindest vage Erinnerungen, zum Beispiel an die nette Erzieherin namens Minni oder Raphael aus der Igelgruppe. Ab fünf wird es dann immer konkreter: Den ersten Zahn habe ich im Urlaub verloren, am ersten Schultag trug ich ein rotes Kleid, meine beste Freundin hieß Anna und hatte lustige Sommersprossen …
INFO
Das Leben hinterlässt Spuren
Hirnforscher haben festgestellt, dass das Gedächtnis viel mehr von den Erfahrungen (Umwelt) gesteuert wird als von den Genen (Anlage). Bei der Geburt kennt unser Gehirn keine Grenzen: Wir können in jede Kultur und in jede Sprache hineinwachsen, passen uns jeder Umgebung an – egal ob wir als Kind in einem afrikanischen Dorf oder in einer europäischen Großstadt aufwachsen. Der Nachteil dieser Anpassungsfähigkeit ist, dass auch schlechte oder mangelnde Erfahrungen das Gehirn prägen. Wie ein Daumenabdruck in einem Stück Knetmasse hinterlässt jede Begegnung, jede Interaktion ihre Spur. Mit der Zeit lässt sich die Knete jedoch immer schwerer formen – und das kann dazu beitragen, dass Lernen immer schwerer fällt.
INFANTILE AMNESIE UND AUTOBIOGRAFISCHES GEDÄCHTNIS
Die »Unfähigkeit«, sich an die ersten drei bis vier Jahre zu erinnern – Wissenschaftler bezeichnen dieses Phänomen als infantile Amnesie –, wird mit voranschreitendem Alter nach und nach vom autobiografischen Gedächtnis abgelöst. Dieses wird immer dann weiter ausgebildet, wenn das Kind das Gefühl hat, es hat selbst etwas erlebt (dieser Schritt hängt mit der Sprach- und Ich-Entwicklung zusammen und beginnt in der Regel ab dem 18. Lebensmonat). Die bewusst erlebten Erinnerungen hinterlassen ihre Spuren.
Um diese Spuren im Gedächtnis zu bilden, braucht das Kind sprachliche, soziale und emotionale Begleitung. Als Eltern können Sie diesen Prozess unterstützen, indem Sie Ihrem Kleinen zum Beispiel beim Mittagessen erzählen, dass Sie mit ihm heute Vormittag auf dem Spielplatz waren. Vielleicht versteht Ihr Kind noch nicht, was »heute Vormittag« bedeutet (das kann es erst mit etwa zwei Jahren). Nichtsdestotrotz hat es das Gefühl, bewusst etwas erlebt zu haben, und dadurch wächst sein autobiografisches Gedächtnis. Wenn Sie beim Frühstück darüber reden, dass Sie gestern alle bei der Oma waren und dass es dort einen leckeren Erdbeerkuchen gab, löst dies bei Ihrem Kind gleich auf mehreren Ebenen Erinnerungen aus: mit Oma kuscheln (emotional und sozial), Duft der Erdbeeren (riechen), Geschmack der Torte (schmecken) … Es »erlebt« den Besuch bei der Oma ein zweites Mal – und speichert ihn. Aus diesem Grund ist auch das allabendliche Gespräch vor dem Einschlafen so wichtig. Über vergangene Ereignisse zu sprechen hinterlässt Spuren im Gehirn, der Trampelpfad zum autobiografischen Gedächtnis wird dabei immer breiter, die Straßen werden immer stärker befahren.