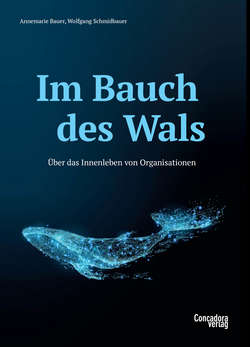Читать книгу Im Bauch des Wals - Annemarie Bauer - Страница 32
Erzwungene oder gewählte Ziele
ОглавлениеHierarchische Traditionen stecken in jeder entwickelten Kultur. Wenn es darum geht, schnell zu entscheiden, wo Rücksicht gefährlich – da zeitraubend – ist, wie im Krieg oder im Einsatz von Polizei und Feuerwehr, hat nach wie vor der schlichte Gehorsam seinen Platz. Aber ebenso wie der Feuerwehrkommandant seine Arbeit schlecht macht, wenn er angesichts eines brennenden Hauses zeitraubende Debatten zulässt, macht er seine Arbeit auch schlecht, wenn er in der Nachbesprechung der Einsätze solche Debatten verbietet, weil er sich angegriffen fühlt.
Die Verführung der Hierarchie zielt auf die menschliche Grandiosität, den Narzissmus, den unfehlbaren Tyrannen, der in jedem von uns steckt, oft am meisten in denen, die ihn hinter klingenden Worten vom „gemeinsamen Auftrag“ und der „Sache der Nation“ verbergen. Wenn Menschen Macht angeboten wird, sind sie verführt, diese zu missbrauchen. Jede hierarchische Position enthält dieses Angebot.
Kaum weniger tyrannisch sind daneben jene, die jede Machtausübung, jede Form von Autorität entwerten: Sie seien über derlei erhaben, und dürften daher auf alle herabblicken, welche nicht so frei von Machtgier sind wie sie selbst.
Die Geburt der Hierarchie aus dem Krieg und der Religion macht verständlich, dass es die viel später auftretende Sachautorität bis heute immer wieder schwer hat, sich durchzusetzen. In der Entwicklung der Industriegesellschaft ist das den Ingenieurswissenschaften und der Medizin gelungen. Kein Verwaltungsbeamter oder Theologe wird heute noch überzeugt sein, er könne angesichts der Konstruktion einer Brücke oder der Durchführung einer chirurgischen Operation seine Autorität ins Spiel zu bringen, um die Entscheidung eines ihm dienstlich untergeordneten Statikers oder Chirurgen infrage zu stellen.
Aber wenn wir uns die Diskussion in einem Jugendamt zwischen einem Verwaltungsjuristen und einer Sozialpädagogin über eine Frage der Familienhilfe vorstellen, sind wir nicht mehr so sicher, dass der Jurist nicht einmal daran denkt, die Expertenschaft seiner Mitarbeiterin infrage zu stellen. Noch ausgeprägter ist diese Problematik in der Krankenpflege, wo viele Ärzte nach wie vor überzeugt sind, dass sie auch in pflegerischen Fragen das letzte Wort haben müssen und die Vertreterinnen eines Expertentums in Pflegewissenschaft um ihre Anerkennung ringen.
Natürlich würden sowohl der Arzt wie der Jurist abstreiten, dass sie absolute Autorität beanspruchen; es gehe schließlich allein um die Sache. Aber wer die Definitionsmacht besitzt, der entscheidet auch, welchen Inhalt und welche Grenzen die „Sache“ hat. Damit behindert er alle, denen er eine vergleichbare Definitionsmacht abspricht, in der Entwicklung gemeinsamer Ziele.
Solche gemeinsamen Ziele sind aber eine wichtige Voraussetzung, dass moderne Institutionen funktionieren können: Nur so werden alle sachdienlichen Informationen gesammelt und gebündelt.