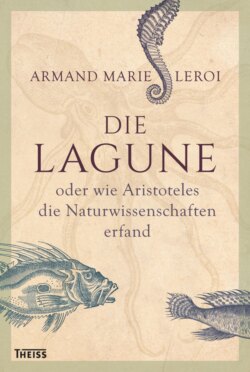Читать книгу Die Lagune - Armand Marie Leroi - Страница 54
На сайте Литреса книга снята с продажи.
XLI
ОглавлениеIndem ich Aristoteles zu seiner erfolgreichen Ordnung der Tiere beglückwünschte, habe ich jedoch das Problem übergangen, mit dem ich begonnen hatte – nämlich, ob sein Projekt im Kern ein taxonomisches war. Die Zoologen des 18. und 19. Jahrhunderts waren dieser Meinung. Wir sollten sie nicht beim Wort nehmen. Sie suchten einen schillernden Vorläufer. Es gibt Gründe, daran zu zweifeln, ob er tatsächlich so etwas war.
Im Gegensatz zu dem, was Cuvier sagt, stellt Aristoteles niemals etwas wie eine zusammenhängende, umfassende Klassifikation auf, in der jedes Tier seinen Platz hat. Weiterhin mag er zwar die Hierarchie der Natur erfasst haben, benennt aber ihre Ebenen nicht: Von Rasse bis Reich reicht ihm der Begriff genos. Er sagt uns auch nicht, wie wir eine Sorte von einer anderen unterscheiden können, und er ist furchtbar unbeständig, was Namen angeht. Zu Aristoteles’ Zeiten waren gesalzene Sardina pilchardus und Sprattus sprattus ein Grundnahrungsmittel an der Ägäis, aber er erwähnt weder die sardella noch die papalina, da beides römische Namen sind. Stattdessen schreibt er von den membras, den chalcis, den trichis, den trichias und den thritta, alles offenbar Heringsfische, aber ob Sprotten, Sardinen oder Heringe (um die ebenso unterbestimmten deutschen Namen einzuführen), ist schwer zu sagen, da er uns kaum Hinweise auf ihre Identität gibt. Seine höheren Taxa sind dürftig. Er erkennt, dass Schlangen und Echsen irgendwie verwandt sind, hält sich aber nicht damit auf, ihnen einen Familiennamen zu geben. Er vergisst, uns zu sagen, ob Fledermäuse Vögel oder Vierfüßer oder wieder etwas anderes sind. Er gibt keine diagnostischen Merkmale an, anhand derer sich eine Sorte praktikabel definieren ließe; schreibt nicht: »Ein Fisch ist ein Tier, das Kiemen + Schuppen + Flossen etc. hat«, sondern nur: »Fische sind eine Sorte« in der Annahme, dass jeder weiß, was ein Fisch ist. Vergleicht man die unermüdlichen Listen und Tabellen der Namen und Definitionen in Systema naturae mit den narrativen Diskursen der Historia animalium, wird schnell klar, dass hier sehr unterschiedliche wissenschaftliche Agenden am Werk waren.
Aristoteles scheint nur dann zu benennen und zu klassifizieren, wenn ein anderer Zweck dies verlangt. Er sagt es sogar selbst. Bei der Beschreibung von Tieren könnten wir, sagt er, immer einzeln über einen Spatz oder einen Kranich sprechen, aber »da dies dazu führt, dass wir viele Male über dieselbe Eigenschaft reden, weil sie so vielen Dingen gemein ist, ist es in dieser Hinsicht etwas töricht und ermüdend, über jedes [Tier] einzeln zu sprechen.« Es ist schlicht viel einfacher, größere Gruppen von Tieren zu besprechen, die vieles gemeinsam haben.
Aber wenn Aristoteles’ deskriptive Biologie weder Plinius’sche Naturgeschichte noch Linné’sche Taxonomie ist, worum genau geht es dann in ihr? Einen Hinweis gibt die Struktur von Historia animalium selbst. Zu Beginn des Buches überlegt er, wie er seine Daten auf eine Art Ordnung reduzieren kann. Das Problem, dem er gegenübersteht, ist jedem Zoologen bekannt: Soll er sie nach Taxon (also Reptil, Fisch, Vogel) ordnen oder nach Merkmal (also Fortpflanzungssystem, Verdauungssystem, Verhalten, Ökologie)? Seine (vernünftige) Lösung besteht in einem Kompromiss: »Tiere unterscheiden sich voneinander in ihrer Art der Versorgung, in ihren Gewohnheiten und in ihren Teilen. Über diese Unterschiede werden wir erst in allgemeinen Begriffen sprechen und sie dann mit engem Bezug zu den einzelnen Sorten behandeln.«
Er beginnt mit einer allgemeinen Synopse, wobei er besonderes Augenmerk auf die Menschen legt, seine Modelllebewesen. Dann beschäftigt er sich mit der groben Anatomie der Bluttiere: Gliedmaßen, Haut, sekundäre Geschlechtsmerkmale, Verdauungssystem, Atmungssystem, Ausscheidungssystem. Anschließend betrachtet er die blutlosen Tiere System für System, und kehrt dann für einen Blick auf ihre Sinnesorgane, die Geräusche, die sie erzeugen, und wie sie schlafen, wieder zu den Bluttieren zurück. Es folgen zwei Bücher über Fortpflanzungsorgane und entsprechende Verhaltensweisen, geordnet nach Bluttieren und blutlosen Tieren, ein Buch zu Gewohnheiten und Lebensräumen, eins zum Verhalten und schließlich ein Buch über die menschliche Fortpflanzung. Am Ende wird offensichtlich, dass er eine vergleichende Zoologie aufgebaut hat – die erste.
Er sieht sich Füße an und beschreibt, wie einige der lebend gebärenden Vierfüßer mit Blut (Säugetiere) viele Zehen haben (Mensch, Löwe, Hund, Leopard) während andere (Schaf, Ziege, Hirsch, Schwein) gespaltene Füße mit Klauen anstelle von Nägeln haben und andere (Pferde) einen einzigen massiven Huf. Woanders untersucht er Fischeingeweide. Neben dem üblichen Magen und Darm haben viele Fische pylorische Blindsäcke, die die aufnahmefähige Oberfläche des Dünndarms erhöhen. Er beschreibt, wie sie in Anzahl und Position variieren. An einer anderen Stelle betrachtet er die Verteilung des Geruchssinns und so fort. All dies ist ein Vorläufer nicht der großen systematischen Monografien wie Cuviers Poissons, sondern eher seiner Anatomie comparée oder Owens Vertebrate Zoology (1866), in der die Tiere in Stücke geschnitten werden. Man kann Aristoteles zu den Füßen der Vierfüßer oder den Eingeweiden der Fische lesen, die verwandten Abschnitte bei Owens heraussuchen und Aristoteles mit Owens Tafeln illustrieren. Wir sind wieder im Vogelsaal und betrachten die Vitrine der Körperteile – auch bei ihm findet sich ein Abschnitt zu Vogelschnäbeln und Vogelfüßen.
Aber es ist nicht einfach, Aristoteles’ Ziele herauszufinden. Wie all seine erhaltenen Arbeiten ist Historia animalium arm an Struktur und reich an redundanten, inkonsistenten, deplatzierten und kaum abgeglichenen Daten. Der Leser verspürt das brennende Verlangen, sie zu redigieren. Sie war nie ein poliertes Werk, sondern immer im Fluss; er scheint sie stückchenweise verfasst zu haben, neue Informationen einfach hinten angefügt oder aber vor dem Hintergrund einer woanders ausgeführten Theorie überarbeitet zu haben. Es ist auch daran herumgefummelt worden – bei wem und wie sehr, ist allerdings schwer zu sagen.
Trotzdem sind moderne Wissenschaftler sich allgemein einig, dass das Werk einen eindeutigen Zweck verfolgt. Unter der Unordnung liefert es die Materialien zum Durchkämmen großer Datenmengen. Aristoteles sucht nach Mustern – sehr subtilen Mustern. Er interessiert sich nicht nur dafür, wie Teile variieren, sondern auch dafür, wie sie kovariieren. So beschreibt er den bekanntermaßen komplexen vierkammrigen Magen eines Wiederkäuers (moderne Bezeichnungen eingefügt):
Lebend gebärende gehörnte Vierfüßer mit einer ungleichen Anzahl von Zähnen im Ober- und im Unterkiefer (auch Wiederkäuer genannt) haben vier Kammern. Der stomachos [Speiseröhre] beginnt am Maul und verläuft an der Lunge vorbei vom Zwerchfell zum megalē koilia [Pansen]. Dieser ist auf der Innenseite rau und unterteilt. Und an ihn schließt sich nahe dem Eingang zur Speiseröhre das kekryphalos [Netzmagen] an, das so genannt wird, weil es von außen aussieht wie ein Magen, von innen aber gewebten Haarmützen ähnelt. Der Netzmagen ist wesentlich kleiner als der Magen. Mit ihm verbunden ist das echinos [Blättermagen], rau und blättrig von innen und in der Größe dem Netzmagen ähnlich. Nach diesem kommt das sogenannte emystron [Labmagen], größer als der Blättermagen und länglicher in der Form. Es hat viele glatte Innenfalten. Direkt nach diesem folgt der Darm.
Die Beschreibung ist detailliert und korrekt, aber das wirklich Interessante daran ist, wie er diesen seltsamen Magen als eine Eigenschaft lebend gebärender Vierfüßer präsentiert, die gehörnt sind und nicht dieselbe Anzahl Zähne in den beiden Kiefern haben (er denkt dabei an die fehlenden Schneide- und Eckzähne im Oberkiefer vieler Wiederkäuer). Aus solchen Verknüpfungen konstruiert Aristoteles seine größten Sorten, aber es sind die Verknüpfungen selbst, die ihn interessieren. Man kann seine Daten zusammenziehen und sie als Datenmatrix präsentieren, die zum Beispiel sechs Merkmalsklassen (Anzahl der Zähne, Magentyp, Fußtyp usw.) und zwölf Tiersorten (Rind, Schwein, Pferd, Löwe usw.) enthalten.[∗] Es zeigt, wie die verschiedenen Merkmale (unvollkommen) zusammenpassen. Eine solche Tabelle hat er nie aufgestellt – alles wird umständlich mit Worten erklärt. Aber dass er so etwas im Sinn hatte, wird im Nachfolger der Historia animalium deutlich, De partibus animalium, wo er die Muster von Variation und Kovariation zusammenfasst, die er entdeckt hatte, und erklärt, warum es sie gibt. Er zieht seine Daten zusammen und webt daraus ein weites kausales Netz, das einem einzigen Zweck folgt: die wahren Naturen von Lebewesen zu entdecken.
∗ Dabei hat Britische Vögel – Nistreihe eine sehr deutsche Abstammung, denn die Ausstellung wurde von Albrecht Günther (1830–1914) zusammengetragen, dem in Tübingen geborenen Direktor der Zoologischen Abteilung des British Museum (Natural History). Er hatte sich von einer taxidermischen Darstellung inspirieren lassen, die er im Crystal Palace in Southwark gesehen hatte und die vom Naturforscher Hermann Plouquet, einem weiteren Deutschen, ursprünglich für die Londoner Industrieausstellung 1851 angefertigt worden war. Neben der Sturmschwalbe und der Amsel, die noch immer ausgestellt sind, wurden einige der Originalnester gerettet und befinden sich nun in der Forschungssammlung.
∗ Gaza führt hier bereits einen un-aristotelischen Gebrauch von »Gattungen« und »Arten« ein.
∗ Aristoteles’ Manuskript hatte kein Register. Ohne fällt es mir schwer zu begreifen, wie er in den Hunderten von Schriftrollen in seiner Bibliothek seine früheren Gedanken zu einem Thema wiederfand. Tatsächlich scheint es, als hätte er sich häufig die Mühe nicht gemacht, denn er hat die quälende Angewohnheit, sich in trivialen Dingen selbst zu widersprechen, als hätte er vergessen, was er früher dazu geschrieben hatte. Wie wir sehen werden, ist dies auch beim Elefanten der Fall.
∗ Hippos als Specht könnte ein Abschreibfehler von pipō sein, Aristoteles’ üblichem Namen für diesen Vogel. Vielleicht ist dies also gar nicht Aristoteles’ Schuld.
∗ Wörtlich »mit einer Haut wie Keramikscherben«.
∗ Athenaios sagt allerdings, dass Speusippos ein Buch namens Ähnlichkeiten geschrieben hätte, in dem er behauptete, dass Tritonschnecken, Murex-Schnecken, Landschnecken und Muscheln einander ähnlich seien. Auf welcher Grundlage er dies tat und zu welchem Zweck, wissen wir nicht.
∗ Wenn er diese beiden gegenüberstellt, scheint er die Schalen des Papierbootes und des geheimnisvollen neunten Kopffüßers zu vergessen.
∗∗ Da alle Übersetzer Aristoteles’ unterschiedliche Begriffe zur Beschreibung dieser Pole verwenden, nenne ich hier die griechischen Originalbezeichnungen: das Vorne (to emprosthen), das Hinten (to ophisten), das Oben (to anō), das Unten (to katŌ), das Rechts (to dexion), das Links (to aristeron).
∗∗∗ Für uns haben Menschen und Vierfüßer dieselben Achsen: anterior – posterior, dorsal – ventral, links – rechts. Das kommt daher, dass wir den Umstand ignorieren, dass Menschen aufrecht gehen, während dies für Aristoteles von grundlegender Bedeutung ist. Mit anderen Worten: Wo Aristoteles seine Achsen auf funktionelle Analogien gründet, richten wir unsere, zumindest bei Wirbeltieren, nach der strukturellen Homologie aus. Doch der Unterschied zwischen seinem Ansatz und unserem ist gar nicht so groß, wie er scheint. Wenn wir uns außerhalb der Wirbeltiere umsehen, sind unsere Achsen auch nicht wirklich durch strukturelle Homologie definiert. Der Bauch einer Fruchtfliege gilt gemeinhin als ventral und ihr Rücken als dorsal, aber molekulargenetische Daten zeigen, dass Insekten im Vergleich zu uns invertiert sind, dass unser Dorsal also homolog zum Ventral einer Fliege ist und unser Ventral dem Dorsal einer Fliege. So gesehen, ist auch »dorsal/ventral« heute nur noch eine Aussage zur funktionellen Analogie.
∗ Ebenso brillant bemerkt er, dass Schnecken dieselbe verdrehte Geometrie aufweisen. Sowohl bei Kopffüßern als auch bei Schnecken ist dies das Ergebnis eines Vorgangs, der »Torsion« genannt wird und im Embryonalstadium ihre Körper auf diese Weise verdreht.
∗∗ Und das tun sie auch tatsächlich: Der eine besteht hauptsächlich aus Chitin, das andere aus Kalziumkarbonatkristallen.
∗ Damit meine ich nicht, dass Sorten überlappende Ränder haben. Für Aristoteles kann ein Tier nicht zu zwei Sorten auf derselben Hierarchieebene gleichzeitig gehören. Eine Bergotter mag (unwahrscheinlicherweise) ein lebend gebärender Vierfüßer sein, der Schuppen und keine Beine hat, oder sie kann eine Schlange sein, die lebende Junge zur Welt bringt, oder sie kann etwas ganz anderes sein – aber nicht ein lebend gebärender Vierfüßer/lebend gebärende Schlange.
∗∗ Aristoteles’ Vorgehen ähnelt insofern in Teilen den in den 1970er-Jahren entwickelten phenetischen Klassifikationsmethoden, als es zu polythetischen Taxa führt. Die Phenetiker beharrten traditionell jedoch auf einer übergreifenden Ähnlichkeit (Verwendung aller untersuchbarer Merkmale mit gleichem Gewicht), was Aristoteles nicht tut.
∗ Der Fehler könnte auf die volkstümliche Ikonografie zurückgehen, die, etwa auf den Münzen von Tarentum, Delfine oft mit nach hinten versetztem Unterkiefer zeigten. Man muss Plinius jedoch zugutehalten, dass er die Funktion des Blaslochs richtig verstand.
∗ Die vollständige Matrix findet sich in Anhang B1.