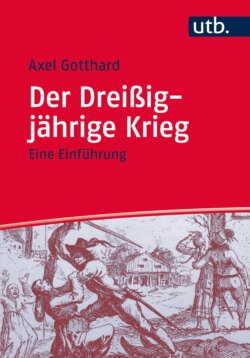Читать книгу Der Dreißigjährige Krieg - Axel Gotthard - Страница 14
1.3.2 Die Blockade des politischen Systems
ОглавлениеMit dem Reichstag war nun nicht nur ein zentrales, war zudem das letzte bis dahin überhaupt noch arbeitsfähige Reichsorgan lahmgelegt. Über dem eskalierenden Streit der Interpretationsschulen waren zuvor [<<33] schon alle anderen Reichsorgane ausgefallen oder unwirksam geworden. Werfen wir einige Schlaglichter auf die Wichtigsten von ihnen!
Den Rechtsfrieden im Reich sollten zwei oberste Reichsgerichte verbürgen. Aus unterschiedlichen Gründen waren sie dazu schon im Vorfeld des Dreißigjährigen Krieges nicht mehr in der Lage.
Krise der Reichsjustiz
Der mit Vertrauensmännern des Kaisers besetzte Reichshofrat verschrieb sich seit den 1590er-Jahren unübersehbar den katholischen Lesarten des Religionsfriedens, schaltete seit 1606 vollends auf eine „konfrontative Linie um“ (Stefan Ehrenpreis). Deshalb akzeptierten viele Protestanten seine Rechtsprechung in interkonfessionellen Streitfällen nicht mehr – denn bei den „Hofprozessen“ würden Politik und Rechtsprechung ungut vermischt. Damit waren um den Religionsfrieden kreisende Auslegungsprobleme nicht mehr konsensstiftend justiziabel. Der Soziologe Niklas Luhmann hat die Auswirkungen von Gerichtsverfahren einmal so beschrieben: Der Prozessteilnehmer finde sich
wieder als jemand, der die Normen in ihrer Geltung und die Entscheidenden in ihrem Amte bestätigt und sich selbst die Möglichkeiten genommen hat, seine Interessen als konsensfähig zu generalisieren und größere soziale oder politische Allianzen für seine Ziele zu bilden. Er hat sich selbst isoliert. Eine Rebellion gegen die Entscheidung hat dann kaum noch Sinn und jedenfalls keine Chancen mehr. Selbst die Möglichkeit, wegen eines moralischen Unrechts öffentlich zu leiden, ist verbaut.
Das Verfahren habe die Funktion, „den einzelnen, wenn er nicht zustimmt, thematisch und sozial so zu isolieren, dass sein Protest folgenlos bleibt“. Man wird den inkriminierten „Hofprozessen“ alle diese Wirkungen nicht zusprechen wollen: Evangelische Beklagte, die von ihnen überzogen wurden, interpretierten die fraglichen „Normen“, nämlich den Reichsabschied von 1555, ganz anders als jenes Gericht, das sie als Entscheidungsinstanz gar nicht akzeptierten. Weil zahlreiche evangelische Reichsstände die Auslegungskunst des Reichshofrats ablehnten, konnte der einzelne Prozessverlierer durchaus „politische Allianzen für seine Ziele“ bilden, kollektive Entrüstung an Protestantenkonventen mobilisieren, seine Niederlage skandalisieren und zum evangelischen „Gravamen“ machen. Die Reichsgerichte produzierten [<<34] nicht mehr problemlos exekutierbare Urteile und „folgenlos“ bleibenden Protest, sondern folgenreiche Proteste und schwer exekutierbare Urteile.
Das ständische Reichskammergericht war konfessionell ausgewogener besetzt, aber die Probleme waren deshalb nur anders, nicht kleiner. Beispielsweise blockierten sich Katholiken und Protestanten häufig schon in jenen Extrajudizialsenaten gegenseitig, die darüber zu entscheiden hatten, ob ein Streit überhaupt gerichtsanhängig wurde. Damit konnte die konfliktkanalisierende Kraft des Verfahrens (wir dürfen die befriedenden Effekte der Rechtsprechung ja nicht nur bei den Endurteilen verorten) nicht mehr wirksam werden. Andere Probleme kamen hinzu, aber um Detailfülle und Vollständigkeit soll es hier ja nicht gehen – jedenfalls war die Wirksamkeit auch dieses Gerichtshofs schwer beeinträchtigt. Um erneut Luhmann zu zitieren: Er hat einmal zu Recht betont, ein politisches System müsse „die Entscheidbarkeit aller aufgeworfenen Probleme garantieren“. Das Reichskammergericht hat dazu nicht mehr beigetragen.
Krise der Reichsversammlungen
Aber dem Reich kamen überhaupt sukzessive die Foren des Meinungsaustauschs und der friedlichen Konfliktbereinigung abhanden. Der Versuch des Reichsdeputationstags (gewissermaßen ein verkleinertes Abbild des Reichstags), sich einiger vom Kammergericht nicht mehr lösbarer Rechtsstreitigkeiten anzunehmen, führte 1601 zu seiner Sprengung. Der Rheinische Kurfürstentag, eine fürs Spätmittelalter zentral wichtige, noch im 16. Jahrhundert bedeutsame Tagungsform, zerbrach irreversibel an der Unlust der drei rheinischen Erzbischöfe, sich mit dem aus ihrer Sicht ketzerischen, nämlich calvinistischen Kurpfälzer an einen Tisch zu setzen. Man blieb lieber unter sich, wollte die Feindbilder gar nicht mehr dem Realitätstest aussetzen. Der Kurpfälzer und der Kurfürst von Brandenburg traten dem Kurverein nicht bei, weil die geistlichen Amtskollegen „mit lauter Martialischen unndt Kriegerischen Gedanken“ erfüllt seien.
Im frühen 17. Jahrhundert war von allen Institutionen des Reiches nur noch der Reichstag – leidlich – arbeitsfähig. Das macht die Sprengung der Regensburger Tagung von 1608 so fatal. Aufmerksamen Zeitgenossen entging das nicht: „De comitiis si quid vis, omnia ibi lenta et turbulenta et uno verbo ad bellum spectant“ („wenn Du wissen willst, wie der Reichstag verläuft – hier geht alles zäh voran und [<<35] doch drunter und drüber, kurz, Krieg ist in Sicht“). In evangelischen Akten dieser Monate grassiert eine Formulierung, die nicht modernem Deutsch entspricht und doch noch heute verständlich ist: „krieg steht ins haus“; es gerann rasch zum Topos. Wie sollten Konflikte fortan noch kanalisiert und gewaltlos geschlichtet werden? Musste man da nicht, um seine Interessen zu verfechten, fast zwangsläufig früher oder später zu den Waffen greifen? Noch im Frühjahr 1608 schlossen sich eine Reihe evangelischer Reichsstände in Auhausen zur evangelischen Union zusammen, die katholische Seite wird 1609 mit der Liga nachziehen. Damit stehen wir unübersehbar in der Vorkriegszeit.