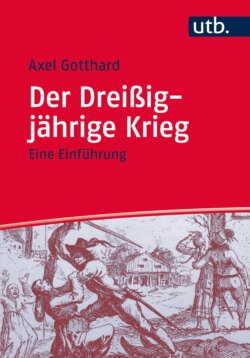Читать книгу Der Dreißigjährige Krieg - Axel Gotthard - Страница 16
1.3.4 Letztlich vergebliche Versuche, die Sprachlosigkeit zu überwinden
ОглавлениеGelehrte und publizistische Bemühungen
Seit 1608 stand Mitteleuropa im Vorhof eines von vielen erwarteten, befürchteten Konfessionskriegs. Nicht, dass Deutschlands Eliten damals gedanken- und sorglos in ihr Verderben gerannt wären! Nach gemeinsamen kulturellen Werten fahndend, wurden manche bei der Sprache fündig: 1617 wird die erste von bald zahlreichen deutschen Sprachgesellschaften, die „Fruchtbringende Gesellschaft“, gegründet. [<<43] Nicht alle Publizisten spien den üblichen konfessionellen Geifer aus; der eine und andere ließ sich von Süd- und Westeuropa anregen, wo schon etwas länger eine frühe politologische Literatur reüssierte, die in betont kühler, nüchterner Diktion die Eigengesetzlichkeiten politischer Ordnungsstiftung abzustecken suchte. Ihren eigenen Sachzwängen gehorchende Politik wurde mit der „ratio status“ (der Staatsräson) auf den Begriff gebracht. Ausgerechnet in der Vorkriegszeit begann der Terminus auch in Ratsprotokolle einzusickern, erreichte er also den mitteleuropäischen Politikbetrieb.
Das Projekt eines „Kompositionstags“
Ein interessantes Projekt politischer Praktiker war der „Kompositionstag“. Der Begriff „composition“ (lat. componere = zusammenbringen, vereinigen) hat in diesen Zusammenhängen nichts mit Tonkunst zu tun. Ein „composition tag“ sollte ausgleichsbereite Vertreter beider Konfessionen an einen Verhandlungstisch bringen. In konstruktiver Atmosphäre, ohne Abstimmungen und Majorisierungsversuche, sollten sie sich auf einen Rettungsplan für das zerschlissene Reich verständigen. Wir würden heute von einem „runden Tisch“ und von gruppendynamischen Effekten sprechen. Aufgebracht haben die Idee einige Unionshöfe, so insbesondere der in Stuttgart unter dem württembergischen Herzog Johann Friedrich. Und das war, unter den damaligen Umständen, auch schon ein Grund für das Scheitern des zukunftsweisenden Projekts. Fast alle Ligahöfe lehnten es entschieden ab.
Aus katholischer Warte sah die Sache so aus: Das Reichsoberhaupt ist katholisch, die „Nummer zwei“ des Reiches, der Erzkanzler, auch. Damit ist der kaiserliche Reichshofrat katholisch und der Direktor jenes Reichstags, in dessen maßgeblichen Kurien katholische Positionen jederzeit die Majorität besitzen. Warum sollen wir diese im politischen System strukturell angelegten Vorteile preisgeben, wo wir doch unsere Ansichten von Reich, Recht und Gesetz auf dem Rechtsweg und durch Stimmenmajorität jederzeit geltend machen können? Die Protestanten hatten endlich botmäßig zu werden, sich Richterspruch und katholischen Majoritäten zu fügen. Alles andere war dreister „Ungehorsam“, wie der zentrale Begriff des katholischen Reichsdiskurses lautete. Protestanten waren eben „ungehorsam“.
Die Kommunikationskreise sind großflächig gestört
Die desintegrativen Kräfte ließen sich nicht mehr bändigen. Vom alltäglichen Zusammenleben, beispielsweise in bikonfessionellen Kommunen, über das Versickern der Face-to-Face-Kommunikation der [<<44] Entscheidungsträger bis hin zu einer hitzigen Kampfpublizistik, in der die Gelehrten ihren andersgläubigen Kollegen verbal die Scheiterhaufen aufrichteten: Die Kommunikationskreise waren nachhaltig und großflächig gestört.
Es ist bezeichnend, in welcher Atmosphäre die „Säulen des Reiches“ (wie die Kurfürsten genannt wurden und sich auch selbst zu apostrophieren beliebten) zusammenkamen, als der Tod des Kaisers im Sommer 1619 doch wieder einmal eine ständische Versammlung, nämlich einen Kurfürstentag erzwang: Beide Lager ergingen sich in bizarren Rüstungsszenarien wie Angstfantasien, fürchteten eine deutsche Bartholomäusnacht. Vor Ort ließ sich „ein sehr großes mißtrauen vermerkhen“, die verängstigten geistlichen Kurfürsten dachten ernsthaft über einen vorzeitigen Abzug nach. Als das kurmainzische Begrüßungskomitee für den Kandidaten, König Ferdinand, durchnässt unter dem Sachsenhausener Stadttor Zuflucht suchte, hieß es, die katholischen Kurfürsten wollten sich der Tore „bemächtigen“ – Alarm, Tumulte, von den Frankfurtern in Dienst genommene Unionstruppen marschierten auf, „daruber die Burgerschafft zusamb geloffen“. Man versperrte die Tore, zog Ketten über die Straßen, da ein katholischer Okkupationsversuch drohe; es gab Schießereien, Messerstechereien, denen ein Angehöriger der kurkölnischen Delegation zum Opfer fiel. Das alles ist heute nicht mehr bekannt, mag auch für sich genommen ganz unwichtig sein, illustriert aber die aufgeheizte Stimmung im Reich in jenen Monaten, da sich die regionalen böhmischen Querelen zum mitteleuropäischen Krieg ausweiteten.
Der Konsens über das politische Verfahren schwindet
Um nun vom Stimmungsbericht wieder auf abstraktere Analyse zurückzuschwenken: Im Widerstreit der divergierenden Lesarten des Texts von 1555 schwand nicht nur die gemeinsame Schnittmenge zweier Auffassungen von Reich, Recht und Gesetz dahin – auch der Konsens über die Abarbeitung solcher Dissense im politischen Verfahren hat sich, zunächst kaum merklich, dann aber zusehends und mit gravierenden Auswirkungen verflüchtigt. Drangen Protestanten im Vorkriegsjahrzehnt auf die „Komposition“, pochten Katholiken auf die Entscheidungskompetenzen von Reichstagsmehrheit, Reichshofrat und Kaisertum. Die nach dem Verständnis der damaligen Zeit zentralen Fragen wollten Katholiken majorisieren, wollten die Protestanten frei aushandeln. (Die Nachkriegsordnung wird dann [<<45] der protestantischen Auffassung Tribut zollen – was für eine Seite zu den „essentials“ gehört, ist am Reichstag frei auszuhandeln: darauf läuft die „itio in partes“ des Westfälischen Friedens von 1648 hinaus, vgl. Kap. 5.5.3).
Vereinfachend und schematisierend kann man im letzten Vorkriegsjahrzehnt (wenn wir von den „politice Bäpstischen“ Dresdnern und ihrem Anhang hier jetzt einmal absehen) drei verfassungspolitische Positionen im Reichsverband ausmachen – kann man nämlich erstens beobachten, dass die Katholiken ihre strukturell im politischen System angelegten Vorteile zunehmend, anstatt den Konsens zu suchen, auszuspielen gedachten; dass, zweitens, die Mehrzahl der Auhausener gewisse, diese Vorteile kompensierende Sicherungen (insbesondere gegen ihre notorische Majorisierung) wünschten, also Detailkorrekturen, die aus ihrer Warte sogar systemstabilisierend gewirkt hätten; während die evangelische „Aktionspartei“ (Moriz Ritter) um die Heidelberger, drittens, gegen systemsprengende Konzepte nicht gänzlich immun, insbesondere aber für das Kalkül anfällig war, das ganze Räderwerk der Reichsverfassung stillzulegen, damit es nicht mehr den Katholiken in die Hände spielen konnte.
Ohne handlungsfähige politische Organe, ohne Grundkonsens und ohne Grundvertrauen in die politischen Partner war der Reichsverband nicht mehr steuerbar. Es bedurfte nur noch des sprichwörtlichen Funkens, der die brisante Mischung zum Explodieren brachte.