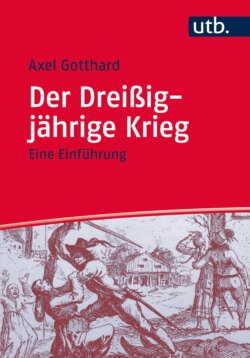Читать книгу Der Dreißigjährige Krieg - Axel Gotthard - Страница 22
1.5.3 Streit um den Majestätsbrief
ОглавлениеDie vom Majestätsbrief geweckten ständischen und konfessionellen Hoffnungen schlugen in den Jahren vor dem Prager Fenstersturz im Mai 1618 in wachsende Frustration um. Bei Rudolfs Tod im Januar 1612 fühlten sich die böhmischen Stände stark. Sie wollten ihren neuen König, Matthias, sogar zur Unterzeichnung eines Reverses zwingen, der ihnen das Recht zusprach, jederzeit zur Verteidigung der von Rudolf verbrieften konfessionellen wie libertären Standards Truppen aufzustellen, ferner ein Bündnis mit den ungarischen und österreichischen Ständen einzugehen. (Ein Versprechen, ständische Privilegien zu achten, nannte man in der Vormoderne „Revers“.) Matthias wollte einerseits nicht sogleich auf Konfrontationskurs gehen, dachte [<<66] andererseits gar nicht daran, seine Unterschrift unter den Revers zu setzen, und verzichtete deshalb sogar zunächst auf die Erhebung von Steuern – denn dafür hätte es eines Landtags bedurft, und dort wäre Matthias absehbar mit besagtem Dokument konfrontiert worden, mit der Forderung nach Defension und Konföderation.
Generallandtag 1615: unerwartete ständische Schwächen
Die weiterhin instabile Lage auf dem Balkan zwang Matthias schließlich 1614 doch zur Einberufung eines Generallandtags der von ihm regierten Länder in Linz. Heraus kam für ihn nichts, all die ansonsten divergierenden ständischen Kräfte einte die Opposition zum Haus Habsburg. Dem war nicht mehr so, als Matthias im Juni 1615 erneut zum Generallandtag, nun in Prag, lud. Die Exponenten des böhmischen Ständetums hofften auf eine Demonstration ständischer Stärke, oppositioneller Eintracht – und erlebten ihr Debakel. Aus Ungarn kam erst gar niemand, weil die ungarischen Magnaten darüber enttäuscht waren, dass die anderen Länder zögerten, sich an den hohen Kosten für die Stabilisierung der Türkengrenze zu beteiligen. Die Österreicher kamen, lehnten auch ein Bündnis mit den Böhmischen nicht geradewegs ab, wohl deren Führungsanspruch. Schlimmer noch war, dass sogar Mährer, Schlesier und Lausitzer opponierten – nicht gegen Habsburg, sondern ebenfalls gegen die böhmischen Standesgenossen. Die rissen alles an sich, wollten Nebenländer wie Mähren überspielen, wollten, wie der mährische Ständeführer Karl von Zierotin monierte, „selbst der Kopf sein und wir sollen der Schwanz bleiben“. Karl von Zierotin war aber auch für einen anderen Kurs den Habsburgern gegenüber, plädierte für mehr Vorsicht, weniger Konfliktbereitschaft. Habsburg konnte es recht sein.
Anders, natürlich, den Konfliktbereiten unter den Ständevertretern, die es nicht ausschließlich in Böhmen, aber doch vor allem dort gab. Sie verzweifelten an ihren ständischen Mitstreitern, versuchten auf eigene Faust, Fäden mit dem europäischen Ausland, zum Beispiel mit den Heidelbergern, anzuknüpfen, und steigerten sich in eine Stimmung hinein zwischen Verzweiflung und Wut, was die Bereitschaft befördern konnte, eben – eine Verzweiflungstat zu begehen, da man ja doch nichts mehr zu verlieren habe. Das wird für die Ereignisse des Jahres 1618 noch wichtig werden.
Habsburg setzt nach
Wiewohl nur noch zehn bis 15 Prozent der Einwohner Böhmens katholisch waren, sah sich Habsburg nach dem ständischen Debakel [<<67] von 1615 zum Nachsetzen ermuntert. Scharfmacher war gar nicht so sehr Matthias selbst, auch nicht sein wichtigster Berater in Wien, Melchior Khlesl. Es gab vor Ort, in Prag, einige forsche, forciert katholische Mitglieder des Statthalterrats, dort wurden Strategie und Taktik der erneuten Gegenreformation Böhmens ausgetüftelt. Aber Gegner des katholischen Rollback in Böhmen war Matthias keinesfalls. Prag und Wien gingen die Rekatholisierung Böhmens systematisch an und mit langem Atem, auch auf vielen Wegen – die beiden wohl wichtigsten waren konsequent katholische Ämterbesetzungen und die immer restriktivere Auslegung einmal eingeräumter Konzessionen. Die Gegenreformatoren im Hradschin und in der Hofburg saßen, salopp gesagt, am längeren Hebel – arbeiteten nämlich kontinuierlich am ihnen vor Augen stehenden Ziel eines zentral gelenkten katholischen Staatswesens, während sich die (zudem zerstrittenen) Stände ja nur sporadisch trafen.
Wir wissen schon vom Interpretationskrieg um den Augsburger Religionsfrieden in den Kerngebieten des Reiches. Auch der böhmische Majestätsbrief bot einen Ansatzpunkt für gegenreformatorische Auslegungskünste. Klar formuliert war die Wahlfreiheit zwischen katholischem Bekenntnis und Confessio Bohemica, aber um seinen Glauben auch auszuüben (jedenfalls in den Formen der damaligen Zeit), brauchte man Kirchen. Der Majestätsbrief konzedierte den utraquistischen Ständen, dass sie, so sie neue Kirchen für angebracht hielten, solche errichten lassen dürften. Auch auf königlichem Grund, also auf Boden, der privatrechtlich der Krone gehörte? Der Majestätsbrief nimmt ihn nicht aus, ja, im Vergleich zwischen den evangelischen und den katholischen Ständen Böhmens vom selben Tag heißt es: Wenn die Utraquisten „in einem Ort oder einer Stadt, ja selbst auf den Gütern sowohl des Königs wie der Königin“ keine Kirche besäßen, dürften sie eine solche „nach dem Wortlaute des Majestätsbriefes“ erbauen lassen.
Eine gegenreformatorisch nutzbare Lücke im Majestätsbrief
Wie aber verhielt es sich mit Ländereien der Prälaten (also der führenden Geistlichkeit)? Für die böhmischen Protestanten gab es solche geistlichen Güter gar nicht, sie subsumierten diese Gebiete dem Königsgut – die Krone habe eben Teile dieses Königsguts vorübergehend klerikaler Verwaltung überlassen. Die Katholiken sahen das anders, und wenn man ihre Sicht übernimmt, tut sich [<<68] im Majestätsbrief eine Lücke auf. Er bestimmt nicht das Verhältnis zwischen dem hehren Prinzip der Glaubensfreiheit und ganz normalen Besitzrechten (in diesem Fall: der Prälaten über ihre Vermögensmasse). Auf Letztere nämlich geht der Majestätsbrief gar nicht ein, aber die Prälaten reklamierten sie für sich.
Darum also drehte sich der Streit allgemein, konkret waren vor allem zwei Kirchenbauten in Nordböhmen umstritten. In Braunau (heute Broumov) hatten Lutheraner eine Kirche auf Landbesitz des dortigen Benediktinerklosters errichtet; der Abt erklärte, der ihm missliebige Bau auf seinem Grund und Boden sei zu verschließen. Die Prager Statthalterregierung wies die Braunauer schließlich an, den Kirchenschlüssel im Kloster abzugeben, und ließ einige Lutheraner, die sich deswegen in Wien bei Matthias beschwert hatten, kurzerhand arrestieren. In Klostergrab (heute Hrob) ließ der Prager Erzbischof die evangelische Kirche einfach abreißen, weil sie auf seinem Grund und Boden stehe; war die Berechtigung dieser drastischen Maßnahme noch Auslegungssache, verstieß sein Verbot, weiterhin evangelische Gottesdienste zu veranstalten, eindeutig gegen den Majestätsbrief. Allerlei kleinliche Schikanen im ganzen Land kamen hinzu – die Regierung zog, sichtlich ermuntert durch das Debakel des Generallandtags von 1615, die Daumenschrauben an.
Ferdinand wird als künftiger König „angenommen“
Die landständische Opposition war zornig, aber sie war auch eingeschüchtert. Im Juni 1617 gelang es der Regierung, die Nachfolge vorzeitig abzusichern, den konfessionspolitisch bekanntermaßen unnachgiebigen Ferdinand als künftigen böhmischen König zu installieren. Er wurde vom Landtag nicht etwa gewählt, sondern „angenommen“: Die Regierung ließ sich ihren Erbrechtsanspruch von den Ständevertretern einzeln, durch namentlichen Aufruf Mann für Mann, bestätigen. Es war eine demütigende Machtdemonstration. Sie hatte eine bemerkenswerte Vorgeschichte – schon im Vorfeld des Landtags und dann wieder am Tag der Eröffnung wurde den Ständischen auf der Böhmischen Kanzlei klargemacht: Wenn sie etwa an Ferdinands Erbrecht zweifelten, „dann wäre es für sie besser, sie hätten zwei Köpfe“ (zit. nach Bernd Rill). Die Böhmischen ließen ihren Mut sinken, bevor noch Köpfe zu Boden fielen.
Welcher Ruf Ferdinand vorauseilt
Der künftige Böhmenkönig würde also Ferdinand heißen. Jeder überzeugte Protestant konnte sich ausrechnen, dass unter ihm alles [<<69] nur noch schlimmer würde. Weil uns dieser Ferdinand als Kaiser des Dreißigjährigen Krieges noch häufig begegnen wird, lohnt eine kurze Charakterisierung. Er war geistig eher schwerfällig, aber sehr gewissenhaft und sehr, sehr fromm. Stunden verbrachte er täglich in Andacht und Gebet, der Einfluss seiner – durchgehend jesuitischen – Beichtväter war groß; auch auf die Politik: Ferdinand versicherte sich vor wichtigen Entscheidungen grundsätzlich des Standpunkts der Theologen, ging zusammen mit dem momentanen Beichtvater auf Gewissenserforschung. Die politischen Ratgeber hatten die Zweckmäßigkeit einer Maßnahme zu beurteilen, die geistlichen Berater die Übereinstimmung mit Naturrecht und göttlichem Gebot. War eine Entscheidung dann einmal – selten schnell – gefällt, zog Ferdinand das als richtig Erkannte mit der Unerschütterlichkeit dessen durch, der sich in einer unruhigen Zeit mit sich selbst und seinem Herrgott im Reinen weiß. Sein Amt war ihm göttlicher Auftrag, er war vom Himmel nicht an die Spitze seiner Herde gestellt worden, um dort gotteslästerliche Ketzerei zu dulden. Schon als Jugendlicher hatte er sich durch verschiedene Gelübde auf unerbittlichen Glaubenskampf verpflichtet, so soll er auf einer Pilgerfahrt zu Unserer Lieben Frau von Loreto geschworen haben, lieber über eine Wüste als über Ketzer zu herrschen.
In den letzten Jahren des 16. Jahrhunderts hatte der junge Ferdinand als Erzherzog in Innerösterreich schon erkennen lassen, was vom Böhmenkönig oder Kaiser ganz gewiss nicht zu erwarten sein würde: Duldsamkeit, Ausgleich, die Suche nach Kompromissen. Die innerösterreichische Gegenreformation war von allen habsburgischen die erfolgreichste, aber auch die rücksichtsloseste: zahllose ‚freiwillige‘ Bekehrungen (nicht selten unter Todesangst), über zweieinhalbtausend Exilanten, darunter ein Gutteil der intellektuellen und künstlerischen Elite des Landes. Es fielen evangelische Kirchen, brannten „ketzerische“ Bücher.
Gottgefällige Regierung war für Ferdinand monarchische Regierung. Ob die pointiert monarchische Herrschaftsauffassung Ferdinands auch seine Reichspolitik als Kaiser beeinflusst hat, müssen wir noch an anderer Stelle fragen (viel spricht dafür); ganz sicher prägte sie seine Politik als Landesherr. Er sei kein „princeps modificatus“, erklärte er einmal den steirischen Landständen, sondern ein „princeps absolutus“: [<<70] eine Formel des aufkommenden Absolutismus. Wenn Ferdinand konfessionspolitische Widerstände brach, brach er damit bewusst und gezielt auch politische Widerstände überhaupt: Entmachtung der Landstände, ihrer Institutionen zugunsten der landesherrlichen Bürokratie. Eigeninteresse, Staatsräson, gegenreformatorischer Eifer verschmolzen hier zur – zeitüblichen – Melange.
Frustrierte Ständeaktivisten: Verzweiflung, die zum Äußersten treibt?
Die Böhmischen – um nun zu ihnen zurückzukehren – wussten also, was ihnen blühte. Wir haben hier seit 1617 eine zeitübliche, aber in dieser scharfen Ausprägung geradezu prototypische Konstellation: Protestantismus plus ständische Libertät versus nachtridentinischer, jesuitisch geprägter Kampfkatholizismus plus frühabsolutistischer Zentralismus.
Umso schlimmer, dass die böhmischen Honoratioren Ferdinand selbst akzeptiert hatten! Man würde gern als Psychologe analysieren (doch wird der Historiker da immer vorsichtig sein): untergründige Wut, Hass auf sich selbst (was hat man mit sich machen lassen!), aber mehr noch auf die, die einen zu dieser Selbstdemontage gezwungen haben. Und bei manchen eine Verzweiflung, die zum Äußersten trieb: Musste man nicht den definitiven Bruch mit Habsburg provozieren, einen heldenhaften, der Ehrenrettung dienlichen Befreiungsschlag, ein Über-den-Rubicon, auf dass es kein Zurück mehr geben könne und nie mehr eine Demütigung wie bei der Annahme Ferdinands? Solche Gedanken waren maßgeblich für den Prager Fenstersturz. [<<71]