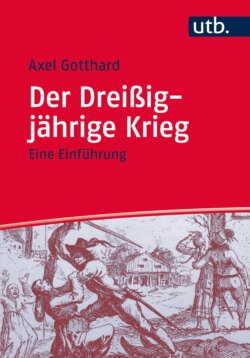Читать книгу Der Dreißigjährige Krieg - Axel Gotthard - Страница 17
1.3.5 Kriegsgefahr hier und dort
ОглавлениеIm Frühsommer 1610 schien es so weit gekommen, stand Europa an der Schwelle zu einem großen Krieg. Die evangelische Union verband mittlerweile eine Militärallianz mit Frankreich, und viel spricht dafür, dass König Heinrich IV. damals die „rupture générale“ in die Wege zu leiten suchte, auf einen groß angelegten europäischen Krieg gegen das Haus Habsburg aus war.
Traditionelle Rivalität Habsburg-Frankreich
Die Dauerrivalität zwischen dem Haus Habsburg und Frankreichs Königen war eine Grundstruktur der frühneuzeitlichen europäischen Staatenwelt bis zum „Renversement des alliances“ von 1756. Es hat mit historischen Erfahrungen zu tun, war gewissermaßen Tradition seit dem Streit um die Erbmasse des zerfallenden spätmittelalterlichen [<<46] Burgund und den Kämpfen um die Hegemonie über die Apenninhalbinsel an der Schwelle zur Neuzeit sowie den vier Kriegen, die allein Kaiser Karl V. zwischen 1521 und 1544 mit der französischen Krone ausfocht. Einen fünften ‚vererbte‘ Karl seinem Sohn Philipp II., 1559 beendete ihn der Frieden von Câteau-Cambrésis. Wenig später versank Frankreich in den Wirren der „Hugenottenkriege“ (1562–1598); der mit Abstand längste, achte Hugenottenkrieg entwickelte sich immer mehr von einem innerfranzösischen zum Krieg zwischen Frankreich und Spanien. Und kaum hatte Heinrich IV. das Land endlich konsolidiert, kam das herkömmliche französische Unbehagen über die Stellung des Hauses Habsburg sowieso wieder auf die politische Agenda.
Einerseits also hatte sich da eine dynastische Rivalität zur Traditionslinie verfestigt. Sie basierte aber auch auf geostrategischen Gegebenheiten. Das französische Staatsgebiet grenzte fast überall an Meer – oder aber an Habsburg: Im Süden wie im Norden an von Madrid aus regierte Länder der spanischen Habsburger; das westlich gelegene Alte Reich aber hatte fast schon gewohnheitsmäßig Kaiser aus der (schwächeren) österreichischen Linie des Hauses Habsburg. Man fühlte sich eingekreist, dadurch bedroht, war deshalb daran interessiert, das übermächtig scheinende Habsburg zu schwächen – wir müssen an diese Traditionslinie französischer Außenpolitik wieder anknüpfen, wenn wir fragen, warum der Dreißigjährige Krieg mit den kaiserlichen Triumphen der niedersächsisch-dänischen Kriegsphase, also 1629/30, nicht zu Ende war; und werden noch weiter unten erneut darauf zurückkommen, wenn sich Frankreich 1635 unmittelbar ins Kriegsgeschehen einklinkt.
Nun aber wieder ins Jahr 1610! Der zum Katholizismus konvertierte französische König Heinrich fand einen Ansatzpunkt, um in seine Kriegsplanungen ausgerechnet Deutschlands Protestanten zu verwickeln. Diese bangten damals um das Schicksal der konfessionell noch nicht festgelegten niederrheinischen Herzogtümer Jülich und Kleve.
Ein brisanter Erbfolgestreit am Niederrhein
Um was handelt es sich da, worum ging es? Zunächst einmal um ein Länderkonglomerat, das nur die Dynastie zusammenhielt: drei Herzogtümer (Jülich, Kleve, Berg) und zwei Grafschaften (Mark, Ravensberg). Warum war, und das seit Langem, Streit abzusehen? Weil Johann Wilhelm, nominell seit 1592 Herr über die vereinigten [<<47] niederrheinischen Herzogtümer, kinderlos war und das auch bleiben würde – er galt als geistig umnachtet, debil: Lange Jahre war da ein brisanter Erbfall abzusehen, alle möglichen Prätendenten konnten in den Archiven schürfen lassen und ihre Ansprüche begründen. Warum aber war der absehbare Erbstreit so brisant? Nun, zum einen waren die niederrheinischen Herzogtümer konfessionell gemischt – ein um 1600 schon selten gewordener Sachverhalt. Die Konfessionenkarte war hier noch gesprenkelt, die fraglichen Territorien waren, um es in der korrekten Fachterminologie auszudrücken, noch nicht „konfessionalisiert“. Als eines der letzten noch nicht definitiv zwischen den Religionsparteien ‚verteilten‘ Gebiete waren die niederrheinischen Herzogtümer schon reichsintern einiger Aufmerksamkeit sicher.
Aber sie ‚genossen‘ auch höchste internationale Aufmerksamkeit. Denn die benachbarten niederländischen Nordprovinzen um Holland und Seeland hatten sich seit 1568 jahrzehntelang Sezessionskämpfe mit der Madrider Zentrale und ihrer Brüsseler Statthalterregierung geliefert – zwar war dann 1609 ein zwölfjähriger Waffenstillstand zustande gekommen, traditionell verfeindet waren und blieben Spanien und seine separatistisch eingestellten Nordprovinzen allemal. (Wir werden diesem Konfliktherd noch wiederholt begegnen; tatsächlich werden die Kampftätigkeiten zwischen Madrid und Den Haag 1621 weitergehen, und zumal in seiner Spätphase wird sich der deutsche Dreißigjährige immer wieder mit dem niederländischen Achtzigjährigen Krieg verknäueln; die westfälischen Friedensverhandlungen werden beide Kriege beenden, und in ihrem Kontext, in Kapitel 5.6, wird dieses Studienbüchlein denn auch resümierend auf den Achtzigjährigen Krieg seit 1568 zurückblicken.) Natürlich wünschten sich die separatistischen niederländischen Nordprovinzen im Osten einen protestantischen Nachbarn, die habsburgtreuen südlicheren Provinzen – ungefähr das, was wir heute als Belgien kennen – aber einen katholischen. Habsburg wollte seine Position am Niederrhein ausbauen und der ewige Rivale Habsburgs in Europa, Frankreich, suchte dies zu verhindern. Die geostrategischen Gegebenheiten verliehen dem vorhersehbaren Erbstreit europäisches Gewicht.
Die Union lässt sich in den niederrheinischen Konflikt hineinziehen
Akut wurde das niederrheinische Erbfolgeproblem im März 1609. Zwei der vielen Prätendenten, die evangelischen Herrscher über das Kurfürstentum Brandenburg und über die Pfalzgrafschaft Neuburg, [<<48] suchten rasch vollendete Tatsachen zu schaffen, entsandten ihre Erbanwärter an der Spitze von Truppen ins strittige Gebiet, das sie militärisch okkupierten. In den damaligen Akten firmieren sie als die „Possedierenden“: als diejenigen, die – man ergänze: unabhängig von der strittigen Rechtslage – nun einmal faktisch im Besitz der Erbmasse waren (lat. possessio = Besitz, Besitznahme). Im Dortmunder Vertrag einigten sie sich auf die gemeinsame Regierung des Landes. Der Kaiser hingegen proklamierte, die strittigen Gebiete fielen vorläufig unter seine provisorische Verwaltung, so lange, bis der Reichshofrat entschieden habe, wer erbberechtigt sei; zum vorläufigen Administrator ernannte er den habsburgischen Erzherzog Leopold. Der rüstete zu, zog schließlich mit Truppenmacht an den Niederrhein. Dort engagierte sich mittlerweile auch die Union immer offener – so hatte Christian von Anhalt, die Graue Eminenz des Heidelberger Kurhofes, den Oberbefehl über die Truppen der „Possedierenden“ übernommen, und 1610 sandte die Union zweimal Truppen ins Elsass, um Leopolds Werbungen dort zu stören: eindeutig offensive Operationen auf bundesfremdem Gebiet, ein gefährlicher Präzedenzfall, gewagt, weil man sich französischer Rückendeckung sicher wähnte.
Für die Geschichte der Union sollte der zweite Einfall ins Elsass (vom Mai 1610) folgenreich werden. Wir müssen, anstatt aller Einzelheiten, nur drei Umstände kennen, um die Brisanz des Unternehmens verstehen zu können: Erstens war offenkundig, dass die katholischen Musterungen nicht Südwestdeutschland galten, dass sich Erzherzog Leopold endlich Respekt als kaiserlicher Administrator von Jülich verschaffen wollte. Man kann also nicht sagen, dass die Union unmittelbar bedroht gewesen wäre. Zweitens waren nur vier Unionsfürsten überhaupt eingeweiht: der kurpfälzische Direktor, sodann Moritz von Hessen-Kassel, der Ansbacher Markgraf Joachim Ernst und Georg Friedrich von Baden. Diese vier ‚Aktivisten‘ rissen einfach das Heft des Handelns an sich, schickten Unionstruppen über den Rhein. Weil sie wussten, dass die Militäraktion auf bundesfremdem Gebiet nicht konsensfähig war, wurden die Verbündeten eben gar nicht erst gefragt, auch nicht jene, die über ihre mitziehenden Truppen unfreiwillig in den Coup verwickelt waren. Sie alle wurden hinterher informiert. Sodann, drittens, ließen sich die Unionstruppen [<<49] zahlreiche Übergriffe zuschulden kommen, sie plünderten Mutzig, verwüsteten Molsheim, wüteten in der Landvogtei Hagenau, es gab Dutzende, vielleicht über hundert Tote.
Die meisten Unionsstände (einhellig die vorsichtigen, konfliktscheuen reichsstädtischen Magistrate) waren empört über den eklatanten Landfriedensbruch, der da auch in ihrem Namen verübt worden war. An den Unionstagen der Folgejahre wird der Einfall ins Elsass immer wieder als Begründung dafür herhalten, dass die Reichsstädte mehr Kontrolle über die Unionspolitik verlangen und/oder neue Steuern verweigern werden. Der Coup hat dem Bündnis in seinem dritten Jahr Wunden geschlagen, die nie mehr ganz verheilen sollten. Das latente Dauerproblem der Union war schlagartig unübersehbar geworden: dass da Regierungen mit ganz unterschiedlichen, verschieden konfrontationsbereiten politischen Vorstellungen miteinander auskommen mussten.
Wird die Union gar in einen großen europäischen Krieg hineingerissen?
Die längerfristigen Folgen der elsässischen Aggressionen waren also erheblich. Dabei war denjenigen, die sich nun und noch jahrelang darüber empörten, nicht einmal klar, dass es seit dem Winter 1609/10 um viel mehr als ‚nur‘ um Jülich und Kleve gegangen war. Während die meisten Auhausener damals ängstlich um Frieden und Stabilität in Mitteleuropa bangten, verhandelte Christian von Anhalt (bei sehr selektiver Information seiner Auhausener Verbündeten) in Paris mit Heinrich IV. über gemeinsame antihabsburgische Militäraktionen am Niederrhein. In beider Augen eröffnete die Jülicher Erbfolgekrise Chancen, die Stärkung des Protestantismus im Reich mit einer Zurückdrängung des spanischen Einflusses auf den Nordwesten des Kontinents, ja, überhaupt einer einschneidenden Schwächung der Position Habsburgs in Europa zu verbinden. Sie wollten den niederrheinischen Erbkonflikt mit der antispanischen Europapolitik Frankreichs verquicken. Ersterer sollte Paris den Vorwand zum Losschlagen liefern und deutsche Unterstützung eintragen.
Im Februar 1610 fixierten die Auhausener und Emissäre aus Paris im Vertrag von Schwäbisch Hall die Truppenkontingente für gemeinsame Militäroperationen am Niederrhein, wo Jülich inzwischen von Söldnern der österreichischen Habsburger unter Erzherzog Leopold besetzt worden war – sie gelte es mit vereinten Kräften von dort zu vertreiben. Der Vertragstext deutet, genau gelesen, die Möglichkeit [<<50] bedenklicher Weiterungen an: Falls der König wegen seines Engagements in und um Jülich von den Madridern oder den Brüsselern angegriffen würde, stünde ihm die Union mit viertausend Mann zu Fuß und tausend Reitern zur Seite, heißt es da; umgekehrt sicherte Heinrich den Unionsständen, falls die „sur le sujet de Julliers, ou autre concernant l’union“ (wegen Jülichs oder aus einer anderen das Bündnis betreffenden Ursache) attackiert würden, achttausend Fußsoldaten und zweitausend Berittene zu. Eklatant war, dass sich die Auhausener verpflichteten, keinen Vertrag, „qui importe à la cause commune“ (der für die gemeinsame Sache relevant ist), ohne vorherige Zustimmung des Bourbonen abzuschließen – einmal ins Kampfgeschehen am Niederrhein verwickelt, würde es für die Union keinen billigen diplomatischen Notausgang mehr geben. Dass der Kampf um Jülich für Heinrich von vornherein lediglich die Ouvertüre zu viel weiter reichenden Schlägen gegen das Haus Habsburg und zumal seinen spanischen Zweig sein sollte, wussten die meisten Auhausener freilich nicht, und sie kannten nicht das Ausmaß seiner Zurüstungen.
Denn Heinrich palaverte nicht nur, er stellte ein nach damaligen Maßstäben imposantes Heer auf die Beine – eine Nordarmee von zwanzigtausend Mann, eine südliche von zwölftausend: Ein Zangengriff auf Habsburg wurde da offenbar vorbereitet, wofür sonst so immense Rüstungsanstrengungen? Wie weit Heinrich gehen wollte, ob er gar vorhatte, zu einem Angriff auf die Iberische Halbinsel weiterzuschreiten, wissen wir nicht. Jedenfalls aber spielte sich Gewaltiges ab in Frankreich, und die Union wäre mit dabei gewesen – als Heinrich, am 14. Mai 1610, von der Hand eines Wirrkopfs, eines konfessionellen Fanatikers ermordet wurde: ein Paradebeispiel dafür, welches Gewicht biografischen Zufälligkeiten für vormoderne geschichtliche Abläufe zukommen kann. Heinrich starb ohne regierungsfähigen Nachfolger; an der Seite einer Regentin zweifelhafter Legitimität und zweifelhafter Intelligenz wollten selbst die Verwegensten unter Deutschlands Protestanten dann doch nicht gegen die Weltmacht Habsburg marschieren. Auch Paris stellte seine antihabsburgischen Projekte augenblicklich zurück. Wie im Vertrag von Schwäbisch Hall vereinbart, halfen französische Truppen bei der Belagerung von Jülich, das am 1. September 1610 kapitulierte. Danach zogen sie sich nach Frankreich zurück. [<<51]
Der malade Zustand des Reichsverbands wird zum Kriegsrisiko
Mitteleuropa war damals einem großen Krieg bedenklich nah. Wir erkennen schon hier, 1610, viele Konfrontationsmuster, die das Reich dann 1619 tatsächlich – erneut wegen regionaler Querelen, bei denen die allermeisten Reichsstände unmittelbar gar nichts zu gewinnen haben – in den Kriegsstrudel ziehen werden: Die Polarisierung des Reichsverbands ist so weit vorangeschritten, dass man seine konfessionspolitischen Anliegen militärisch verteidigen zu dürfen und zu müssen meint, sogar außerhalb des engeren regionalen Umfelds, sogar im Grenzsaum des Reiches. Das Gefühl, überall in die Enge getrieben zu werden, ist so bedrängend, dass Defensive, Vorwärtsverteidigung und Prävention in der subjektiven Wahrnehmung der Beteiligten an Trennschärfe einbüßen. Die Bereitschaft, sich bei alldem nichtdeutscher Unterstützung zu bedienen, war bei den ‚Aktivisten‘ von 1610 noch größer als 1619. Die Union präsentierte sich zwei Jahre nach ihrer Gründung kraftvoll, selbstbewusst und erreichte gerade, nach dem Beitritt Kurbrandenburgs, ihren höchsten, bald danach wieder abbröckelnden Mitgliederstand (der Fenstersturz wird das Bündnis ja als ein bereits niedergehendes, in sukzessiver Auflösung begriffenes ereilen). Doch war das Ausmaß der Konfrontationsbereitschaft eben auch im Frühjahr 1610 nicht überall gleich, weshalb – wiederum prototypisch – Christian von Anhalt vorpreschte, im Grunde bis hin zur Täuschung der meisten Verbündeten, die ‚lediglich‘ die konfessionelle Ausrichtung der niederrheinischen Herzogtümer im Blick hatten. So wenig das Gros der Unionsstände um 1620 eigentlich böhmische Interessen hat, so wenig gab es für die allermeisten Unierten 1610 am Niederrhein unmittelbar etwas zu gewinnen; die Aussicht, dem anderen konfessionellen Lager eins auszuwischen, es zu schädigen, zu demoralisieren – das reichte als Anreiz. Die Ermordung Heinrichs IV. dürfte einen großen Krieg unter Beteiligung der deutschen Protestanten vereitelt haben.
Erneute Kriegsgefahr 1614
Nur vier Jahre später drohten erneut kriegerische Verwicklungen. Die Spannungen zwischen den Brandenburgern und den mittlerweile von einem katholischen Pfalzgrafen regierten Neuburgern eskalierten, holländische und spanische Truppen setzten sich in Bewegung. War der Reichsverband schon so ruinös polarisiert, dass ihn nach den traditionellen französisch-habsburgischen Rivalitäten nun die seit Generationen mal virulenten, mal latenten Spannungen zwischen Madrid [<<52] und Den Haag in den Kriegsstrudel zu reißen drohten? Im November 1614 gelang, sozusagen im letzten Augenblick, dank internationaler Vermittlung der Interimsvergleich von Xanten. Für die verfeindeten „Possedierenden“ wurden je eigene Verwaltungszonen gezirkelt. (An Berlin kamen Kleve, Mark, Ravensberg: Kurbrandenburg setzte sich also dauerhaft am Niederrhein fest – Keimzelle dessen, was einmal viel später, seit der Rheinkrise von 1840, als Preußens „Wacht am Rhein“ besungen werden wird.)
Wieder war eine Atempause gewonnen. Wieder hatte sich gezeigt, dass der Zustand des Reiches mittlerweile so prekär war, dass sich jede Querele in seinem Inneren oder auch in der Nachbarschaft, irgendwo an seinen weit geschwungenen Grenzen, zum Flächenbrand auswachsen konnte. Wir werden noch sehen, dass Deutschlands Protestanten auch 1618 besorgt zum Rhein schauen werden, keinesfalls mit der gleichen Bangigkeit nach Prag.