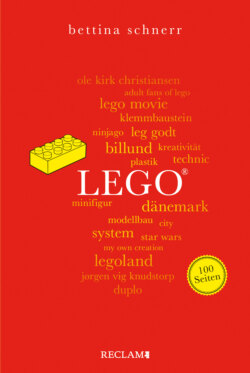Читать книгу LEGO®. 100 Seiten - Bettina Schnerr - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die zweite Generation
ОглавлениеUnter Godtfreds Federführung entwickelte sich LEGO immer besser. Was auch immer die Billunder auf den Markt brachten, wurde erfolgreich verkauft. Zum einen gab es unter den Spielzeugen nach wie vor kein vergleichbares System. Zum anderen wollten die Leute in den 1960er Jahren gerne etwas kaufen, wenn sie Geld hatten, und ihren Kindern Dinge gönnen, die sie selbst nicht gehabt hatten. Die Rahmenbedingungen waren für die aufstrebende Firma hervorragend. Firmenmitarbeiter dieser Zeit, die zur Arbeit bei LEGO befragt wurden, lobten oft Godtfreds Führungsstil, der zum Engagement der Mitarbeiter beigetragen hatte. Fehler seien kein Problem gewesen, im Gegensatz zur Arbeitskultur bei vielen anderen Firmen. Den Chef habe nie interessiert, wer an etwas die Schuld trage. Seine Frage insbesondere bei größeren Pannen soll stets gelautet haben: »Und wie kommen wir nun weiter?«
Damit das Unternehmen mit dem steigenden Bedarf Schritt halten konnte, holte man die Entwicklung aus dem Hobbykeller im Haus der Kirk Christiansens, wo bislang getüftelt wurde. LEGO gründete eine richtige Entwicklungsabteilung, getauft auf den Namen LEGO Futura (so heißt sie übrigens heute noch), die einen eigenen Chef bekam. 1959 besaß sie fünf Mitarbeiter, die sich ganz auf die Entwicklung konzentrierten.
Doch was war eigentlich aus den Holzspielzeugen geworden? Die gehörten bis 1960 weiterhin zum Sortiment, wurden aber nur in Dänemark vertrieben. Das Schicksal der Produktgruppe besiegelte schließlich ein drittes Großfeuer, das auf dem Firmengelände ausbrach. Im Februar 1960 brannte die komplette Holzwarenabteilung nieder. Zum ersten Mal entschied sich die Firma nicht dazu, alles wieder aufzubauen. Godtfred stellte die Holzwarenproduktion ganz ein und setzte alles auf eine Karte: Das LEGO-System. Seine älteren Brüder verließen das Unternehmen deswegen kurz darauf und machten mit eigenen Firmen weiter. Ihre Anteile kaufte Godtfred ab, sodass seither seine Nachkommen die einzigen LEGO-Erben sind.
In den 1960er Jahren wuchs die Firma sehr schnell. Es gab praktisch keinen Kontinent mehr, auf dem LEGO nicht erhältlich war. Die Mitarbeiterzahl verdreifachte sich etwa zwischen 1958 und 1960 auf rund 450 und stieg bis 1965 nochmals um über 150 Personen an. Die genoppten Bauklötze tauchten in immer mehr Kinderzimmern auf und Billund fütterte den Bedarf mit immer neuen Sets und Bausteinen. Um Kinder bereits ab dem Alter von 2 Jahren an das Bauen mit Steinen heranführen zu können, lancierte LEGO 1969 erfolgreich die Serie Duplo. Der Name leitet sich aus dessen Designprinzip ab: Alle Längen werden im Vergleich zum klassischen LEGO-Stein verdoppelt (doppelt – lateinisch: duplex, portugiesisch: duplo). Wie es sich für einen Systembaustein gehört, lassen sich Duplo- und LEGO-Steine nicht nur in der Größe voneinander ableiten. Man kann sie, von einigen Ausnahmen abgesehen, auch zusammenstecken (die Erweiterung der LEGO-»Nutzungszeit« setzte LEGO übrigens 1977 in die andere Richtung mit LEGO Technic fort, um Teenager bei der Stange zu halten).
1964 legte das Unternehmen seinen Sets erstmals Bauanleitungen bei. Bis zu diesem Zeitpunkt dienten die Verpackungsillustrationen als Inspiration. Wie die Modelle gebaut waren, mussten die Kinder selbst herausfinden. Die Anleitungen erwiesen sich als Riesenerfolg, sodass LEGO das Konzept beibehielt. Angeblich ließ sich LEGO bei IKEA beraten, um eine international verständliche und einfache Bildsprache für die Bauanleitungen zu entwickeln.
In demselben Jahr besaß das Unternehmen, verteilt auf 47 Länder, bereits 62 Patente, 19 Gebrauchsmuster, 29 Designpatente und 51 Warenzeicheneintragungen. Der Marketingchef dieser Zeit war gelernter Jurist und kümmerte sich intensiv um entsprechende Absicherungen. Und dennoch wirkte LEGO in mancherlei Hinsicht wie der kleine Betrieb, der es einst war: Noch zu Beginn der 1970er genehmigte Godtfred jede größere Anschaffung oder Ausgabe persönlich. 1961 kaufte sich LEGO erstmals ein Flugzeug, weil sich die Dienstreisen kaum noch bewältigen ließen. Als Flugplatz diente schlicht eine Wiese. Für die Landelichter bei nächtlichen Anflügen setzten die Mitarbeiter ganz pragmatisch ihre eigenen Autos ein, die Scheinwerfer richtig ausgerichtet. Zum großen Flughafen mauserte sich die Wiese, nachdem Godtfred einige Nachbargemeinden von einer Zusammenarbeit überzeugt hatte. Die Gemeinden bauten eine vernünftige Rollbahn inklusive einer professionellen Beleuchtung und nach der Eröffnung 1964 nahmen die Linienflüge ihren Betrieb auf. Heute fungiert Billund mit dem Flughafencode BLL als Frachtflughafen und Touristendrehscheibe. Nach Kopenhagen ist Billund der zweitgrößte Flughafen in Dänemark.