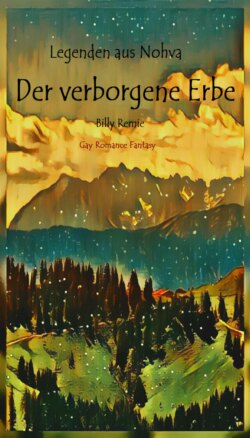Читать книгу Der verborgene Erbe - Billy Remie - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
9
ОглавлениеEiskaltes Wasser, frisch aus dem grauen Gestein des Gebirges, umschloss seinen schmerzenden Kopf, als er ihn in das Fass tunkte.
Den Schmerz der Kälte wegkeuchend, hob Cohen sein nasses Haupt wieder aus dem kalten Nass, Wasser tropfte von seinen dunklen Strähnen zurück in das Fass. Noch einen Moment lehnte er auf dem Rand und holte Luft.
Dann strich er sich mit einer Hand das kalte Wasser aus dem Gesicht, und die Haare aus der Stirn, während er sich erhob.
Die Kälte hatte ihm gutgetan und seine anhaltenden Kopfschmerzen zumindest soweit gelindert, dass er gerade laufen konnte. Sein Schädel fühlte sich an, wie von einem Pfahl durchbohrt, der ihm vom Haaransatz gerade nach unten den Kopf bis zu den Kiefern spaltete. Ein unerträglicher Druck machte sich hinter seinen Schläfen breit, seine Ohren dröhnten, ließen alle Geräusche um ihn herum gedämpft erscheinen, seine Sicht war getrübt und von einem Nebelschleier umgeben, und aus seiner Nase rann Blut.
Das kalte Wasser hatte die Blutung jedoch gestillt.
Der Schmerz hatte heute Morgen urplötzlich eingesetzt. In dem einem Moment aß er noch sein Frühstück und scherzte mit Desiderius, im nächsten Augenblick fuhr ein unsichtbarer Dolch in seinen Kopf.
Doch er war nicht allzu überrascht, denn seine Nacht war kurz gewesen. Abermals hatte ihm sein Magen Probleme bereitet, sodass es ihm den Schlaf gekostet hatte.
Wegen seines Zustandes hatte er auch nicht auf die Übungen mit Eagle bestanden, als der junge Airynn Erbe, geschäftig in seinen Gemächern über irgendwelchen Schriften und Büchern grübelnd verkündet hatte, er hätte am heutigen Tage keine Zeit für sein Kampftraining. Es gäbe dringlichere Angelegenheiten, denen er sich annehmen müsse.
Desiderius würde das gewiss nicht gutheißen, aber auch er würde lernen müssen, dass letztlich Eagle das letzte Wort hatte. Wenn der Prinz sich zwei Tage vor der Abreise weigerte, seine unzulänglichen Kampffähigkeiten zu verbessern, konnte Cohen ihn wohl kaum zwingen. Sie mussten allmählich alle lernen, dass Eagle ihr Herrscher war, nicht ihr Rekrut.
Cohen hatte schon länger das bedrohliche Gefühl, das Streit sich anbahnte, immer dann, wenn Desiderius den strengen Vormund heraushängen ließ, und Eagle zähneknirschend abwägte, ob er es wagen sollte, sich gegen seinen Freund zu stellen.
Vielleicht war es an der Zeit, gerade weil sie sich bald zu ihrer ersten Schlacht aufmachten, dass jemand Desiderius verständlich machte, dass er Eagle mehr Respekt zollen sollte.
Obgleich Cohen, und gewiss auch Eagle, wussten, dass Desiderius‘ Verhalten nichts mit Respektlosigkeit zu tun hatte. Er war streng, gewiss, jedoch weil er wusste, worauf es ankam. Für Cohen war sein Blutdrache der geborene Anführer, ein geborener General. Doch Desiderius trat Eagle gegenüber wie der Vater dem jungen Sohn. Leider auch vor den Augen der Soldaten, was Eagles Autorität untergrub. Desiderius tat es gewiss nicht aus Mutwillen, es lag in seiner Art, alles mit einer gewissen Strenge zu fordern, doch er musste schnell lernen, das Eagle sein Prinz war. Auch sein Freund, aber vor allem war er der Prinz, Königserbe und alleiniger Herrscher.
Cohen ahnte bereits, weshalb Desiderius keinen Gedanken daran verschwendete, denn er war es gewohnt, gleichgestellt mit seinem Prinzen zu sein, da er und Wexmell einst ein Liebespaar gewesen waren. Doch Eagle war nicht Wexmell, und für Eagle war Desiderius kein Gleichgestellter. Wenn Eagle Desiderius‘ Verhalten irgendwann zu weit ging, konnte das die Einheit spalten. Denn viele standen überwiegend hinter ihrem Blutdrachen, und zweifelten am Sohn der Verräterin, während die anderen in Eagle ihren Retter sahen.
Wenn sich diese Streitmacht entzweite, dann wäre alles umsonst gewesen. Nur gemeinsam waren sie vielleicht stark genug, Nohva zu befreien. Aber selbst mit vereinten Kräften war ihr Vorhaben nicht siegesgewiss.
Cohen wusste, dass irgendjemand mit den beiden sprechen sollte, doch er wusste nicht so recht, ob er der richtige dafür war. Zwar liebten Desiderius und er sich, aber auch bei Rahff hatte Desiderius seine eigenen Wünsche verfolgt, ohne Rücksicht auf Cohens Gefühle.
Ob Desiderius auf ihn hören würde, egal in welcher Sache, wagte Cohen zu bezweifeln. Und er wollte auch nicht so ein Gefährte sein, der seinen Liebsten zurechtwies. Desiderius sollte niemals das Gefühl haben, Cohen stünde nicht hinter seinen Entscheidungen, oder würde gar versuchen, ihn durch Liebesgeflüster zu manipulieren, wie Sevkin es bei Cohen getan hatte.
Nachdenklich setzte Cohen sich am Rande der Kaserne auf eine Bank, hinter ihm die Waffenschmiede, Hämmern und zischendes Eisen drang an seine Ohren, die Hitze flimmerte hinter den offenen Toren.
Am gegenüberliegenden Ende des Übungsplatzes saß Desiderius auf einem Fass unter dem Dach der Stallungen und schärfte sorgfältig mit einem Wetzstein die geschwungene Klinge des Drachenflügelschwerts. Um ihn herum standen Stände mit stumpfen Übungsschwertern für die Rekruten, die täglich aus dem Umland kamen und darum flehten, für den Erben, dessen Offenbarung schnell die Kunde machte, kämpfen zu dürfen.
Junge Burschen waren darunter, die unter strenger Beobachtung standen, da Desiderius weiterhin mit Spionen rechnete. Doch Cohen sah in den kämpferischen Augen nur wütende Bauerssöhne, die ihre Familien rächen wollten, die von den Soldaten der sich bekämpfenden Fraktionen geschändet und getötet worden waren. Bauern mit Schwertern, keine Soldaten wie die Fahnenflüchtigen unter Sehareds Befehl, und gewiss keine Elitekrieger wie Eagles luzianische Armee. Aber es waren junge Männer mit Mut und ebenso viel Zorn wie Kampfeswillen.
Sie würden kämpfen, Feinde niederstrecken, Fronten halten, und viele würden sterben. Aber zuvor würden sie noch Feinde mitnehmen. So traurig es sich anhörte, im Krieg war dies ein Vorteil. Auch ein Soldat, der fällt, hat doch zumindest kurzweilig einem Zweck gedient. Und Cohen wusste, genau wie Desiderius es wusste, dass im Krieg Opfer erbracht werden mussten. Auch sie kämpften, es war jedoch ihre Erfahrung, die ihnen einen längeren Kampf gewährte. Aber irgendwann, darum wussten alle guten Kämpfer, würde auch ihr Glück versiegen und das Schicksal zuschlagen. Und wenn dieser Tag bald kommen mochte, wenn Cohen im Kampf um die Schwarze Stadt fallen mochte, so tat er es aus freien Stücken.
Er würde zum ersten Mal in seinem Leben als freier Mann kämpfen, mit dem freien Entschluss, sein Leben für einen Herrscher zu geben, der mit dem Recht zu Herrschen geboren worden war.
Müde gähnte Cohen, ohne Hand vor dem Mund, während die Schmerzen in seinem Kopf ihn weiter ermatteten. Zu viele Gedanken machten seinen Kopfschmerz nur noch schlimmer. Er hütete sich, heute den Sorgen nachzuhängen, und beschloss, es langsam anzugehen.
Keine Übungen heute für ihn, dafür beobachtete er mit einem verliebten Lächeln den unwissenden Blutdrachen. Lieber setzte Cohen heute einen Tag aus, als bei der Abreise ein Bild wandelnden Elends abzugeben. Bereits heute Morgen, als er nach dem Frühstück blass die Rüstung anlegte, hatte Desiderius besorgt gewirkt, und Cohen wollte nicht riskieren, aus gesundheitlichen Gründen zurückgelassen zu werden.
Desiderius brauchte ihn! In jeder kommenden Schlacht.
Denn Cohen war der einzige Mann, der den Blutdrachen in Tiergestalt kontrollieren konnte.
***
Der Tag, an dem sie ausrücken würden, war rasch nähergekommen, und obwohl er ihn sich herbeigesehnt hatte, wurde er nun Augenblick um Augenblick nervöser.
Er hatte gegen viele Feinde gekämpft, oft nur knapp den Sieg errungen, vor allem gegen Dämonen war er angetreten, und nur weil ihm das Glück hold gewesen war, hatte er sie vernichten können. Doch nun trat er nicht gegen einen einzigen Dämon an, auch nicht gegen eine wildgewordene Schar, die in der Wildnis lauerte, sondern gegen eine organisierte Armee dunkler Mächte, angeführt von einem klugen, mächtigen Fürsten, der, laut Bellzazar, wahrscheinlich schon ihr Ankommen vorhersah und sie erwartete.
Beinahe verliebt führte Desiderius den Wetzstein über die geschwungene Klinge seines treuen Schwertes, das ihm häufiger als er aufzählen konnte das Leben gerettet hatte.
Er zweifelte, und das behagte ihm nicht. Zwar stand Bellzazar an seiner Seite, aber er konnte spüren, dass auch sein Bruder voller Furcht war. Doch sie mussten die Schwarze Stadt zurückerobern, weil niemand es sonst tun konnte. Wenn Eagles Armee das erringen konnte, was Rahff nie gelang, würden mehr Leute an sie glauben, würden mehr Leute zu ihnen stehen, vielleicht sogar Adelsmänner mit Truppen, die sich gegen Rahff stellen und zurück zu ihrem wahren König fanden.
So sehr der Gedanke, wieder jenen zu vertrauen, die den Airynns in ihrer größten Not nicht beistanden, wusste Desiderius leider auch, dass ihnen in ihrer Lage keine andere Wahl blieb. Er konnte seinen Stolz nicht vor die Stärke ihrer Truppen stellen. Um Rahff und die Schavellens zu besiegen, brauchten sie jeden Freund, den sie kriegen konnten. Selbst wenn es menschliche Verbündete waren. Deshalb ließ er auch die Bauern, die kämpfen wollten, in die Mauern, denn Hochmut konnte er sich nicht mehr leisten.
»Herr?«
Verwundert sah er auf, hatte den Schatten, der auf ihn gefallen war, nicht bemerkt. Ein junger Bursche, mit feinem Antlitz, graublondem Haar und verstaubten Gesicht, ging vor ihm in die Hocke, um einen vollen Krug Trinkwasser abzustellen.
»Ich soll Euch diesen hier bringen.« Der Bursche lächelte unsicher. »Der Herr Bellzazar sagte, Ihr sollt die Finger vom Wein lassen, wenn Ihr trainiert, und stattdessen Wasser trinken.« Der junge Mann senkte beschämt den Blick, als erwartete er für seine Worte Tadel.
Desiderius lachte nur kopfschüttelnd: »Das sagt mir der richtige. War sonst noch was?«
Der Bursche nickte ergebend und sprach sogleich weiter: »Ich soll Euch auch ausrichten, Euer Hengst, Wanderer, braucht vor der Abreise frische Eisen für die Hufe.«
»Der Hufschmied soll sich darum kümmern. Ich will, dass Wanderer spätestens Morgen bereit zum Aufbruch ist.«
»Ja, Herr«, der Bursche neigte das Haupt, zögerte jedoch. Es war ihm überdeutlich anzumerken, dass ihm noch etwas auf der Seele lag, was er sich jedoch nicht zu äußern wagte.
»Was ist denn?«, fragte Desiderius belustigt. Er würde sich nie daran gewöhnen, dass die Leute so viel Respekt vor ihm hatten, dass sie scheinbar ihm gegenüber die Fähigkeit zu Sprechen verloren.
Der Bursche kratzte sich an der Schläfe und wandte sich wieder an Desiderius: »Euer Ross ist … ein weiteres Mal ausgebrochen.«
»Wann?«
»Wir sahen es nicht, er war auf einmal nicht mehr in seinem Stall, Herr. Es tut mir leid-«
Desiderius gebot ihm mit einer Handgeste Schweigen. »Beruhige dich, Junge, ich bin nicht wütend. Wanderer hasst den Stall, gelegentlich macht er einen Spaziergang. Selbst ich kann ihn daran nicht hindern. Er kommt wieder. Und wenn er da ist, ruft mich, dann helfe ich dem Schmied mit den Eisen.«
Der Bursche lächelte und nickte ergebend. »Wie Ihr wünscht, Herr. Vielen Dank, Herr. Der Schmied wird sich geehrt fühlen.«
Desiderius sah amüsiert auf. »Weshalb? Weil ihn ein hochmütiger Laie bei seiner Arbeit zur Hand gehen will? Ich fürchte, er wird sich gezwungen fühlen, mich zu erdulden, obwohl ich seine Arbeit behindere.«
Der Bursche kämpfte mit einem Lächeln. Er schöpfte Mut aus Desiderius‘ charmanten Lächeln, und wagte zu fragen: »Weshalb wollt Ihr dann dabei sein?«
»Ich will mein Pferd in guten Händen wissen«, zwinkerte Desiderius, »und dabei vielleicht noch etwas dazu lernen. Wer weiß, vielleicht werde ich Hufschmied, sollten wir diesen Krieg überleben.«
»Ich sehe Euch nicht als Arbeiter, Herr.«
»Dann falle ich wohl in der Schlacht, und überdauere die Zeitalter als Legende.«
Es sollte ein Scherz werden, doch der Bursche blickte ernst zu Boden. »Das seid Ihr schon jetzt, mein Herr.«
Nachdenklich betrachtete Desiderius ihn. Sein Gebaren erinnerte ihn auf schmerzliche Weise an die ersten Begegnungen mit Wexmell, während sie einander noch ausgetestet hatten. Als er mehr als ihm heute lieb war, Wexmells Gefühle durch bloße Kaltherzigkeit verletzt hatte.
Desiderius hielt den Wetzstein still und schenkte dem Jungen seine ungeteilte Aufmerksamkeit. »Wie lautet dein Name, Junge?«
»Aghi«, seine Augen leuchteten erfreut, »zu Euren Diensten, Herr.«
»Versprich mir besser nichts, was mich auf dumme Gedanken bringen könnte«, lächelte Desiderius.
Aghi lachte leise auf, das Geräusch erinnerte an ein liebliches Glockenspiel im sanften Wind, der über die Felder glitt.
»Ahgi«, wiederholte Desiderius interessiert, »das ist doch kein westlicher Name. Woher stammst du?«
Aghi berichtete, offensichtlich glücklich, die Aufmerksamkeit des Blutdrachen erlangt zu haben: »Mein Vater stammt aus Carapuhr. Nachdem sein Vater im Land des Eises einen schlechten Ruf als Taugenichts erlangte, kam mein Vater vor sechzig Jahren nach Nohva. Er begegnete meiner Mutter, die Dienstmagd auf dieser Festung war, zeugte drei Söhne, meine zwei älteren Brüder und mich.«
Desiderius hörte ihm aufmerksam zu, und bedeutete ihm, sich ihm gegenüber auf ein Fass zu setzen. »Vor sechzig Jahren? Dein Vater ist wohl nicht mehr am Leben.«
»Nein«, bestätigte Ahgi traurig, als er sich setzte. »Er starb bei einem Jagdausritt, als er König Wexmell Airynn vor einem wilden Eber rettete. Für seine Treue wurde er sogar hier auf dem Friedhof bestattet. Damals war ich noch im Leib meiner Mutter.«
Bekümmert senkte Desiderius die Augen, als er daran erinnert wurde, dass Wexmells Überreste nicht hier beigesetzt wurden. Es gab kein Grab, an dem Desiderius hätte sitzen und Abschied nehmen können. Keine Asche, die er hätte in Nohvas milden Winden verstreuen können, damit Wexmell für alle Zeit ein Teil von ganz Nohva werden konnte.
»Meine Brüder«, fuhr Ahgi schwermütig fort, »fielen in der Schlacht am Fluss. Ich war noch ein Kind und blieb in der Festung. Ich und meine Mutter waren hier, als der Bannzauber über uns gelegt wurde. Wir wissen nicht, was mit den Überresten meiner Brüder geschah, noch wie sie überhaupt starben.«
Die Melancholie in dem Gesicht des Jungen, war ein Spiegel zu den Gefühlen aller Seelen auf dieser Festung.
Desiderius atmete schwer aus und beugte sich vor, um Aghi eine Hand in den schmalen Nacken zu legen.
Der Junge sah ihn nach Rat ersuchend an.
»Wir alle haben viel durchlebt und viel verloren. Aber wir leben noch, und gemeinsam haben wir die Stärke, uns alles zurückzuholen, das man uns genommen hat!«
»Nur die Toten können wir nicht lebendig machen.«
Wahre Worte von einem verletzten Geist. Desiderius nickte traurig, die Worte waren wie ein Hammerschlag auf seiner Brust.
Nichts würde Wexmell je zurückbringen.
»Aber wir leben«, sagte er entschlossen, auch zu sich selbst, während er den Nacken des Jungen drückte und ihn aufmunternd anlächelte, »und es ist unsere Pflicht gegenüber den Toten, aus unserem Leben etwas zu machen.«
»Ich kann nicht mit dem Schwert umgehen«, gestand Aghi, er senkte beschämt den Blick und starrte auf seine staubigen Hände, »ich wurde zum Stallburschen gemacht, weil ich gut mit den Pferden umgehen kann, die Tiere vertrauen mir. Doch kaum halte ich ein Schwert, werde ich zu einem großen Tollpatsch.«
»Vertrau auf deine Krieger, deren Rösser du pflegst«, sagte Desiderius zu ihm, »auch ein Stallbursche ist wichtig, auch wenn die Barden leider immer wieder vergessen, sie in ihren Lobesgesängen zu erwähnen. Aber was würde geschehen, gäbe es keinen Burschen wie dich, der sich um meinen Wanderer kümmert, ihn hegt und pflegt, damit er mich sicher durch die Schlacht tragen kann? Wir brauchen dich ebenso wie wir Kämpfer brauchen. Das macht die Stärke einer Armee aus. Das Große und Ganze. Jeder Mann hat seinen Wert, jede Seele ist wichtig für die Allgemeinheit. Das lehrten uns die Airynns. Lass uns ihre Weisheit nicht vergessen.«
Aghis schöne blauen Augen leuchteten mit jugendlicher Freude zu Desiderius auf, während die Worte ihm den Stolz schenkten, den er für sein Selbstvertrauen gebraucht hatte.
»Harte und ehrliche Arbeit ist es immer wert, geschätzt zu werden. Leider erhält sie viel zu wenig Anerkennung, wobei sie es ist, die uns alle am Leben hält.«
»Ich danke Euch«, erwiderte Aghi schüchtern. »Ihr seid zu großzügig. Und Ihr schenkt mir Mut, obwohl die Zeiten düster sind. Ich verstehe, warum die Männer ihr Vertrauen in Euch setzen. Ihr wisst, was Ihr tut.«
Desiderius blickte gen Boden und hauchte zu sich selbst: »Ich hoffe, sie setzen es nicht in den falschen.«
»Wie könnten sie, nach allem, was Ihr riskiert habt, nur um wieder herzukommen. Ihr hättet auch fortbleiben und uns unserem Schicksal überlassen können.«
Desiderius seufzte gequält. »Ich bin wegen unglücklicher Zufälle hier, Aghi. So habe ich nicht wiederkehren wollen. Nicht ohne …« Wexmell …
Es konnte noch so viel Zeit vergehen, er konnte noch so viele glückliche Stunden mit Cohen verbringen, oder mit Bellzazar lachen, oder mit Eagle streiten, der Alltag mochte sich einstellen, doch der Schmerz, wenn er an Wexmell dachte, würde nie vergehen. Er würde ihn begleiten, wie ihn seine Naben begleiteten. Nur, dass diese Narbe auf seinem Herzen lag und für andere unsichtbar blieb. Aber es war mehr als eine Narbe, die dort zu Hause war, auch Luros und Allahads Verlust ließ ihn fast in Kummer vergehen.
Er hatte sie geliebt, sie waren seine Familie gewesen. Allesamt.
Das einzige, das ihn wirklich aufrecht hielt und ihn trotz des Schmerzes glücklich machen konnte, war allein Cohen. Und genau deshalb empfand er eine derart tiefe Liebe für diesen Mann, für die er sich beinahe schämte, weil er manchmal das Gefühl hatte, Wexmell ersetzt zu haben. Wobei das gar nicht möglich schien.
Trotzdem, die Liebe zu Cohen war ebenso … einmalig. Bedeutend. Tief und unantastbar. Rein. Und deswegen würde er stets Schuld empfinden.
Aber sein Herz ließ sich davon nicht bremsen, es sehnte sich nach Cohen, und Desiderius würde sich diesen Gefühlen nicht verweigern. Nicht nachdem er erfahren hatte, wie wichtig es war, alles zu genießen, was einem gegeben wurde, ehe es ihm irgendjemand wieder wegenehmen konnte. So war es bei Rahff, der sich ihm entzogen hatte, so war es bei Wexmell, der ihm von ihren Feinden genommen worden war, aber bei Cohen würde es anders sein. Das schwor er sich hoch und heilig. Er würde Cohen niemals wieder gehen lassen, oder zulassen, dass ihn irgendjemand oder irgendetwas verletzte. Nichts würde ihn und Cohen trennen, nicht einmal das Schicksal, dafür würde er sorgen!
»Aber Ihr habt wiederkommen wollen«, sagte Aghi lächelnd, »und hier seid Ihr. Stark und mutig genug, Euch gegen die Kirche zu stellen. Groß und ebenso prächtig wie mächtig, weshalb Eure Feinde schon beim Klang Eures Namens einen Schrecken bekommen.«
Schmunzelnd hob Desiderius den Blick. »Mir düngt, du bewunderst mich ein wenig mehr als die anderen.«
Der Junge lief feuerrot an und senkte den Blick.
»Nicht, dass ich es nicht genießen würde«, flüsterte Desiderius mit einem spitzbübischen Lächeln.
Aghi lächelte verlegen zurück. »Es gibt gewisse Gerüchte, die die Runde machen, und einige Dienstmägde zum Weinen, und den ein oder anderen Stallburschen zum Schwärmen brachten.«
Desiderius lachte leise in sich hinein. »Wenn dem so ist, sollte ich den Ställen wohl öfter mal einen Besuch abstatten. Es scheint, als könnte es sich für mich lohnen.«
»Lieber nicht.«
»Warum?«, fragte Desiderius verwundert.
»Weil ein Streit um Eure Gunst entfachen könnte«, erklärte Aghi frech grinsend.
»Oh.« Desiderius wackelte mit den Augenbrauen. »Verstehe.«
Sie lachten miteinander.
»Hast du nichts zu tun?«, fauchte es von der Seite.
Plötzlich stand Cohen neben ihnen und blickte mit eisiger Feindseligkeit auf den verwunderten Stallburschen herab. Sein Schatten fiel wie eine Mauer zwischen sie. »Such dir eine andere Schwärmerei, Bursche, das Bett des Blutdrachen beanspruche ich allein.« Letzteres knurrte er wie ein Löwe.
Desiderius sah stirnrunzelnd zu Cohen auf, während Aghi sprachlos zwischen ihnen hin und her blinzelte. Es genügte, dass Cohen seine Augenbraue noch ein Stück weiter nach oben zog, damit der Junge rasch vom Fass sprang.
»Ja, Herr!« Er verbeugte sich zum Abschied. »Vergebung, Herr. Ich wollte nicht ... Vergebung.«
Als er außer Hörweite war, entspannte Cohen sich etwas, und ging an Desiderius vorbei, um sich im Schatten auf den Boden an eine kühle Mauer zu setzen.
Er sah gut aus, wenn er wütend war. Kaum bedrohlich, ehe wie ein junger Fuchs, den man mit einem Stock ärgerte, und der daraufhin zornig die Nase kräuselte und die Ohren anlegte.
»Ich ahnte ja nicht, dass du so eifersüchtig bist, Geliebter.« Desiderius nahm seine Arbeit wieder auf.
Cohen verschränkte die Arme vor der Brust. »Du hast mir ein Versprechen gegeben!«
»Vertraust du mir so wenig?«
»Ja.«
Lachend warf Desiderius ihm einen Blick zu, doch auch sein schiefes Lächeln konnte Cohen kein Schmunzeln entlocken. Eisig blickte das verbliebene rotbraune Auge in Desiderius‘ Gesicht.
Cohen war schwierig. Nie leicht zu besänftigen. Doch gerade diese Herausforderung reizte Desiderius jeden Tag aufs Neue. Manchmal ärgerte er ihn absichtlich, nur um zu streiten. Äußerte Bemerkungen, die Cohen eifersüchtig machten. Oder zog ihn damit auf, dass er den Göttern huldigte und zum Beten in die Kapelle ging. Er fand immer etwas, womit er Cohen irgendwie zur Weißglut treiben konnte. Wenn Cohen einmal sauer war, benötigte es einiges an Verführungstaktik und hinreißendem Charme, um ihn wieder froh zu stimmen.
Cohen konnte auch gelegentlich gut austeilen, sollte Desiderius es mal wieder übertreiben. Mehr als einmal war ein Streit in eine Rangelei übergegangen, weil Cohen sich, wenn er nicht mehr weiterwusste, gegen Desiderius warf und ihn niederringen wollte. Stets ließ sich Desiderius auf den weniger ernstgemeinten Kampf ein, lachte und versuchte, Cohen unter sich festzunageln. Cohen wusste, sich zu wehren, schlug ernsthaft zu, wenn Desiderius versuchte, ihn mit Küssen zu verführen, oder mit den Händen unter seine Kleidung zu gelangen.
Meist gewann Cohen doch wieder die Oberhand, aber wenn es soweit war, hatte Desiderius bereits genug Lust entfacht, um der Rangelei etwas Sinnliches einzuverleiben. So wurde aus ihren Streitigkeiten und Kämpfen häufig ein Inferno entfesselter Lust.
Hinterher war das gesamte Zimmer verwüstet, und Desiderius lag erschöpft und wie erschlagen, am Ende aller Kräfte auf dem Rücken, unfähig sich zu bewegen, bedeckt von Schweiß, aber selig grinsend.
»Es war nur eine harmlose Schäkerei«, beschwor Desiderius ihn nun, »benimm dich nicht wie eine betrogene Ehefrau, das steht einem Mann wie dir nicht gut zu Gesicht.«
Erneut schenkte er Cohen ein freches, schiefes Lächeln. Wieder prallte es wirkungslos an ihm ab.
»Es war respektlos meiner Person gegenüber«, konterte Cohen knapp und wandte den Blick ab. Er starrte durch die Gegend, bereit, jeglichen weiteren Konkurrenten anzufauchen.
Desiderius stöhnte kopfschüttelnd über diese Eifersucht und zog den Wetzstein wieder über die Schneide der Drachenflügelklinge. Das Schwert lag quer über seinen langen Beinen, die unter dem schwarzen Leder in der Sonne allmählich unangenehm zu schwitzen begannen. Jedoch war sein Unmut nur Theater, denn er fühlte sich durch Cohens Eifersucht keineswegs gestört oder gar eingeengt. Er mochte es sogar, dass Cohen willig war, sein Revier zu verteidigen. Es schmeichelte Desiderius, und erhitzte zugleich sein Blut. Wie gerne er seine Pflichten vergessen hätte, um Cohen in den Ställen zu beweisen, dass er sich nicht vor Konkurrenz fürchten brauchte.
»Willst du jetzt die ganze Zeit da sitzen bleiben?«, fragte Desiderius amüsiert, jedoch ohne sich nach Cohen umzudrehen. »Wie ein Habicht, der sein Nest bewacht?«
»Ganz genau.«
Desiderius zuckte mit den Schultern. »Gut. Wenn es dich glücklich macht.« Er warf Cohen noch ein drittes Lächeln zu, das nicht erwidert wurde. »Allerdings bevorzuge ich es mehr, hinter deinem Rücken zu stehen, Liebster.«
Cohen drehte ihm das ungerührte Gesicht zu. »Du kannst mich mal.«
»Aber doch nicht vor allen Leuten!«
Cohen zeigte ihm eine anzügliche Handgeste, doch diesmal zuckte ein Schmunzeln in seinen verräterischen Mundwinkeln.
»Ich komme später darauf zurück«, versprach Desiderius herumalbernd, als er sich wieder umdrehte, um seine Klinge endlich zu Ende zu schärfen.
»Vielleicht habe ich heute keine Lust«, konterte Cohen trotzig.
»Auch gut. Ich weiß ja jetzt, wo ich Ersatz finde«, lachte Desiderius. »Aua! He!«
Ihn traf ein Dreckklumpen am Hinterkopf, der zerschellte und zu Boden rieselte, einige Bröckchen blieben in seinem dunklen Haar kleben. Mit verengten Augen sah er Cohen strafend an, der jedoch nur arrogant mit den Schultern zuckte, sodass seine Kettenrüstung klimperte.
»Na, na!« Bellzazar trat zu ihnen, das schwarze Hemd stand ihm bis zum Bauchnabel offen und gab die von vielen Kämpfen vernarbte Brust preis. »Rieche ich da etwa bereits Fäulnis im lieblichen Duft der naiven Verliebtheit?«
Cohen fasste ihn mit giftigen Blick ins Auge. »Hau bloß ab, Dämonenbrut.«
Zazar zog verwundert den Kopf zurück. »Und dabei habe ich noch nicht einmal begonnen.«
»Beachte ihn gar nicht, Zazar«, Desiderius blickte zu seinem Bruder auf, »sein Magen macht ihm wieder Probleme, da benimmt er sich leider stets wie ein Wesen der weiblichen Gattung in der unfruchtbaren Zeit ihres monatlichen Zyklus.«
Cohen riss schockiert den Mund auf. »Was?«
Desiderius drehte sich zu ihm um. »Wie? Das hast du verstanden?«
»Ich bin keine verblödete Dirne, du Arschloch!«, konterte Cohen. Der starre Blick und seine nach oben gekräuselte Lippen ließ Desiderius wissen, dass er kurz davorstand, ihn anzuspringen und zu Boden zu werfen. Wären sie jetzt in ihrem Zimmer und für sich alleine, hätte er es nur zu gerne darauf ankommen lassen. Er grinste und spitzte die Lippen zu einem Kuss.
Cohen verzog geradezu angewidert das Gesicht. »Nie mehr wieder. Küss doch deine zwanzig Stallburschen!«
»Bekomme ich die Erlaubnis dazu?«, fragte Desiderius geradezu erfreut.
»Natürlich!«, säuselte Cohen und grinste übertrieben freundlich. Dann wurde er augenblicklich wieder bitterböse. »Sie können dein Gemächt haben, wenn ich es mit einer Klinge von deinem Körper getrennt habe.«
Desiderius spürte ein schmerzliches Ziehen im Unterleib. Er verzog angewidert sein Gesicht. »Das ist widerlich.«
»Nicht halb so widerlich wie ein alter Mann, der den jungen Burschen nachsteigt.«
Vergnüglich lachend legte Desiderius den Kopf in den Nacken. Als er Cohen wieder ansah, konterte er gelassen: »Vergiss nicht, dass du mit besagtem altem Mann das Bettlager teilst, mein schlaues Füchschen.«
Cohen strafte ihn mit einem eisigen Blick. »Götter, wie ich dich hasse!«
»Nein, tust du nicht.« Desiderius drehte ihm wieder den Rücken zu, er grinste wissend und arrogant in sich hinein. »Du liebst mich.«
»Ja, aber die Gefühle schwinden«, konterte Cohen.
Erschrocken drehte sich Desiderius wieder auf seinem Fass um. Cohen zuckte wieder überheblich mit den Achseln und drehte hochnäsig sein Gesicht fort.
Lachend fasste Bellzazar sich an den Bauch. »Oh das Schicksal führte mich zu einer ungünstigen Zeit zu Euch. Vergebt mir, dass ich vor der Versöhnung stören muss.«
Cohen brummte plötzlich. Er hielt sich den Magen und rutschte unbehaglich auf dem staubigen Boden hin und her. Als er Desiderius` ängstlichen Blick jedoch bemerkte, riss er sich zusammen und versicherte, es ginge ihm gut.
»Ich habe nur Hunger«, sagte er. Doch er log, das konnte Desiderius ihm ansehen. Er beschloss, nachher mit Cohen allein darüber zu sprechen. In diesem Zustand würde er Cohen nicht mitnehmen. Auch wenn sie eigentlich nicht auf Cohen verzichten konnten, war es Desiderius wichtiger, dass Cohen in Sicherheit war. Ein krampfender Magen auf dem Schlachtfeld wäre Cohens Todesurteil. Aber diese Diskussion ging nur sie beide etwas an.
Desiderius wandte sich an seinen Bruder. »Was gibt es denn?«
Doch Bellzazar beäugte zunächst, nachdem sein Lachen verklungen war, Cohen mit einem Blick, der Desiderius umgehend nervös werden ließ.
»Stimmt etwas nicht?«
Auch Cohen bemerkte, wie er gemustert wurde, und wurde hellhörig.
»Nein.« Bellzazar riss sich zusammen und schüttelte den Kopf. »Aber eine Hexe sollte sich Cohens Problem einmal anhören. «
Cohen sackte wieder gegen die Mauer. »Nicht, dass wir eine da hätten …«
»Deswegen wollte ich mit dir sprechen«, wandte sich Bellzazar an seinen Bruder. Aufmerksam sah Desiderius zu ihm auf. »Rahffs Verbündete ließen Hexen verfolgen. Magie könnte uns jetzt also einen entscheidenden Vorteil bringen, da er sie nicht nutzen kann. Es können nicht alle Hexen getötet worden sein, wir sollten unsere Bemühungen darauf verwenden, mindestens eine zu finden. Sei es nur, um unsere Verletzten schneller gesunden zu lassen.«
»Gut, dass du damit anfängst.« Desiderius legte den Wetzstein Beiseite und steckte das Schwert in die Scheide. »Wir kennen doch bereits eine sehr mächtige Hexe, die uns treu ergeben wäre. Karrah. Ihr Kind müsste längst geboren sein, vielleicht kann ich sie überreden, uns zu helfen. Sie muss ja nicht bleiben, nach dem Krieg kann sie zu ihrer Familie zurück.«
Bellzazar verspannte sich kaum merklich, doch Desiderius und Cohen fiel es auf. Sie runzelten verwundert die Stirne.
Bellzazar schien plötzlich empört: »Du willst eine frisch gebackene Mutter von ihrem Sohn trennen, der noch nicht einmal seinen ersten Winter hinter sich gebracht hat?«
Desiderius ließ ernüchtert die Schultern hängen, so hatte er das nicht gesehen.
»Und wenn sie stirbt? Hast du das bedacht?«
»Du hast ja Recht. Meine Überlegung entstand aus Verzweiflung.«
»Sie könnte draufgehen und hinterließe ein neugeborenes Kind«, schimpfte Bellzazar mit ihm. »Du kannst sie nicht um Hilfe bitten. Verstehst du es noch immer nicht? Ich löste dieses verfluchte Band zwischen ihr und mir, damit sie endlich ein normales Leben führen kann, ohne an mich oder meine Angelegenheiten gebunden zu sein. Ich will sie nicht hier haben, ich will, dass sie ihr Leben so lebt, wie sie es für richtig hält. Ohne ständig das Bedürfnis zu haben, durch ihren Glauben an das Schicksal, mich irgendwie bremsen zu müssen. In unserer Nähe wird sie stets in Gefahr sein, das kannst du nicht wollen. So selbstsüchtig kannst selbst du nicht sein, Bruder.«
Den Kommentar seines Bruders nicht beachtend, fragte Desiderius diesen: »Und wo, denkst du, finden wir Hexen? Wenn sie verfolgt wurden, werden sie gewiss zu ängstlich sein, sich zu zeigen. Sie sind sicher gut versteckt, und trauen niemanden.«
»Ich bezweifle, ob Hexen tatsächlich so etwas wie Furcht empfinden.« Bellzazar schauderte. Obgleich er Hexen kein Vertrauen schenkte, wusste er jedoch um den Vorteil ihrer Magie.
»Das beantwortet nicht die Frage, wo wir anfangen sollen, sie zu suchen, falls noch welche leben.«
»Es gibt welche westlich des Gebirges, in den Wäldern der Schwarzfelsburg«, sagte Cohen plötzlich und stand auf. Er klopfte sich den Dreck von den Hosen, als er sich zu ihnen stellte und berichtete. »Sie nennen sich selbst den Hexenzirkel, und sagen für Opfergaben den Menschen ihre Schicksale voraus.«
Desiderius und Bellzazar sahen sich an.
Zazar zog die Augenbraune hoch. »Sieh mal einer an, dein Lustknabe ist ja tatsächlich zu mehr nütze, als dir den Schwanz zu streicheln.«
»Genug«, warnte Desiderius nun ernst, »sonst werde ich wütend.« Es war eine Sache, wenn er selbst Cohen provozierte, denn Cohen wusste, dass er es niemals ernst meinte. Aber er würde nicht gestatten, das andere Cohen zu nahetraten.
»Ich kann mich auch selbst verteidigen«, zischte Cohen ihn an.
Seltsam, dabei war Desiderius doch gerade auf seiner Seite gewesen. Aber Cohen war mindestens halb so stolz wie er, weshalb es nicht leicht war, ihn in Schutz zu nehmen, ohne ihn zu beleidigen.
Wie gesagt, Cohen war schwierig, aber genau deswegen liebte er ihn.
Bellzazar hob beruhigend die Hände. »Cohen weiß doch, wie ich es meine.«
Doch Cohen sah ihn ärgerlich an. »Weiß ich das?«
»Nun gut«, unterbrach Desiderius das unnötige Verschwenden von Atemluft, er wollte jetzt zum wesentlichen Punkt kommen. »Und wie erreichen wir den Hexenzirkel, um mit ihnen reden zu können, ohne dass Rahff etwas davon mitbekommt?«
»Wenn er sie nicht längst gefunden hat«, befürchtete Cohen.
»Herr?«
Sie drehten sich alle drei zu dem Mann um, der in Plattenrüstung in der Sonne stand, und sie dringlich anstarrte.
Die Wache vom Tor sprach zu Desiderius: »Ein reiterloses Pferd vor den Toren, Herr. Wir dachten, das wollt Ihr selbst sehen.«
»Das ist Wanderer«, seufzte Desiderius und winkte den Mann fort, »lasst ihn rein, er findet den Weg zu den Ställen selbst. Keine Sorge, er ist nicht wild.«
Doch die Wache zögerte. »Vergebung, Herr, doch Wanderer ist uns wohl bekannt.
Es ist ein hellbraunes Pferd, kräftig und schön. Ein Kaltblut. Es trägt das Brandzeichen der Schwarzfelsburg, Herr.«
Cohen horchte sofort auf. »Ist es eine Stute?«
Die Wache zuckte mit den Achseln. »Kann schon sein.«
Bevor Desiderius begriff, was vor sich ging, eilte Cohen an ihm vorbei und ließ sie allesamt stehen.
Fluchend, weil er nicht wusste, was eigentlich los war, eilte Desiderius Cohen nach. Bellzazar folgte ihnen auf dem Fuße.
Je näher sie dem Tor kamen, je eiliger hatte es Cohen. Es wurde für Desiderius immer schwieriger, ihm zu folgen. Er bahnte sich mit Bellzazar im Schlepptau einen Weg durch die vielbeschäftigte Menge der Festungsbevölkerung. Knechte trugen Schwerter und Rüstungen vom Schmied und Schneider durch die Gegend. Bäuerinnen trugen überfüllte Eimer und Säcke mit Vorräten zu den Kasernen, wo sie für den Aufbruch aufgeteilt und verpackt wurden. Die wenigen Kinder, die Desiderius nur weiterhin duldete, weil sie die letzten Nachkommen seines Volkes waren, jagten Hunden hinterher, sodass sie geradezu gefährliche Stolperfallen bildeten. Desiderius fluchte verhalten, als er beinahe über einen Jungen fiel, der verschreckt von Dannen zog und von einer sicheren Ecke aus mit großen Augen zu ihm blickte, als erwartete er, Desiderius würde ihm nach eilen und im Genick packen um ihn zu rügen.
»Du machst den Kindern Angst, mein Bruder«, lachte Bellzazar ihm ins Ohr.
Desiderius konnte sich nicht damit aufhalten, er nickte dem Jungen zu, und hoffte, es würde reichen, ihn zu beruhigen. Dann versuchte er, Cohen wieder einzuholen, der sich gerade durch eine Wachpatrouille schob.
»Cohen!« Desiderius eilte ihm nach, bahnte sich mit den Händen einen Weg durch die disziplinierten Wachen, die ihn erst ärgerlich ansahen, weil er ihre Schultern berührte, um sie auf die Seite zu schieben, jedoch aus dem Weg sprangen, als sie ihn erkannten, damit er ungehindert passieren konnte.
Es gelang ihm, Cohen bis auf zehn Schritte einzuholen, dafür keuchte er allerdingst, weil sein Körper nicht für lange Laufereien durch die Mittagshitze gemacht war. »Cohen, warte! Was …«
Kaum war das Tor in Sicht, rannte Cohen plötzlich los, als hätte jemand hilferufend seinen Namen geschrien.
»Öffnet das Tor!«, rief er zu den Wällen hinauf, ehe Desiderius ihn aufhalten konnte. »Öffnet sofort das Tor!« Cohen warf sich dagegen. »Hört ihr nicht?«
Keuchend – und seine schweren Muskeln verfluchend – kam Desiderius hinter Cohen an und trug den verwunderten Torwachen gelassen auf: »Öffnet das Tor.«
Eine Welle der Bewegung ging durch die drei Wachen am Tor auf den Wällen. Umgehend gaben sie Befehle weiter, woraufhin sich knarrend die massiven, mit schwarzem Eisen verstärkten Tore öffneten.
Desiderius fasste Cohen an der Schulter und musste ihn zurückziehen, damit er nicht von den sich langsam öffnenden Toren einfach Beiseite geschoben wurde.
Er hielt Cohens zitternden, aufgewühlten Leib an den Schultern fest, während sie warteten.
»Verrätst du mir, was hier los ist?«, fragte er Cohen ins Ohr. Er wusste nicht, was genau vor der Festung auf sie wartete, doch was es auch war, es war ihm fremd und konnte Cohen gefährlich werden. Deshalb hatte er an seiner Seite stehen wollen. Er würde Cohen nach der Sache, die vor einigen Wochen in der Nähe dieser Festung vorgefallen war, nie wieder irgendwo alleine hingehen lassen.
Cohen schüttelte den Kopf, als wäre er zu aufgebracht, um eine Erklärung vorzubringen. Doch er versuchte es wenigstens: »Sie ist hier. Ich kann sie jetzt spüren.«
»Wer?«, fragte Desiderius, darum bemüht, seine Ungeduld nicht erkennen zu lassen.
»Galia!« Cohen rief das Wort nicht zur Antwort. Kaum hatte sich ein Spalt zwischen den Toren aufgetan, konnten sie das lange Pferdegesicht dazwischen erkennen, dass mindestens ebenso danach drängte, hineingelassen zu werden, wie Cohen hinauswollte.
»Cohen, warte-«
Aber er hatte sich bereits losgerissen und schlängelte sich mit klimpernder Kettenrüstung durch den Spalt. Herr und Tier fielen stürmisch übereinander her. Und wenn Desiderius daran dachte, welch tiefe Verbindung Luro zu seiner Nachtschattenkatze Marrah gehabt hatte, konnte er die Wiedersehensfreude sogar fast verstehen.
Kopfschüttelnd lächelte er.
»Darf ich dir einen Rat geben?« Bellzazar trat hinter ihn. Ihm war die Frechheit, die folgen würde, bereits in der Stimme anzuhören. »Du magst zwar dank deiner breiten Schultern und starken Arme ein großes Schwert führen können, doch wenn dich ein so kurzer Sprint bereits in Atemnot versetzt, sollten wir uns mal deiner Ausdauer zuwenden.«
»Leck mich.«
Bellzazar kicherte. »Gräme dich nicht. Du hast andere Qualitäten. Andererseits frage ich mich, ob du angesichts deiner geringen Ausdauer im Stande bist, einen Jungspund wie Cohen zu befriedigen.«
»Immer wieder erstaunlich«, sagte Desiderius trocken, während er mit verschränkten Armen Cohen beobachtete, der die Arme um den Kopf der schönen braunen Stute schlang und die Wange an ihre Stirn lehnte. So glücklich sah man ihn selten lächeln, es erwärmte Desiderius das Herz.
»Meine Unverfrorenheit?«, säuselte Bellzazar. Er hob eine Hand und fuhr mit einem Finger geradezu spielerisch über Desiderius‘ Nacken, um den Dreck zu entfernen, der noch von Cohens Wurfattacke übriggeblieben war.
»Nein«, konterte Desiderius, »die Tatsache, wie sehr du auf mein Liebesleben fixiert bist.«
Bellzazar lachte frech. »Was soll ich sagen? Dein Versagen ist meine Freude, Bruder.«
»Hau ab«, knurrte Desiderius.
Erneut kicherte Bellzazar. »Niemals.«
Desiderius warf ihm über die Schulter einen nicht ganz ernstgemeinten genervten Blick zu, während auf seinen Lippen ein amüsiertes Grinsen lag.
Dann ging er langsamen Schrittes zu Cohen, sehr darauf achtend, Bellzazar nicht zu zeigen, dass er noch immer schwer atmete.
Liebevoll strich Cohen über den kräftigen Hals der stolzen Stute, sein Kopf lag an ihrer Wange, während er leise mit ihr flüsterte. »Ich habe dich so vermisst.«
Desiderius und Bellzazar gesellten sich zu ihnen.
»Sollen wir dich und deine neue Freundin alleine lassen?«, fragte Bellzazar scherzend. »Braucht ihr ein Zimmer? Oder genügt euch auch der Stall?«
»Ignorier ihn«, sagte Desiderius zu Cohen, als er dicht hinter ihn trat.
Cohen drehte sich zu ihm um. »Das hatte ich vor.«
Die Stute betrachtete mit ihren großen braunen Augen Desiderius mit gesundem Argwohn. Sie hob zunächst den Kopf, um sich größer als er zu machen. Desiderius streckte langsam eine Hand nach ihr aus und gestattete ihr, zunächst daran zu schnuppern.
Ihre riesigen Nüstern bliesen sich auf, warmer Atem traf auf seine Knöchel. Dann senkte sie stockend, als sei sie noch nicht gänzlich sicher, den Kopf. Erst als sie entspannt einen Huf einknickte, legte Desiderius ihr seine große Hand auf die Stirn und streichelte sie.
»Das ist Galia«, erklärte Cohen. »Mein Begleittier.«
»Das hast du mal erwähnt, ja«, erinnerte sich Desiderius. Er würde nie etwas vergessen, das Cohen ihm erzählt hatte. »Aber – verzeih, lass dir von mir nicht die Wiedersehensfreude trüben – Doch, wie kam sie hier her?«
»Und zu welchem Zweck?«, fragte Bellzazar.
»Sie ist wohl kaum ein Spion«, lachte Cohen. Er umschlang den Hals seiner Stute und drückte sie wieder an sich wie ein Kind seine Puppe. »Sie ist eine Freundin. Sie muss gewusst haben, wo ich bin. Wir sind verbunden, sie muss es fühlen.«
»Wenn sie allein kam, ist sie auch unversehrt?«, fragte sich Desiderius. Er umrundete Galia und ließ dabei bewundernd die flache Hand über ihren starken Hals und die kräftige Flanke gleiten. Sie hatte stämmige Beine, große Hufe, einen langen Schweif und eine volle Mähne. »Sie ist prächtig, Cohen, wahrlich.«
»Ich weiß.« Cohen klopfte ihr den Hals. In seinen Augen funkelte der Stolz eines Vaters, was Desiderius schmunzeln ließ.
Diese Jäger und ihre Begleiter, dachte Desiderius amüsiert. Immer wieder verblüffte ihn diese seltsame Verbindung zwischen Tier und Mensch. Auch er liebte Wanderer, und Wanderer respektierte ihn, aber das war nicht mit dem zu vergleichen, was ein Jäger mit seinem Begleittier teilte. Diese Bindung war nicht in Worte zu fassen. Sie waren nicht Herr und Tier, sondern Freunde. Gefährten. Familie. Eins. Das hatte Luro einmal erklärt, und Desiderius hatte nie weiter nachgefragt. Mittlerweile ahnte er, was Luro ihm hatte sagen wollen, denn seit Cohen eine Verbindung mit dem Drachen in Desiderius hergestellt hatte, war nichts mehr, wie es einmal war. Sie gehörten jetzt zusammen. Ihre Gefühle und Gedanken waren unwiderruflich miteinander verflochten. Sie waren Eins, vor allem wenn Desiderius den Drachen herausließ.
Bellzazar kam grinsend näher, als er Desiderius‘ grübelnde Miene richtig gedeutet hatte. »Sie wäre eine gute Gefährtin für Wanderer.«
Über Galias breiten Rücken hinweg grinste Desiderius seinen Bruder an. »Sie hat die richtigen Qualitäten, um Wanderer gute Nachkommen zu schenken.«
»Untersteh dich!«, wandte Cohen sofort ein. »Sie ist ein Kavalleriepferd, keine Zuchtstute. Ich lasse nicht zu, dass irgendein Hengst sie besteigt.«
»Seit wann hat er solch Probleme mit dem Besteigen?«, fragte Bellzazar seinen Bruder.
Cohen ließ die Schultern hängen und sah ebenfalls Desiderius an. »Ich bin versucht, deinen Bruder von der Brücke zu schubsen.«
»Bitte, tu dir keinen Zwang an«, erwiderte Desiderius, während er damit fortfuhr, die Stute zu umrunden.
Cohens Blick schnellte triumphierend zu Bellzazar zurück.
In Abwehr riss Bellzazar die Hände hoch und ging drei Schritte rückwärts. »Ich spüre, es ist Zeit für mich zu gehen, ehe ihr euren bösartigen Plan noch in die Tat umsetzt. Alsdann, wir sehen uns beim Abendmahl, meine Damen …«
»Ich werde dir heute noch mit irgendwas das Maul stopfen, Bellzazar«, drohte Cohen ärgerlich.
Bellzazar lachte nur, als er sich zum Gehen wandte.
»Wartet!« Desiderius entdeckte etwas in der vollen Mähne der Stute. Zunächst hatte er es für einen Knoten gehalten, den er mit den Fingern auszukämmen versuchte, doch dann hatte er das unverkennbare Knistern von Pergament vernommen. »Sie hat etwas im Haar.«
Bellzazar drehte sich sofort mit neugierigem, ernsten Blick um.
Verwundert kam Cohen auf Desiderius‘ Seite und besah sich an, was er aus der Mähne befreite.
»Was …«, Cohen blickte ihn fragend an, » … soll das sein?«
Desiderius zuckte mit den Achseln. Er wollte nicht länger raten und entrollte das Pergament ohne weitere Worte. Wie erwartet, befand sich eine Botschaft auf dem Papier, doch zunächst stand sie auf dem Kopf. Desiderius drehte sie um und las.
Ihm stand der Mund offen, als er geendet hatte. Er war im ersten Moment nicht imstande, die Worte zu verstehen, wollte sie nicht verstehen.
Wie betäubt schüttelte er den Kopf.
»Was ist es?«, fragte Cohen, er versuchte, die Botschaft zu lesen und lehnte sich dabei immer weiter über Desiderius‘ Hände.
»Bruder?« Bellzazar kam besorgt näher, er schien zu spüren, dass etwas Desiderius erschüttert hatte.
»Die Botschaft ist für dich.« Desiderius gab den Brief schmallippig an Cohen weiter und drehte ihm umgehend den Rücken zu, weil er nicht sehen wollte, was sich anschließend in Cohens Gesicht abspielte. Er ahnte die Folgen der Botschaft bereits.
Cohen las. Es schien eine Ewigkeit zu dauern, als würde er mehr als einmal die Worte lesen und sich einverleiben.
Wie betäubt hauchte er schließlich: »Er hat Sigha und die Kinder.«
Bellzazar hatte sich über Cohens Schulter gelehnt und mit ihm gelesen. Er schüttelte frustriert den Kopf. »Und, ganz wie befürchtet, den besagten Hexenzirkel. Verfluchter Bastard!«
Zazar schimpfte ungehalten.
Cohen ballte eine Faust, sodass er den Brief zerknüllte. »Ich muss zurück.«
Gequält schloss Desiderius die Augen. Sein Alptraum begann von vorne, denn schon wieder verließ ihn ein Youri für Frau und Kind.
***
»Du gehst nicht zurück, basta!«
Als die Worte im Raum erklangen, hätte Desiderius sich am liebsten auf Eagle gestürzt und in voller Dankbarkeit niedergeküsst.
Cohen, bereits auf dem Weg zu Tür, nachdem er Eagle erklärt hatte, warum er umgehend aufbrechen musste, drehte sich mit offenem Mund wieder um.
»Aber …« Cohen sah sich hilfesuchend nach allen Seiten um, doch weder von Bellzazar noch von Desiderius war Hilfe zu erwarten, selbst sein Freund Arrav wich seinem Blick aus. Er wandte sich wieder an Eagle, der mit dem Rücken zu ihnen stand und aus dem Buntglasfenster des Ratsraumes der Festung starrte.
»Hast du nicht gehört, was ich sagte? Eagle! Rahff will Sigha zwingen, ihn zu heiraten! Er hat meine Kinder! Meine Frau!«
»Ich habe dein Anliegen vernommen«, sagte Eagle ungewohnt streng. Er drehte sich um und sah Cohen unnachgiebig in das fassungslose Gesicht. »Und du hast meine Antwort darauf gehört. Ich kann dich nicht gehen lassen. Nicht jetzt. Wir werden über diese Sache reden, wenn wir die erste Schlacht geschlagen haben. An der Violetten Küste brauche ich dich, es ist nicht möglich für uns, auf deine Fähigkeiten zu verzichten.«
Es war Cohen sehr deutlich anzusehen, dass er nicht glauben konnte, was er hörte. Als habe ihn jemand niedergeschlagen, gegen den er sich nicht wehren konnte, ließ er die Schultern hängen.
Desiderius senkte stumm den Kopf. Er schämte sich, weil er absichtlich verheimlichte, dass Cohen vielleicht gar nicht am Kampf beteiligt sein würde. Nicht, wenn Desiderius nicht sicher war, dass Cohens Magen keine Probleme machte. Doch das stand nun ohnehin alles auf einem anderen Blatt, nicht wahr? Er hob eine Hand und kaute, ganz untypisch für ihn, geradezu ängstlich an seinem Daumennagel, weil er sich daran hindern musste, loszubrüllen. Es stand ihm nicht zu, Cohen anzuflehen, zu bleiben. Außerdem fürchtete er dessen Antwort darauf.
»Es tut mir leid, mein Freund«, sagte Eagle etwas mitfühlender zu Cohen, »aber bedenke auch, wie lange die Botschaft brauchte, um dich zu erreichen. Rahff wird die Ehe mit deiner Frau längst vollzogen haben. Und wenn nicht, würdest du sie nie erreichen, um es zu verhindern. Es tut mir leid, Cohen, du kannst nichts tun.«
»Ich gehe!«, sagte Cohen trotzig. Es war das erste Mal, dass Desiderius mitbekam, das Cohen sich gegen die Befehlskette stellte. Für gewöhnlich war es ihm geradezu ein Zwang, Vorgesetzten zu gehorchen.
Eagle drehte sich ihm gänzlich zu, sein Blick verriet, dass er auf gefährlich ärgerliche Weise empört über Cohens Trotz war. »Wie bitte?«
»Ich-«
»Das ist Selbstmord, Cohen.« Desiderius‘ Einmischung erstickte den Streit im Keim, sie schenkten ihm ihre Aufmerksamkeit. Nur Cohen wagte nicht, ihn anzusehen.
Mit verschränkten Armen lehnte Desiderius an der gegenüberliegenden Wand der Tür, er hatte sich selbst nicht getraut und vermutet, dass er sich, wenn Cohen durch sie hindurchgehen wollte, wie eine Wand davor aufbauen würde. Doch es stand ihm wohl kaum zu, sich zwischen Cohens Pflichten als Ehemann zu stellen. Denn streng genommen war Desiderius das, was er nie hatte sein wollen. Nur eine Liebesaffäre.
Cohens Frau, diese Sigha, ihr gegenüber besaß Cohen eine einzige Pflicht.
Und das schmerzte.
»Du weißt, warum Rahff das tut«, glaubte Desiderius, »er will dich damit zurücklocken. Um dich gefangen zu nehmen. Oder Schlimmeres. Deine Frau schrieb es selbst. Sie warnte dich, nicht zurückzukommen, auch wenn du von der Vermählung hörst. Es wäre dein Tod, Cohen. Es ist nur eine Falle.«
»Nur ein Trick«, stimmte Eagle zu.
Cohens Kopf hing herab, sein Blick starrte weiterhin den Boden an. »Und doch muss ich gehen. Ich muss es zumindest versuchen.«
»Du gehst nicht«, warnte Eagle ihn. »Du hast deine Befehle, Cohen. Ende der Diskussion. Wir werden deine Frau befreien, indem wir Nohva befreien. Dein Alleingang hilft niemanden. Er würde uns nur schaden.«
»Desiderius kann sich nur dann in der Schlacht verwandeln, wenn du ihn führst«, sprach Bellzazar auf Cohen ein, er stand gebeugt über dem Kartentisch, der aus einer uralten Scheibe einer Esche bestand, die im Durchmesser so groß war wie eine königliche Tafel, und verschob die Figuren ihrer Feinde. Er sah auf und Cohen an. »Der Drache kann nur durch dich Freund und Feind unterscheiden. Wir sind im Krieg, wir müssen Prioritäten setzen. Deine Frau ist nicht so wichtig wie das Leben aller anderen. Du bist wichtiger, wir können dein Leben nicht riskieren.«
Cohen schüttelte frustriert den Kopf.
Desiderius hatte das Bedürfnis, zu ihm zu gehen, und ihn zu trösten, doch seine eigenen inneren Gefühle ließen es nicht zu. Er war wie betäubt von der Angst, verlassen zu werden. Cohen zu verlieren. Denn alles, was er jetzt noch hatte, war Cohen.
»Aber wenn du gehen musst«, hörte er sich plötzlich sagen, »werde ich mit dir gehen.«
Mit Tränen in den Augen riss Cohen den Kopf hoch. Seine Miene verzog sich, als könne er die Worte unmöglich glauben. Er keuchte kopfschüttelnd: »Das würde ich nie von dir verlangen.«
»Und doch werde ich es tun«, sagte Desiderius entschlossen, obwohl es ihm das Herz schwermachte, Cohens und sein Leben für eine Frau zu opfern, die er nicht kannte, und dafür Nohva, seine und Wexmells Heimat im Stich zu lassen.
Bellzazar schloss tief durchatmend die Augen. Es schien, als hätte er bereits damit gerechnet, ärgerte sich aber trotzdem darüber, Recht zu behalten. »Das kannst du nicht tun.«
»Für Cohen tue ich es.«
Cohen lächelte tief berührt.
»Rahff wird dich töten!«, warnte Bellzazar zornig.
»Ich werde ihn töten.«
»Du bist noch nicht soweit!«, brüllte Bellzazar derart wütend, wie Desiderius es noch nie erlebt hatte.
Alle rissen verwundert die Augen auf, nur Desiderius blieb unberührt.
Die Brüder starrten sich stur in die Augen.
»Du kannst es noch nicht. Er würde dich mit in den Tod reißen.«
»Zazar, ich werde ihn besiegen! Ich weiß, ich kann es.«
»Ich werde dich nicht gehen lassen.« Bellzazar sah entschlossen hinüber zu Cohen. »Und Cohen auch nicht!«
Verwundert runzelte Desiderius seine Stirn. Es war nicht die Sorge, ihnen könnte etwas zustoßen, die das Gesicht seines Bruders zeichnete, es war panische Angst. Eine so tiefsitzende Furcht, die Bellzazar wie einen verängstigen Jungen dastehen ließ, der vom Vater ausgesetzt und vollkommen hilflos zurückgelassen wurde.
Aber Desiderius konnte keine Rücksicht auf Bellzazars Angst nehmen, wenn Cohen sich in Gefahr bringen wollte.
»Du könntest uns helfen, Bruder. Wir wären zurück, ehe die Truppen die Küste erreichen«, schlug Desiderius vor.
Doch Bellzazar blickte nur grimmig zu Boden. Er murmelte etwas, das klang wie: »Du bist noch nicht soweit.«
»Ich werde gehen«, sagte Cohens Freund plötzlich. Die ganze Zeit hatte er schweigend auf einer Fensterbank in Eagles Nähe gesessen, nun stand er entschlossen auf.
Neugierig betrachtete Desiderius den Reiter, den er noch nicht einschätzen konnte. Aber sein Mut war unumstritten, da er der einzige von Cohens Männern gewesen war, der sich getraut hatte, Rahff zu verraten.
Etwas an ihm hatte sich verändert. Es dauerte einen Moment, bis Desiderius begriff, dass es das glatte Gesicht war, das sich verändert hatte. Der Reiter hatte sich den Bart abrasiert. Die Rasur musste noch frisch sein, denn es waren keinerlei Stoppeln auf der geradezu sagenhaft weichen Haut zu sehen, die derart makellos war, dass man neidisch werden konnte.
Cohen sah ihn dankbar an, schüttelte jedoch den Kopf. »Sie würden dich noch ehe töten als mich, Arrav. Du bleibst hier.«
»Ich bin weder ein Blutdrache, noch im Stande einen zu zähmen, so wie du. Ich bin nur ein einfacher Reiter, der mit dem Schwert umgehen kann. Mein Ableben wäre kein Verlust, also werde ich gehen. Ich kenne die Schwarzfelsburg wie meine sprichwörtliche Westentasche. Ich komme ungesehen rein, hole deine Familie, und komme ungesehen zurück.«
»Nein!« Eagle trat an den Tisch heran und unterbrach sie mit strenger Stimme. »Keiner geht irgendwohin, ehe ich es nicht befehle. Ansonsten nennt man das Fahnenflucht, und auch wenn ich euch alle Freunde nenne, zweifelt nicht daran, dass ich euch verfolgen lassen und zurückholen würde, solltet ihr diese Festung unerlaubt verlassen!«
Desiderius seufzte leise. Er wusste Eagles Versuch, sie zusammen zu halten, zu schätzen, doch glaubte er nicht, dass leergemeinte Drohungen Cohen davon abhalten würden, seine Familie zu retten. Und wenn Cohen ging, würde Desiderius ihn begleiten. Denn zu gut erinnerte er sich daran, was geschehen war, als er Wexmell nur für einen Augenblick zurückgelassen hatte, um Melecay zu verabschieden.
Als er zurückkam, war Wexmell tot.
Und er erinnerte sich auch daran, was das letzte Mal geschah, als er Cohen nur kurz alleine in den Wald gehen gelassen hatte. Nur knapp hatte er ihm das Leben retten können. Leider war er zu spät gekommen, um ihm vor den Qualen zu retten, die ihm Marmar und seine Schar angetan hatten.
Noch immer litt Cohen unter Alpträumen, oder zuckte zusammen, wenn er nicht damit rechnete, berührt zu werden. Solange Desiderius lebte, würde er nicht mehr von Cohens Seite weichen. Er würde seine Fehler nicht wiederholen.
»Eagle, es tut mir leid. Aber es geht hier um meine Familie«, sagte Cohen entschuldigend. »Ich begehe keine Fahnenflucht, ich komme wieder. Es dauert nicht lange, wenn ich den Weg durch die Berge nehme. Ich verspreche es, ich bin rasch wieder an deiner Seite.«
Eagle sah ihm ernst in die Augen, doch seine Worte sprach er ruhig, wenn auch nicht weniger gewichtig: »Ich werde keinen von Euch daran erinnern müssen, welches Opfer ich erbringen musste, damit wir alle überhaupt eine Chance haben.«
Umgehend senkten sich die Köpfe aller im Raum.
Eagle ließ seinen Blick langsam von einem zum anderen wandern, eher er weitersprach. »Ich verstehe deine Gefühle, Cohen. Kein Mann will zulassen, dass der eigene Vater ihm die Frau stiehlt.«
Unbehaglich trat Cohen von einem auf den anderen Fuß. »Sie ist meine älteste Freundin, die alles über mich weiß, und der ich viel verdanke. Ich schulde es ihr.«
»Und meine Mutter war meine Mutter«, konterte Eagle, »die Frau, die mir das Leben schenkte, mich aufzog, und zu meinem Schutz ein ganzes Land verriet.« Seine Stimme senkte sich um eine Oktave, als er flüsterte: »Und im Gegenzug verriet ich sie, um das Unrecht zu sühnen, das sie begangen hat.«
Einen nicht enden wollenden momentlang herrschte betretenes Schweigen. Keiner wagte, aufzusehen oder Eagle zu wiedersprechen, denn er hatte recht. Sein Opfer war das größte gewesen, und er hatte es nicht für sich getan.
»Wir sind alle stolz auf das, was du getan hast«, ergriff Desiderius schließlich das Wort.
Eagle nickte gefasst. Er beeindruckte Desiderius mit der Stärke, die er an diesem Tag zeigte.
»Ich tötete meine Mutter«, sprach Eagle weiter auf Cohen ein, »zum Wohle aller. Und du wirst die Angelegenheit mit deiner Frau verschieben, bis ich mich dessen annehmen kann.«
Cohen taumelte zurück, bis er nahe der Tür auf einen gepolsterten Sessel fiel, der nicht so wirkte, als sei er zum Sitzen gemacht. Unter dem Gewicht von Cohens Muskeln und seiner schweren Kettenrüstung, wölbten sich die Beine des dekorativen Möbelstücks. Er beugte sich vor und stützte das Gesicht in die Hände; er gab sich angesichts Eagles Strenge geschlagen.
»Sie ist stark«, versuchte Arrav Cohen zu beruhigen. Er ging zu ihm und legte seinem Freund eine Hand auf die Schulter. »Sigha war nie hilflos.«
»Und was ist mit den Kindern?«
Diese Frage konnte ihm leider niemand beantworten.
»Hast du wirklich geglaubt, sie wären bei den Rebellen sicherer?«, fragte Bellzazar und schnaubte verachtend. »Wohl kaum. Sieh es mal so. Bei Rahff, beim König, wird ihnen wohl kaum etwas geschehen. Dein Vater mag vielleicht deine Frau ficken, aber immerhin ist deine Familie dort sicher vor dem Krieg. Und die Kirche kann sie wegen deines Verrats nicht hinrichten. Wenn ihr mich fragt, hat Rahff dir damit einen Gefallen getan, denn deiner Familie wird nichts zustoßen.«
»Wie immer sehr einfühlsam«, bemerkte Desiderius trocken. Er löste sich von der Wand und ging zu Bellzazar an den Kartentisch, um ihn einen kräftigen Stoß in die Seite zu verpassen.
»Die Wahrheit ist immer erschreckend ernüchternd«, konterte Bellzazar. Er zuckte mit den Achseln, als kümmerte es ihn nicht, wie grausam seine Worte rübergekommen waren.
»Cohen«, Eagle sah ihn mitfühlend an, »du musst mir vertrauen. Ich weiß, was ich tue. Und ich verspreche dir, dass ich deine Familie nicht vergessen werde. Vertrau auf meinen Plan, sie werden vielleicht schneller wieder bei dir sein, als du denkst.«
Alle im Raum horchten umgehend auf.
»Plan?«, fragte Desiderius ein wenig zu überrascht. »Es gibt einen Plan?« Es ärgerte ihn, das Eagle annahm, er würde einfach tun, was er sich ausdachte, ohne vorher von ihm mindestens zur Rate gezogen worden zu sein.
Eagle wandte ihm mit einem geradezu herausfordernden Blick das Gesicht zu und nickte überheblich. »Gewiss, ich habe mir einige Gedanken gemacht.«
»Welche?«, verlangte Desiderius zu erfahren, er richtete sich stolz auf und verschränkte die Arme vor der breiten Brust. Neben ihm nahm Bellzazar die gleiche Haltung ein. Es war überdeutlich, wem Zazars Loyalität gehörte, und er war sich nie zu schade, es offen kund zu tun.
»Das wird dir nicht gefallen«, sagte Eagle zu Desiderius.
Desiderius verengte argwöhnisch die Augen. Ein ganz mieses Gefühl machte sich in seiner Magengegend breit und ließ ihn brodeln. Er und Eagle starrten sich unnachgiebig in die Augen. Zwei starke Männer, die sich selten beugten. Sie spürten die Spannung nicht, die sich um sie herum aufbaute, während Desiderius auf eine Erklärung wartete. Ihre Gefährten hielten nervös den Atem an, die Luft knisterte vor Erregung.
»Eure Hoheit?«
Sie fuhren zu dem Klopfen an der Tür herum, das Eagles Erklärung weiter aufschob.
»Tretet ein«, forderte Eagle die Wache auf.
»Vergebung.« Der Mann in der eisernen Rüstung verneigte sich so tief, dass Desiderius sich darüber wunderte, wie er in dieser Rüstung ohne fremde Hilfe wieder hochkam. »Ihr habt … ähm … adligen Besuch, Eure Hoheit.«
Eagle sah sich verwirrt nach Desiderius um, der nur ratlos mit dem Kopf schüttelte.
Er kam um den Tisch herum, um sich neben Eagle zu stellen. Denn was auch immer in diesem Raum besprochen wurde, welcher Streit auch immer hier entfachen mochte, wenn Fremde kamen, waren sie eine gemeinsame Stärke, die zusammenhielt.
»Ich hoffe, Ihr wart nicht so dumm, sie einfach rein zu lassen«, meinte Desiderius wütend.
Die Wache schüttelte eilig den Kopf. »Nein, Kommandant, gewiss nicht. Sie warten vor den Toren.«
»Und wer ist es?«, fragte Eagle verwundert. »Wir erwarten niemanden.«
»Er sagt von sich, er sei ein zukünftiger Lord«, berichtete die Wache nervös, »und er ist hier, um dem rechtmäßigen König ein Angebot zu unterbreiten.«