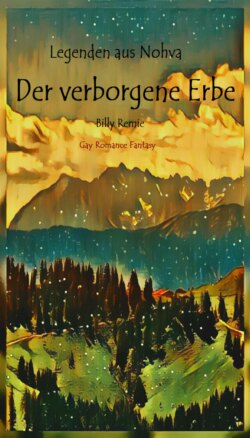Читать книгу Der verborgene Erbe - Billy Remie - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
10
ОглавлениеDer Wind blies stark seine unsichtbaren Böen um das große Gasthaus, unweit der Straße entfernt. Noch immer war der Regenwald dicht um sie herum, doch gelegentlich kreuzten von Völkern angelegte Straßen und Pfade ihren Weg.
Nachdem sie ihre Wunden mit Salben versorgt hatten, wobei sie tiefere Wunden ausbrennen mussten, um einer Entzündung vorzubeugen, waren Wexmell und seine Gefährten zu einem langen, gefährlichen Marsch aufgebrochen. Dainty und Janek hatten ihnen erklärt, dass jede noch so kleine Wunde im Regenwald katastrophale Folgen haben konnte. Allein die Gefahr, dass die Insekten ihre Eier darin ablegten, war hier um ein hundertfaches größer als an jedem anderen Ort der sterblichen Welt. Deshalb hatten sie so gleich allesamt bei jeder kurzen Rast erneut Karrahs Salbe aufgetragen, um die Fliegen fernzuhalten.
Gegen Mittag, nach dem sie sich mit ihren Schwertern durch den dichten Regenwald gehackt hatten, hatten sie eine geeignete Flussstelle erreicht, um ihn zu überqueren.
Der Strom war dort nicht so reißend gewesen, das Wasser flach. Wexmell hatte ja nicht mehr daran geglaubt, hier sah alles so gleich aus, dass er sich mehr als einmal sicher gewesen war, sie würden nur im Kreis umherlaufen. Man fühlte sich gleich viel winziger in dieser Welt, wenn man im Grün des mächtigen Regenwaldes unterzugehen drohte.
Aber Daintys Fähigkeiten als Assassine, und Luros und Allahads gute Instinkte, hatten sie sicher zum Fluss geführt. Dort mussten sie eine kurze Rast einlegen, da sie zunächst ein Floß bauen mussten. Es war kein stabiles, und diente nur dem Zweck, schnell hinüber zu gelangen, wobei sie jedes Pferd einzeln über den Fluss transportieren mussten, damit das Floß nicht unterging. Sie bauten es aus Bambusrohren, und nutzten dicke Lianen als Seile.
Lazlo hatte gekreischt wie ein Mädchen, als er beim Liane schneiden, statt eines grünen Strangs, eine grüne Schlange in den Händen hielt. Melecay lachte noch Stunden über den Laut seines Kriegers.
Mittels weiteren Bambusstöcken, die sie nutzten, um das Floß im Wasser zu bewegen, und um das Abtreiben Flussabwärts zu mindern, waren sie gegen Abend endlich zum anderen Ufer gelangt.
Jedoch nicht, ohne Bekanntschaft mit den Alligatoren zu machen.
Riesenviecher waren das, die Wexmell das Fürchten lehrten. Sie gaben bedrohliche Laute, eines Fauchens gleich, von sich, wenn sie sie aus Versehen mit den Bambusstöcken unter Wasser stupsten. Der ganze Fluss war voll mit ihnen, kaum Wasser war zu sehen. Mehr als einmal schnappten die Tiere nach der Beute auf dem Floß, die Pferde wurden nervös. Einem Alligator war es sogar gelungen, seine Vorderbeine und den Bauch auf die Bambusrohre zu hieven, sodass das Floß zu kippen drohte, und sie alle beinahe in das Wasser gefallen wären. Glücklicherweise war das Tier zurück in den Fluss gerutscht, und sie kamen alle mit einem Schrecken davon.
»So ein Vieh würde ich gerne erlegen«, tat Melecay seine Gedanken kund, »und seine Haut und seinen Kopf als Trophäe mit nach Hause nehmen. Die Dienerschaft würde Augen machen!«
»Hängen da nicht schon genug widerliche Jagdtrophäen in Euer Burg?«, murrte Karrah.
»Wäre es Euch lieber, sie würden Euch fressen, geschätzte Schwägerin?«
»Gewiss nicht.« Karrah hatte ängstlich ins Wasser geblickt.
»Wir müssen nicht alles töten, das sich uns entgegenstellt«, hatte Wexmell sich eingemischt.
»Seid nicht so langweilig«, scherzte Melecay.
Es interessierte Wexmell reichlich wenig, ob Melecay ihn für langweilig hielt, nur weil er nicht auf alles, was sich bewegte, mit dem Schwert einschlug.
»Nehmt Euch in Acht«, warnte Janek schließlich, und erstickte Melecays Jagdlust mit nur wenigen Worten im Keim. »Sie mögen schwerfällig aussehen, aber sobald wir am Ufer sind, sollten wir uns hüten. Sie können schneller rennen, als wir ihnen zutrauen. Und wenn sie einmal zubeißen, lassen sie nicht mehr los. Ihre Kiefer sind stärker als die Kraft von Hundert Mann. Wenn sie einen von euch haben, kann euch nichts mehr retten.«
Seine Warnung konnte sie glücklicherweise nicht mehr auf die Probe stellen. Am Ufer angekommen, hatten sie sich beeilt, vom Fluss wegzukommen.
Kein Alligator war hinter ihnen her gewesen.
Auf dieser Flussseite befand sich der Anfang der Zivilisation Elkanasais. Sie gelangten rasch an eine Straße, deren Verlauf sie folgten. Schilder deuteten die Richtungen zu verschiedenen Gasthöfen. Einer davon war ihr Ziel, bevor die Dunkelheit über sie hereinbrach.
Noch einige Male waren sie von starken, plötzlich einsetzenden Regen überrascht worden. Ihre Füße waren wund, weil ihre Stiefel bald durchweicht waren. Donner und Blitze trieben sie zur Eile an. Ein jeder von Ihnen ersehnte sich eine warme Mahlzeit und ein flauschiges Bett. Wein und eine relativ gefahrlose Nacht.
Nun, als sich die Dämmerung ankündigte, hatten sie ihr Ziel erreicht.
Dainty hatte den Namen des Gasthofes in die Gemeinsprache Nohvas übersetzt. Ganz passend trug er den Namen »Zum reißenden Fluss«, und befand sich etwa einen halben Tagesritt südlich von dem etwas größeren, bekannteren Gasthof »Immergrün«.
Warum Wexmells Kontaktmann den kleineren, weniger beliebten Gasthof für ihr Aufeinandertreffen gewählt hatte, erschloss sich Wexmell natürlich sofort. Hier quartierten weniger Späher und andere Soldaten des Kaisers, die unangenehme Fragen an Fremde stellen konnten.
Noch wollte Wexmell sein Hiersein geheim halten. Und zwar so lange es ihnen möglich war.
Sie saßen eine Weile geduckt in den Büschen des Regenwaldes, mit wachem Blick auf das Gehöft, das gut versteckt von grünen Blätterwänden umgeben lag. Es war nicht viel los. Eine Söldnertruppe war während ihrer Beschattung angekommen. Fünfzehn schwer bewaffnete Männer, wulstige Narben von einstigen tiefen Kratzern zeichneten ihre Gesichter und die Arme, die von ihren verschlissenen Lederwesten nicht bedeckt wurden. Ihre Haut war braun gebrannt, ihr seidenglattes Haar trugen sie wie für ihr Volk üblich lang und offen. Einem von ihnen, offensichtlich dem Anführer, fehlte ein Stück seines spitzen Ohrs.
»Drachenjäger«, hauchte Dainty erklärend, als die Söldner ihre Pferde in die Ställe brachten, ehe sie in den Gasthof gingen. »Einzelgänger. Grimmige und ungemütliche Gesellen, aber sie scheren sich nicht um Fremde, solange sie in Ruhe gelassen werden.«
»Drachenjäger?« Melecay knurrte leise. »Denen werde ich was erzählen!«
»Nein«, verbot Wexmell mit ruhiger Stimme. »Sie jagen nur ihre eigenen Drachen, Großkönig, nicht die Euren. In Elkanasai sind die Flugechsen eine echte Plage. Sie haben hier reichlich zu Essen, und kaum natürliche Feinde. Die Drachenjäger sind dazu da, die Tierbestände zu beschützen. Sie tun es nicht aus reinem Vergnügen. Es ist ein gefährlicher Beruf.«
Und Wexmell bewunderte den Mut der Männer, die den Schneid besaßen, sich immer und immer wieder gegen einen Drachen zu stellen. Es wäre töricht, sich mit ihnen anzulegen.
»Wir haben Größeres vor«, sagte er leise zu Melecay, »verlieren wir nicht das Ziel aus den Augen.«
»Sie sollen bloß nicht wagen, meine Drachen anzugreifen«, knurrte der Großkönig.
Noch eine Weile beobachteten sie das Gehöft. Wexmell schickte nach einiger Zeit mit einem stummen Nicken Allahad los, der mit den Schatten verschmolz und in Verstohlenheit zu den Ställen schlich.
Sie warteten geduldig, während Allahad unbemerkt umherschlich und die Lage auskundschaftete.
Er kam nach einer ganzen Weile zu ihnen zurück.
»Im Stall sind nicht viele Pferde. Im Gasthof sitzen die Drachenjäger, eine reisende Bauersfamilie und die Familie des Gastwirts, aber keine Soldaten.« Er blickte Wexmell sorgenvoll ins Gesicht. »Unser Kontaktmann ist noch nicht dort.«
Wexmell nickte, er hatte den Bericht zur Kenntnis genommen, jedoch fühlte er sich dadurch noch immer nicht sicher. In Elkanasai würde er sich niemals völlig sicher fühlen.
Er hob den Blick. Droben am Himmel dunkelte es, dicke Wolken zogen sich über ihren Köpfen zusammen, Donnergrollen ließ die Pferde, die sie hinter sich im Gebüsch versteckt angebunden hatten, nervös wiehern. Der Anblick des Gehöfts in der Dämmerung hatte etwas Gespenstisches an sich. Und irgendwo erwachte ein Jaguar mit einem Knurren.
»Kommt«, sagte er mit belegter Stimme zu seinen Gefährten, »dort drinnen ist es gewiss sicherer als hier draußen.«
»Da bin ich mir gar nicht mal so sicher«, kommentierte Melecay.
Wexmell stand widerwillig auf, für ihn gab es kein Zurück mehr. Jetzt nicht mehr.
»Luro, Karrah, holt die Pferde.«
»Ja, Vater.«
»Wex.«
Sie gingen, und Wexmell trat mit seinen übrigen Gefährten Seite an Seite aus dem sicheren Gebüsch.
»Hoffentlich irrt Ihr Euch nicht«, murmelte Lazlo.
Wexmell ging auf die Tür der Gaststube zu und hauchte leise zu sich selbst: »Das hoffe ich auch.«
Im Inneren der Gaststube war es durch die vielen Feuer aus der Küche heiß. Jedoch handelte es sich um eine, im Vergleich zur schwülen Atmosphäre draußen, angenehme trockene Hitze, die Wexmell und seine Gefährten empfing.
Der Raum war erstaunlich großflächig, für ein solch kleines Gebäude. Es gab eine Feuerstelle, in der kein Feuer brannte, einen in die Jahre gekommenen Tresen mit einer Bar, hinter dem ein argwöhnischer älterer Elkanasai, mit von der Sonne gegerbten Gesicht und langem silbernen Haar, Bier und Wein ausgab. Die unterschiedlich geformten und unterschiedlich großen Tische in der Gaststube waren allesamt aus dunklem, abgenutzten Holz, genau wie die dazugehörigen Stühle. Es gab wenige Fenster in diesem Raum, keines besaß eine Scheibe oder gar einen Vorhang, trotzdem kam kaum Licht durch die dem Boden nahen Öffnungen in den Außenwänden, da das gesamte Gehöft von dichten Regenwaldwänden umgeben war, die keine Sonne durchließen.
Dadurch, dass es mal wieder regnete und donnerte, wirkte es fast wie Nacht. Vor den Fenstern kam eine Regenwand hinunter, der Wind blies Nässe in den Raum.
Wexmell ließ den Blick umherschweifen. Die anderen Gäste, die Allahad bereits ausgespäht und erwähnt hatte, saßen verteilt an den Tischen und aßen oder tranken etwas. Alles war ruhig, bis auf die gedämpften Gespräche, das Klirren und Klappern aus der Küche hinter der Bar, dem Wischen des Tuchs, mit dem der Schankwirt seine Krüge trocknete, und das Schnurren einer schwarzen Katze, die auf dem Sims des kalten Kamins lag und den Schwanz in der Luft hin und her pendelte.
Einer der Drachenjäger, dem ein halbes Ohr fehlte, blickte genau auf die Tür und betrachtete Wexmell ebenso herausfordernd wie neugierig über den Rand seines Bierkrugs hinweg. Wexmell beschloss, den Blick nicht zu erwidern, der Kerl schien auf Streit aus zu sein.
Luro und Karrah traten hinter ihnen ein, die Tür öffnete sich kurz, und der Wind blies den Regen in Wexmells Nacken. Draußen roch es nach feuchter Erde, Wurzeln und nassen Pferden. Es war ein krasser Kontrast zu den scharfen Gewürzen, die im Inneren des Gasthauses Wexmells Nase kitzelten.
Luro trat neben ihn und hielt schnüffelnd die Nase in die Luft.
»Witterst du Gefahr?«, fragte Wexmell halblautlachend. Er klang genauso nervös wie er sich in jenem Moment fühlte. Denn er konnte ihren Kontaktmann nirgends entdecken.
»Nein.« Luro lächelte mit geschlossenen Lippen. »Ich rieche Kekse.«
Kaum hatte er es gesagt, stieg auch Wexmell der unverkennbare Geruch frischen Gebäcks in die Nase, dass gerade aus dem Ofen genommen wurde. Allen lief der Speichel in den Mündern zusammen.
»Mmmhh«, machte Dainty genüsslich, »was gäbe ich nicht alles für eine Tasse Milch und noch warmes Gebäck.«
Melecay grinste schelmisch, als er Dainty zuflüsterte: »Ich lege eine Spur aus Keksen, die dich in mein Bett führt. Dann beweise mir, was du wirklich alles geben willst.«
Kichernd stieß Dainty seinem Gemahl mit dem gesamten Körper an, er lief geradezu liebreizend rot an.
Wexmell konnte ihn nicht lange ansehen. Auch wenn es ihm fernlag, andere Männer zu betrachten, hatte er Daintys Schönheit schon bewundert, seit er ihn das erste Mal zu Gesicht bekommen hatte.
Alle Elkanasai besaßen eine gewisse Anmut, die ihn nicht kalt ließ. Aber Dainty war ein besonders schöner Mann. Warum Melecay nicht die Finger von ihm lassen konnte, verstand Wexmell nur zu gut.
Lalzo konterte trocken: »Bitte nicht, wenn wir uns alle ein Zimmer teilen müssen.«
Darauf hatte Wexmell auch nicht die geringste Lust. Nicht einmal die Hitze und die Gefahren im Regenwald hatten diese Beiden auseinanderhalten können. Und sie fanden überall zueinander, selbst wenn sie alle um sie herum versuchten, Schlaf zu finden.
Aber Wexmell würde sich nie beschweren, wusste er doch noch, wie unersättlich er und Desiderius zu ihrer Zeit gewesen waren.
Und es noch wären, wäre Derius noch am Leben.
»Ein trockenes Bett und Etwas, woran ich meine nassen Socken aufhängen kann, würde mir schon genügen«, sagte Allahad.
Wexmell hob eine Hand, damit sie still waren. Er atmete noch einmal tief durch, um seine innere Ruhe zu finden, dann trat er an den Tresen heran und verlange nach Betten für die Nacht. Sein Elkanasai – umgangssprachlich auch Elkanasaisch – war nicht gerade fließend, außerdem glaubte er, einen starken Akzent zu haben, aber der Wirt verstand ihn.
»Keine Zimmer mehr frei«, brummte er zurück.
Wexmell verbot es sich, genervt mit den Augen zu rollen. Er steckte die Hand in seinen Geldbeutel und legte einige Silbertaler auf den Tisch. »Wir können gut zahlen, gebt uns so viele Betten, wie Ihr entbehren könnt, wir werden Euch gut für unseren Besuch entlohnen, guter Herr.«
Der Wirt stellte den Krug ab, den er wohl zur Genüge trockengerieben hatte, und klatschte die große Hand auf die Taler. Er zog das Silber über die Kante, und ließ es in seiner eigenen Tasche verschwinden.
Er grinste Wexmell böse an.
»Nun?«, Wexmell hob eine Augenbraue.
»Keine Zimmer mehr frei.«
Wexmell schnaubte halbamüsiert, halbverärgert. »Gute Götter, gibt es denn nur noch Halsabschneider? Ihr nahmt mein Silber, gebt uns ein Zimmer für die Nacht!«
»Sonst was, Bursche?«, fragte der Wirt leise lachend. Er lehnte die dicken Unterarme auf den Tresen und beugte sich zu Wexmell heran, damit dieser im Kerzenschein die lange Narbe erkennen konnte, die sich über sein Auge zog.
Im Raum wurde es stiller, die Drachenjäger stellten ihre Getränke ab und starrten zu ihnen rüber. Sie legten die Hände an ihre Waffen.
Wexmells Gefährten taten es ihnen gleich.
Wexmell zeigte sich unbeeindruckt, er lächelte entspannt. »Ich bin nicht auf Streit aus, ich bin nur auf der Durchreise.«
»Ihr trag Waffen.«
»Zum Schutz vor den Gefahren des Regenwaldes.«
»Fremde sind hier unerwünscht«, beschloss der Gastwirt. »Wir wollen hier keine freien Menschen, Junge.«
Gelegentlich verstimmte es Wexmell, in seinem Alter noch immer als Junge bezeichnet zu werden. Vor allem weil er in seinem Leben schon so einiges erlebt hatte, dass das Kind in ihm nicht überlebt hatte. Doch er konnte seinen Unmut stets gut verbergen.
»Ihr verwechselt mein junges Gesicht mit Jugend, dabei bin ich vermutlich älter als Ihr.« Er grinste, nur um seine Fänge zu zeigen. Vielleicht war das ein Fehler gewesen, denn sofort wurden der Wirt und die Drachenjäger hellhörig.
»Und wie Ihr seht, sind unter meinen Gefährten Männer aus Eurem Volk.« Wexmell deute mit den Daumen hinter sich.
Der Wirt, der sich wieder etwas aufgerichtet hatte, als er Wexmells Fänge gesehen sah, regte nun noch weiter den Kopf, um Janek und Dainty zu betrachten. Sie traten vor und begrüßten den Wirt.
»Was sagt er?« Luro beugte sich nervös zu Wexmell. »Warum haben wir noch keine Zimmer?«
Wexmell hob eine Hand, um ihn abzuweisen. »Ich regle das, vertrau mir.«
»Was sagt der Mensch?«, knurrte der Wirt.
»Vergebung, er ist Söldner aus einem anderen Land«, entschuldigte Wexmell wieder in der Ländersprache des spitzohrigen Volkes. »Ich komme aus Nohva. Ich bin Händler. Wir kamen über Carapuhr hier her, um Handel zu treiben.«
»Über Carapuhr, sagt Ihr?«
Wexmell nickte. »Es war ein langer, gefährlicher Weg. Der König dort, wollte uns lieber töten, als durchlassen.«
»Wie seid Ihr ihm entkommen?«
»Wir erkauften uns die Erlaubnis, über die Grenze zu treten, mit Silber.« Wexmell fasste sich an die Brust und verneigte sich ergebend. »Wir sind nur hier, um unser Glück zu versuchen.«
Der Wirt beäugte sie voller Argwohn, es war schwer zu sagen, ob er einlenken würde. Seine geschürzten Lippen, die im Kerzenschein feucht glänzten, und die gewölbten Augenbrauen gaben Wexmell wenig Hoffnung.
Aber wo sollten sie hin, wenn sie nicht hierbleiben konnten, um auf ihren Kontakt zu warten? Sofern er denn überhaupt kommen würde. Wexmell befürchtete fast, er könnte erwischt worden sein. Vielleicht hat jemand Falsches die Botschaften, die Wexmell ihn in den letzten Wochen zukommen gelassen hatte, gelesen, und den Verrat aufgedeckt.
Vielleicht war das hier eine Falle …
»Ihr könnt im Stall schlafen, Essen kost extra!« Der Wirt wollte sie fortwinken.
Wexmell wollte sich bereits damit abfinden, als hinter ihnen erneut die Tür geöffnet wurde.
»Sie gehören zu mir.«
Die Stimme kam ihm kaum bekannt vor, viel dunkler und rauer, als er sie in Erinnerung gehabt hatte.
Verwundert drehte er sich um. Und war sprachlos gegenüber dem, was sich seinen Augen dann bot.
»Ich habe reserviert«, sagte der selbstbewusste Neuankömmling. Sein Gesicht wirkte wegen seiner kindlichen Züge sehr feminin, seine Augen waren groß und strahlend, seine Haut blass, wie eine unberührte Blüte. Er trug das haselnussbraune, lange Haar zu einem Knoten zusammengebunden auf dem Kopf, eine breite Strähne hing locker und keck an seiner linken Gesichtshälfte hinab. Sein Körper war klein und knabenhaft, was durch seine schneeweise Toga noch zur Geltung gebracht wurde.
Er trat mit zwei in prunkvollen Rüstungen steckenden Leibwächtern ein, deren Gesichter hinter bunten, hölzernen Masken verborgen blieben. Ein voller Beutel Silber wechselte den Besitzer und verschwand hinter dem Tresen.
Der Wirt nickte stumm.
»Lasst die Betten frisch beziehen«, verlangte der dunkelhaarige Elkanasai von dem demütig wirkenden Wirt. »Und bringt uns Essen und Wein an den Tisch, meine Gäste haben eine lange Reise hinter sich.«
»Wie Ihr wünscht, Mylord.«
In Elkanasai sagte man Mylord und Mylady, Wexmell hätte auch ohne Sprachkenntnisse gewusst, dass es in Nohva gleichbedeutend mit »mein Lord« und »meine Lady« war.
Kopfschüttelnd wandte sich Wexmell an seinen alten Bekannten, der sich mit einem breiten Lächeln zu ihm umdrehte.
»Vom Sklaven zum Lord?« Wexmell lächelte zurück. »Das ist ein großer Aufstieg.«
»Ich muss Euch enttäuschen, Wexmell, ich bin nur der Buchhalter, mein Onkel ist der Lord«, er konnte mit dem lächeln gar nicht mehr aufhören. »Es ist so schön, Euch endlich wiederzusehen!«
»Die Freude ist auf meiner Seite, Ashen.« Wexmell breitete die Arme aus, und sie umarmten sich voller Freude lachend.
Ashen schien ihn gar nicht mehr loslassen zu wollen.
»Ihr habt Euch kaum verändert«, bemerkte er. »Aber Euer Bart gefällt mir.«
Wexmell lachte. »Ich werde ihn etwas besser pflegen müssen, fürchte ich. Aber du!« Er packte Ashens Schultern und hielt ihn mit etwas Abstand zu sich, um ihn in Augenschein nehmen zu können. »Bei den Göttern, sieh dich einer an, du bist ein Mann geworden!«
»Und was für einer«, murmelte jemand hinter ihnen. Wexmell war zu verblüfft, um Luro oder Allahad herauszuerkennen. Wer es auch war, der jeweils andere schlug ihm strafend gegen die Schulter.
Ashen lachte beinahe verlegen. »Es ist ja auch eine ganze Weile her.«
»Viel zu lang, wie es scheint«, bemerkte Wexmell. Verdammt, er war wirklich alt geworden – wie Desiderius sagen würde –, wenn die, die er als Kinder kannte, bereits groß und erwachsen waren.
Ashen hielt Wexmells Arme weiterhin fest, doch sein Blick wanderte über ihn hinweg, um die anderen zu betrachten.
»Ihr müsst Karrah sein«, bemerkte er, »ich hielt und fütterte Euch, als Ihr noch ein Säugling wart.«
Karrah nickte stumm, es schien ihr peinlich zu sein. Grinsend legte Allahad ihr den Arm um die Schultern und drückte sie an seine Seite, damit sie sich nicht so entblößt vorkam.
Freudig lächelnd bemerkte Ashen auch Allahad und Luro. Als er die anderen – Janek, Dainty, Melecay, Lalzo und Iwanka – betrachtete, nickte er ihnen freundlich zu, hinterher war immer noch reichlich Zeit, alle miteinander bekannt zu machen.
Es lag etwas Dringliches in Ashens Blick, als er weitersuchte. Verwunderung zeichnete sich auf seinem sanften Gesicht ab, als er nicht fand, was er suchte.
Er blickte Wexmell fragend an.
Wissend, welche Frage auf eine Antwort drängte, ließ Wexmell Ashens Arme los und trat mit gesenktem Kopf einen Schritt zurück.
Ashen runzelte seine Stirn. »Wo ist Euer Drache, Gefährten? Wo ist Desiderius?«
Keiner schien gewillt, ihm zu antworten. Luro und Allahad blickten mit der gleichen Trauer wie Melecay und Karrah zu Boden, die anderen taten es ihnen aus Respekt vor ihren Gefühlen gleich. Es lag wohl an Wexmell, diese Frage zukünftig zu beantworten, wann immer sie ihnen gestellt werden mochte.
Ashen spürte die düstere Stimmung, seine Augen betrachteten Wexmell sorgenvoll. »Ihr würdet niemals ohne ihn reisen.«
Wexmell hob seltsam gefasst den Blick, was vermutlich daran lag, dass er sich immer noch wie betäubt fühlte, wenn er daran dachte. »Nein, würden wir nicht. Er ist tot.«
Ashen wurde noch blasser, als es sein natürlicher Hautton ohnehin schon war. Er griff sich an die Kehle und rang offensichtlich nach Fassung.
»Ermordet von unseren Feinden«, erklärte Melecay wütend, seine Lippen wurden schmal, sein Kiefer mahlte. »Sie werden dafür bezahlen.«
Doch Ashen hatte nur Augen für Wexmell, als wüsste er aus tiefsten Herzen, welchen Schmerz Wexmell spürte. Sein warmer Blick aus diesen übergroßen Augen schenkte jedem von ihnen Mitgefühl und Trost.
»Es ist schrecklich, das zu hören, es bricht mir das Herz«, sagte er aufrichtig bedauernd, »er ... bedeutete auch mir viel, auch wenn ich ihn nur kurz kannte. Ihm und Euch, Wexmell, verdanke ich meine Freiheit. Ich werde ihn ehren, indem ich seine Taten nie vergessen werde.«
Wexmell rang sich ein Lächeln ab. »Ich danke dir.«
Ausatmend versuchte Ashen, seine Fassung zurückzuerlangen. Seine Hand zitterte, mit der er sich die Kehle rieb. Er trat beiseite und breitete den anderen Arm aus, mit dem er auf einen freien Tisch deutete.
Die Drachenjäger beobachteten sie, jedoch waren ihre Blicke nun zurückhaltend.
»Nun kommt, setzen wir uns und trinken Wein, um der Trauer etwas entgegenzusetzen«, forderte Ashen sie auf.
Doch Wexmell wusste aus Erfahrung, dass nicht einmal Wein in der Menge eines Ozeans diesen Schmerz je lindern könnte.
Nichts vermochte dies, er musste damit leben.