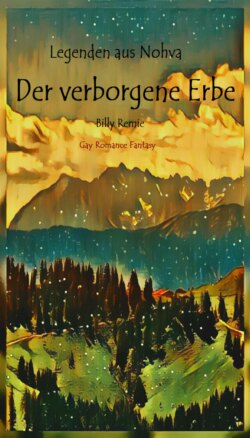Читать книгу Der verborgene Erbe - Billy Remie - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4
ОглавлениеDas Schlagloch auf der Straße drohte die Achse des linken Rads zu brechen, obwohl die Zugpferde nur im leichten Trab die Kutsche über die Straße zogen. Wexmell hatte sich bei dem Holpern den Kopf angestoßen und erwachte nun aus dem Schlaf der Erschöpften. Er war das lange Reisen nicht mehr gewohnt, die gelegentlichen Schlafeinheiten in der Kutsche erschöpften ihn beinahe mehr, als dass sie ihm neue Kraft spenden konnten.
Er hoffte, sie würden gen Abend bald weit genug gereist sein, um es sich zu erlauben, ein Lager aufzuschlagen und in einem Zelt zu nächtigen.
Große Hoffnung hegte er jedoch nicht, sie kamen nur langsam voran.
Gähnend richtete er sich etwas auf, um die müden und schmerzenden Gliedmaßen zu strecken. Auf seinen Wangen war bereits ein goldener Bartschatten gewachsen, an dem er sich jedoch nicht störte. Seit Desiderius tot war, kümmerte sich Wexmell recht wenig um sein Äußeres. Er sorgte lediglich dafür, dass seine Duftnote nicht die Grenze zum Unangenehmen überschritt, damit ihn seine Gefährten nicht meiden mussten.
Die Vorhänge waren zugezogen, es war dämmrig im Inneren der Kutsche, gedämpft drangen die Hufschläge und das Rattern der Räder zu ihm hinein. Die Plätze neben ihm waren leer, schräg gegenüber von ihm saß Prinzgemahl Dainty. Der junge Mann hatte den dunklen Haarschopf gegen das andere Fenster gelehnt, seine Augen waren geschlossen, seine Lippen leicht geöffnet, ein Speichelfaden tropfte von seinem Mundwinkel auf den Kragen seines weißen Pelzumhangs.
Wexmell selbst schälte sich unter seinem dicken, schwarzen Wollumhang hervor, weil die Hitze um ihn herum unerträglich wurde. In Carapuhr war jeder Sommer recht mild, aber je weiter sie die Grenze hinter sich ließen, je deutlicher war die schwüle Hitze Elkanasais zu spüren.
Trotz steigender Temperaturen war in der Ferne Donnergrollen zu hören, dass bei jedem Mal näher klang. Regen prasselte zunächst leise auf das Dach der Kutsche, doch das Geräusch würde rasch zu einem lärmenden Trommeln.
Irgendwo, noch weit entfernt, brüllte ein Tier – zumindest nahm Wexmell an, es sei ein Tier – das er nicht einordnen konnte. Er vermutete einen Affen, er hatte schon einmal von ihrem ohrenbetäubenden Brüllen gelesen. Sie besaßen den passenden Namen: Brüllaffen, und sie waren berühmtberüchtigte Tiere des Regenwaldes, um den sich viele Mythen rankten.
Einerseits verspürte Wexmell tatsächlich Abenteuerlust, freute sich darauf, den sagenumwobenen Kontinent einmal mit eigenen Augen zu sehen, die tiefen Urwälder, die unbekannte Tierwelt, die Völker und ihre Demokratie. Andererseits fürchtete er sich vor Kämpfen.
Es war das erste Mal in seinem Leben, dass er ohne Desiderius überleben musste.
Auch wenn er all jenen vertraute, die ihm beistanden, Desiderius hatte er immer ein Vertrauen entgegengebracht, das er nicht in Worte fassen konnte. Sie waren … Eins gewesen. Jetzt war er nur noch die Hälfte seiner Kraft, er konnte nur hoffen, dass dies genügte, denn er wollte nicht, dass Luro und Allahad starben, ehe sie Nohva erreichen konnten. Wexmell sah es als seine Pflicht an, als Freund und Prinz, seine treuen Gefährten zurück in die Heimat zu bringen. Nach allem, was sie für ihn getan und mit ihm durchgestanden hatten, war er es ihnen schuldig. Und jene Schuld würde er gewiss nicht vergessen.
Niemals.
Er würde sie nach Hause bringen.
Während Dainty schlief, rieb sich Wexmell die Müdigkeit so gut es ihm möglich war aus dem Gesicht und kramte anschließend in seinem Reisesack. Er trank einen Schluck aus seinem Wasserschlauch, nagte an einem Strang gepökeltem Fleisch und schlug das Buch auf, das er aus Carapuhr mitgenommen hatte.
Es war nicht so, dass er Karrahs Worten keinen Glauben schenkte, jedoch wäre er nicht er selbst, würde er sich nicht selbst davon überzeugen müssen, dass Bellzazar für ihn verloren war. Der älteste und loyalste Verbündete seiner Familie, der Mann, den Wexmell seit seiner Geburt kannte, der ihm das Kartenspielen – vor allem das Betrügen – beigebracht hatte, der ihn immer aufgemuntert hatte, ihm immer mit Rat und Tat Beiseite gestanden hatte, der ihm das Leben in Nohva gerettet hatte, dieser Mann, dieser enge Freund, sollte nun von einem Dämon besessen sein? Wexmell wollte nicht glauben, dass er nichts tun konnte. Auch wenn es in vergangenen Zeiten immer mal wieder Zwiespalt zwischen ihm und Bellzazar gegeben hatte – überwiegend wegen ihres Tauziehens um Desiderius‘ Moralansichten – , wollte Wexmell ihm in der Not helfen. Auch wenn Bellzazar es nicht als Not ansehen mochte, wie Karrah befürchtete, Wexmell fühlte sich gegenüber dem Halbgott ebenso verpflichtet wie gegenüber Luro und Allahad. Und er wusste, es hätte Desiderius viel bedeutet, dass es Bellzazar gut ging, dass er in Sicherheit war – und dass er für sich selbst keine Gefahr darstellte. Selbst wenn Karrah nicht helfen wollte – es als sinnlos erachtete, weil es für Bellzazar keine Rettung gab – würde Wexmell nicht aufgeben. Also las er, so viel er konnte, über dämonische Besessenheit bei Göttern und Halbgöttern. Doch das Buch war mehr ein theoretischer Ansatz, als eine echte Hilfe. Nichts als Mutmaßungen und Vorurteile waren darin aufgelistet. Trotzdem las er unbeirrt weiter, in der Hoffnung, doch noch etwas Nützliches zu finden.
Was hätte er während der langen Reise auch sonst tun sollen? Er musste sich davon ablenken, an all jene zu denken, die er verloren hatte. Allmählich verstand er mehr denn je Großkönig Melecays verzweifelte Wut auf alles und jeden, und seinen unbeirrbaren Wunsch, jeden Feind sofort zu töten. Und das machte Wexmell Angst. Er wollte niemals seine Prinzipien verlieren, ganz gleich wie übel das Schicksal ihm auch mitspielte.
Schwere Hufe trabten über die schnell aufgeweichte Straße heran, Regenwasser platschte, als Getrampel durch schnell anschwellende Pfützen zog. Wexmell hörte Zügel klimpern und Leder knirschen, als ein großer Reiter von seinem ebenso großen Ross hinabstieg und die schweren Stiefel auf das Trittbrett stellte. Die Tür wurde aufgerissen, und ein Mann stieg in die Kutsche, er ließ sich mit tropfnassen Kleidern und Haar neben Dainty nieder und sperrte das Unwetter aus, indem er eilig die Tür schloss.
Wexmell lächelte ihn über die Buchkante hinweg an. »Ist das Schweiß oder Regen, das Euer Gesicht nass macht, Großkönig Melecay?«
Melecay verzog missgelaunt das Gesicht und strich sich die Wassertropfen von der markanten Stirn. »Eine schreckliche Mischung aus beidem. Ich sah das Unwetter auf uns zu kommen und hoffte, es würde uns abkühlen, jetzt ist es jedoch noch schlimmer. Seit wann klebt Regen so? Seit wann sind Stürme so heiß?«
Sie waren noch nicht einmal in den Regenwäldern und schon litt Melecay unter der Hitze. Als geborener Carapuhrianer besaß der Großkönig eine angeborene dicke Haut gegen die Kälte in seinem Land, die ihm jetzt jedoch das Leben schwermachte. Was die Natur ihm einst schenkte, um zu überleben, zwang ihn nun fast in die Knie. Und in den nächsten Wochen würde es bestimmt nicht milder werden, im Gegenteil. Sie konnten letztlich nur hoffen, dass sich Melecays Körper schnell an das Wetter gewöhnte.
Aber nicht nur Carapuhrs Großkönig litt, auch Wexmell und seine Freunde würden sich erst einmal an das Wetter gewöhnen müssen. Die Hitze zerrte an ihnen wie ein Tornado an einem brüchigen Zweig. Nur Dainty und sein Bruder Janek, die in diesem Klima aufgewachsen waren, hatten keinerlei wetterbedingte Probleme, sie schwitzten auch nicht so stark wie alle anderen. Die Brüder waren nun durch ihre Herkunft im Vorteil. Außerdem waren sie die einzigen, die die Sprache fließend sprechen konnten und sich mit allerlei Sitten auskannten. Auch Wexmell war der Sprache der Elkanasai mächtig, jedoch strauchelte er gelegentlich, davon abgesehen vermieden die Elkanasai Kontakt zu allen Fremdlingen mit runden Ohren. Ohne Dainty und Janek hätten sie diese Unternehmung überhaupt nicht antreten können, die Brüder waren zunächst ihre einzige Chance, hier zu überleben. Im Regenwald würden sie sich auf ihre Kenntnisse verlassen müssen, ebenso in den Städten.
Während Wexmell las, spürte er Melecays durchdringenden Blick auf sich, doch er ließ sich durch die blauen Augen nicht ablenken. Während andere durch Melecays bloße Blicke meist schon in Panik gerieten, erreichten sie Wexmell selten. Er kannte den Großkönig, vom ersten Augenblick an hatte er die tief verletzte und verängstigte Seele hinter all der Wut und der Grausamkeit erkannt. Doch dies war nicht der einzige Grund, weshalb Wexmell gegen all seine Prinzipien verstoßen hatte, um ihn zu schützen.
Wexmell war nicht halb so dumm wie Bellzazar glaubte. Auch wenn er sich all die Zeit ahnungslos gegeben hatte, er würde die tief verwurzelte Stärke hinter jedem Blick immer erkennen. Es war für ihn immer offensichtlich gewesen, wer Melecay war, wessen Blut durch seine Adern floss. Trotz heller Augen und hellem Haar, war seine Statur, sein Stolz, seine Sturheit und seine innere Stärke – sein wahnwitziger Mut – nur mit der eines anderen großen Mannes vergleichbar.
Für Wexmell war stets offensichtlich gewesen, wessen Sohn Melecay wirklich war.
Doch er konnte und würde nie offenbaren, welch Geheimnis er hütete, denn er selbst trug Schuld daran. Er hatte es nicht über sich gebracht, seinen Fehler einzugestehen, weil er die Konsequenzen für sich gefürchtet hatte. Er hatte sich einst von Bellzazar manipulieren lassen, das musste er zugeben, doch obwohl er kein Feigling sein wollte und ihm Ehrlichkeit wichtig war, hatte er jenes Geheimnis mit ins Grab nehmen wollen. Nun blieb ihm ohnehin keine Gelegenheit mehr, reinen Tisch zu machen.
Außerdem würde Melecay sein Recht auf Carapuhrs Krone verlieren, und das wollte Wexmell dem jungen Mann nicht antun. Die Krone Carapuhrs schien neben Dainty das einzige zu sein, das ihn besänftigen konnte. Es wäre klüger, diesen tollwütigen Wolf nicht zu reizen. Aber sollte es nicht anders gehen, würde Wexmell nicht zögern, Melecay an seinen Platz zu verweisen. Bei dieser Unternehmung behielt Wexmell die oberste Befehlsstufe, denn er wollte nicht, dass noch mehr Blut vergossen wurde.
»Ihr solltet nicht nach ihm suchen.«
Melecays Stimme riss Wexmell aus seinen trüben Gedanken. Er blickte auf und rang sich ein mattes Lächeln ab. »Ich muss.«
Frustrierend seufzend lehnte Melecay sich zurück. »Ich muss gestehen, mir wäre wohler, ihn nie wieder zu sehen. Der Anblick des Dämons erinnerte mich stets daran, was ich ihm schuldig bin.« Er knirschte verdrossen mit den Zähnen. »Und das gefällt mir nicht.«
Mit einem nachsichtigen Lächeln klappte Wexmell das Buch zu. »Es ist kein Zeichen von Schwäche, wenn wir in der Schuld anderer stehen. Es bedeutet lediglich, dass wir Freunde und Verbündete haben, wegen denen wir nie alleine dastehen.«
Melecays Lippen kräuselten sich, als hätte er Dung gerochen. »Es bedeutet, auf andere angewiesen zu sein. Es bedeutet, sich auf den Schultern anderer auszuruhen.«
»Dann haltet Ihr mich für schwach und angreifbar, weil ich in dieser Sache Eure Hilfe benötige?«, fragte Wexmell. Er klang weder verärgert noch überheblich, allenfalls ein wenig tadelnd, aber überwiegend neugierig. »Oder haltet Ihr Euch selbst für zu schwach, weil Ihr in dieser Situation meine Hilfe benötigt?«
Melecay starrte in den leeren Raum zwischen ihnen, seine Kiefer mahlten, wie die eines kleinen Jungen, der ausgeschimpft wurde, der aber keinerlei Reue empfand.
»Wir brauchen einander«, sprach Wexmell auf ihn ein, »ich brauche Euch ebenso sehr wie Ihr mich. Ihr habt nie durchblicken lassen, dass es Euch stört. Warum stört es Euch bei anderen?«
»Bei Euch ist es etwas anderes.« Melecay verschränkte die Arme vor der Brust und blickte trotzig durch den schmalen Spalt der Vorhänge nach draußen. »Ihr seid … reinen Herzens. Ihr seid vermutlich der einzige Mann in dieser und jeder anderen Welt, dem ich ohne Zweifel vertrauen kann. Gelegentlich halte ich Eure Ansichten für sehr naiv, oft haben wir Diskussionen über Richtig und Falsch, und doch habt Ihr immer zu mir gestanden.« Plötzlich sah er Wexmell wieder voller Entschlossenheit an. »Ich vertraue Euch mehr, als jedem anderen, weil er Euch geliebt hat.«
Wexmell senkte mit einem dicken Kloß im Hals ein Stück den Kopf, Tränen stiegen ihm in die Augen, als ihn die Endgültigkeit des Todes wieder einholte. Von nun an hieß es nur noch, Desiderius hatte ihn geliebt. Vergangenheitsform.
»Vergebung.« Auch Melecay ließ den Kopf hängen, er rieb sich den kräftigen Nacken, bis er rot wurde. »Es gibt Dinge, die ich Euch schwerlich erklären kann, weil ich als König derart viele Geheimnisse hüte, dass ich gelegentlich den Überblick verliere, nur damit ich die Krone behalte; damit ich mein Volk und mein Land vor Feinden schützen kann. Wisset aber, dass Ihr mir am Herzen liegt, und der Grund dafür war nicht ausschließlich Desiderius. Trotzdem habt Ihr durch ihn einen hohen Status bei mir erreicht. Er und ich … waren auch nicht immer einer Meinung, aber doch vom gleichen Schlag. Das ist alles, was ich Euch sagen kann und darf. Er versprach mir einst, dass Ihr und er immer auf meiner Seite stehen würdet, wenn ich bereit bin, Euch die gleiche Loyalität entgegen zu bringen. Er … bedeutete mir viel.«
Wexmell ahnte bereits seit geraumer Zeit, dass Melecay die Wahrheit erfahren hatte. Es war die Art, wie er Desiderius ansah, wie er versuchte, von ihm zu lernen, wie er seine Nähe gesucht hatte. Umso mitfühlender betrachtete er jetzt den jungen Mann. »Wir sind die letzten Freiheitskämpfer in einer versklavten und von Vorurteilen geplagten Welt, Großkönig. Es ist sogar unsere Pflicht, zusammen zu stehen. Wir sind vertragliche Verbündete und darüber hinaus enge Freunde. Familie. Nichts und niemand wird mich von meinen Verpflichtungen Euch gegenüber abhalten.«
Zum ersten Mal seit ihrer Abreise atmete Melecay entspannt durch, seine kräftigen Schultern sackten unter dem schwarzen Mantel ein Stück hinab. »Ich danke Euch, meine Ohren mussten es hören, obwohl mein Herz es bereits wusste. Die letzten Tage plagten mich grausige Vorstellungen davon, wie der Kaiser Euch ein Bündnis anbietet, eine Armee und Friedensabkommen, und das Ihr es annehmt.«
»Melecay«, seufzte Wexmell schwer, »ich verstehe Eure Sorgen, doch hinterlistig war ich bisher noch nie. Auch wenn wir oft verschiedener Moralansichten sind, und ich Eure Vorgehensweise im Kampf oft missbillige, so seid Ihr mir doch ein besserer Verbündeter als der Kaiser. Ihr und ich verabscheuen die Sklaverei. Wir beide stimmen doch zumindest darüber ein, dass jeder Mann das Recht darauf hat, frei zu sein. Der Kaiser will Nohva schon lange, er würde mir alles versprechen, um es zu bekommen, doch würde ich in seiner Schuld stehen, wäre Nohva nur ein Vasallenstaat. Was würde aus meinen Völkern werden? Sklaven? Das kann ich nicht zulassen.«
Melecay lächelte schwach, jedoch beruhigt.
»Ihr seht also, dass es immer ein Unterschied ist, wem man etwas schuldig bleibt. Gegenüber Bellzazar trage ich die gleiche Schuld wie Ihr, auch er rettete mein Leben, gab mir eine zweite Chance, doch er hat nie etwas dafür von mir zurückverlangt.«
Gedankenverloren starrte Melecay vor sich hin, er rieb langsam die Hände aneinander, als wolle er seine Finger wärmen. Er hauchte zu sich selbst: »Ich fürchte nur, er hat von mir etwas für mein Leben verlangt. Und ich habe es ihm gegeben.«
Wexmell runzelte neugierig die Stirn.
Besorgt sah ihn Melecay an. »Er rettete mein Leben, weil er wollte, dass ich den Thron besteige. Er sagte zu mir, vielleicht würde das nicht nur mich, sondern auch ihn retten. Und hier bin ich: König von Carapuhr …«
Lange sahen sie sich in die Augen, tauschten Sorgen und große Zweifel ohne jede Worte miteinander aus.
Bis Wexmell schließlich die Augen schloss und gefasst ausatmete. »Es war nie möglich, Bellzazars Absichten zu durchschauen, doch ich habe nie daran geglaubt, dass er je etwas durchweg Schreckliches mit uns vorhatte.«
»Nicht mit uns«, wandte Melecay ein, »mit der Welt, wie wir sie kennen.«
»Kann es denn noch schlimmer kommen?«, fragte Wexmell. Er hatte einen Scherz machen wollen, um die Stimmung aufzuhellen, doch er klang viel zu zynisch. Es würde noch eine Weile dauern, bis die Trauer seine Worte nicht mehr beeinflusste.
Melecay zuckte mit den Achseln. »Sucht ihn einfach nicht, dann müssen wir uns vielleicht nie wieder mit derlei Sorgen rumschlagen. Ihr habt Wichtigeres zu erledigen. Obwohl ich gestehen muss, es reizt mich jeden Tag mehr, selbst die Kaiserkrone zu tragen.«
»Ich halte Euch nicht auf«, sagte Wexmell mit einem Schmunzeln. Er war nie Machthungrig gewesen. Alles, was er wollte, war die Kriege zu beenden, die Elkanasai heraufbeschwört, ehe sie Nohva erreichten.
Melecay schüttelte den Kopf, doch man sah ihm an, wie schwer ihm das Ablehnen fiel. »Nein«, sagte er entschlossen, »ich sehe mich auf Carapuhrs Thron. Außerdem hatte Euer Schurke Recht, Elkanasai würde mich nie akzeptieren. Davon abgesehen hasse ich diese Hitze. So sehr ich die Vorstellung auch mag, der Herrscher der größten Nation unserer bekannten Welt zu werden, weiß ich um meine Schwächen. Sie würden mich noch im ersten Jahr umbringen lassen, weil mein Hass auf sie, mich zu einem Tyrannen machen würde. Wir brauchen Stabilität, eine sichere Grenze, damit Carapuhr wieder erblühen kann. Auch wenn mir die Leben anderer recht wenig bedeuten mögen, meine Liebe zu meinem Land stand stets außer Zweifel. Carapuhr ist mir wichtiger als jede noch so mächtige Krone. Deshalb war ich auch erleichtert, dass Ihr von den Toten auferstanden seid. Ihr habt mich vermutlich, ohne es zu wollen, mit Eurem Überleben aufgehalten, die Welt zu erobern. Es ist besser so, auch wenn der dunkle Teil in mir nach so viel mehr verlangt. Carapuhr und mein Volk braucht mich, um zu überleben. Meine eigenen Wünsche sind jetzt nicht mehr von Belang.«
»Hört, hört.« Wexmell lächelte, stolz auf Melecays Einsicht. Er lehnte sich nach vorne und legte dem Großkönig eine Hand auf die Schulter. »Worte, gesprochen von einem wahren König.«
Melecay kämpfte mit einem glücklichen Lächeln, das derart niedlich wirkte, dass es einen harten Kontrast zu seiner imposanten, eiskalten Erscheinung darstellte. Jetzt strahlte wieder der Junge aus ihm heraus, der er nie hatte sein dürfen.
Wexmell bereute in solchen Augenblicken, dass sie Melecay nicht schon Jahre früher gefunden hatten. Doch wie alle anderen hatten sie ihn für tot gehalten. Der Junge Prinz war von seinem Schamanen lange Zeit erfolgreich versteckt und beschützt worden. Trotzdem fragte Wexmell sich stets, welcher Mann aus Melecay geworden wäre, hätten sie ihn als Jungen gefunden und beschützen können.
»Welch düstere Gespräche.« Melecay lachte plötzlich dreckig auf und schlug Wexmell gegen den Arm. »Dabei kam ich nicht zum Reden herein.« Ein lüsterner Blick schwenkte auf Daintys schlafenden Leib.
Wexmell verstand den Wink. »Ich lasse Euch allein.«
»Das müsst Ihr nicht«, lachte Melecay.
Als Wexmell vom Trittbrett sprang, landeten seine Stiefel in einer Pfütze. Der Regen hatte so abrupt aufgehört wie er angefangen hatte, die Sonne strahlte durch die abziehenden Wolken und brannte auf seiner von langen Jahren im Eisland blassen Haut nieder. Die schwüle Hitze sammelte sich auf der Straße. Die mannshohen Gräßer der Wiesen kesselten sie ein und wirkten wie Ofenwände, zwischen denen sie langsam gegart wurden.
Immerhin blieben sie so vor neugierigen Blicken verborgen. Bisher waren sie noch keiner Seele begegnet, seit sie die Grenze überquert hatten. Hoffentlich blieb ihnen das Glück hold.
Kaum schlug die Tür hinter ihm zu, warf der zottelhaarige Kutscher einen Blick nach hinten. Die trabenden Pferde wurden gezügelt, damit Wexmell Karic hinter der Kutsche losbinden konnte. Dann ging es im leichten Trab weiter.
Wexmell stieg auf und ritt nach vorne zum Kutscher, blickte zu ihm hinauf. »Wie schaut`s aus?«
»Alles ruhig«, versicherte Allahad. Neben ihm saß Karrah und schlief tief und fest. Ihr Kopf lag an seiner Schulter, ihre violetten Wellen ergossen sich über seinen Arm.
»Pass auf, dass sie genug trinkt und isst«, trug Wexmell besorgt auf. Er würde nie eine Frau in ihr sehen können. Genau wie für Desiderius, blieb sie auch für ihn immer ihr kleines Mädchen. Doch für andere war sie eine mächtige, eigenwillige Hexe. Aber auch die mussten regelmäßig essen.
Allahad nickte. Mit starrem Blick nach vorne fragte er: »Wird die Kutsche gleich wieder wackeln, sodass ich befürchten muss, vom Weg abzukommen?«
»Du wirst ein wenig gegenlenken müssen.«
»Entzückend.«
Mit einem amüsierten Schnauben trieb Wexmell Karic an, um die Kutsche und drei weitere Reiter zu überholen. Janek, Lazlo und Iwanka nickten ihm stumm zu, ihre Gesichter waren wachsam und professionell, keine Spur von Müdigkeit. Das hätte Melecay nicht erlaubt.
Er ritt kaum einen Augenblick an der Spitze, als durch die hohen Gräßer bereits ein Späher heran galoppierte. Luro lenkte seinen dunkelbraunen Hengst direkt neben Wexmell.
»Die Grenze war von den Elkanasai bereits stark bewacht, Wexmell«, berichtete Luro so atemlos, als wäre er selbst gerannt und nicht sein Reittier, »der Kaiser muss weiterhin einen Angriff von Carapuhr erwarten. Ich sah selten solch große Armeelager.«
»Sind wir noch in ihrer Reichweite?«, fragte Wexmell besorgt.
Luro schüttelte den Kopf und lächelte entspannt. »Nein, aber nur knapp. Ich habe uns genau zwischen zwei Lagern durchgeführt, wir sind jetzt eine Tagesreise hinter ihnen.
Und Melecay wollte schon ein Lager angreifen! Ha! Dass ich nicht lache. Nach all den Jahren habe ich die Schleichkunst nicht verlernt. Selbst mit diesem riesigen Anhang. Ich bin eben unschlagbar, nicht wahr?«
Er grinste auf seine ganz eigene freche Art, die auch Wexmell ein Lächeln abrang.
»Wir sind sicher«, versicherte Luro ernst. »Und wir werden den verdammten Carapuhrianer zeigen, wie man das richtigmacht, oder, Wexmell?« Luro knuffte ihn lachend in die Seite, und Wexmell nickte nachsichtig schmunzelnd.
Einen herausfordernden Blick nach hinten werfend, drehte Luro sich um. »Passt gut auf, von uns könnt ihr Grünschnäbel noch was lernen.«
Iwanka und Lazlo verengten angriffslustig die Augen, Janek schüttelte nur amüsiert den Kopf.
Luro liebte Abenteuer, da wurde er wieder zum Kind. Es war schön, ihn so glücklich zu sehen, dass er scherzen konnte. Ganz im Gegensatz zu Allahad. Wexmell sah dem Schurken die Sorgen Tag für Tag an. Sein geliebter Luro war mittlerweile als Mensch etwas in die Jahre gekommen. Doch gerade für einen Menschen hatte sich der Jäger außerordentlich gut gehalten. Wexmell zweifelte nicht daran, dass Luro noch genauso gut kämpfen konnte wie vor zwanzig Jahren. Vielleicht nur nicht mehr so gänzlich lange wie im Jugendalter. Sie würden sehen. Die Zeit würde zeigen, ob sie noch die Männer waren, die sie gewesen waren, als sie vor über zwei Jahrzehnten ihre Heimat verlassen mussten. Es würde sich zeigen, wer sie ohne Desiderius sind.
Doch Wexmell wusste schon jetzt, dass diese Reise, die gefährlichste ihres Lebens sein würde, und dieses Mal hatten sie keinen Blutrachen, der sie retten konnte.