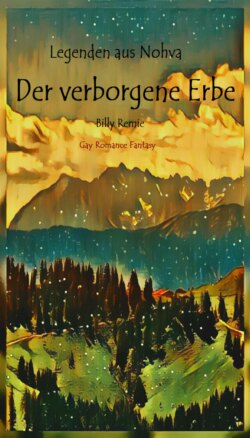Читать книгу Der verborgene Erbe - Billy Remie - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1
ОглавлениеTeil 1: Hoffnung in der Not.
Aus der größten Not heraus, werden Helden geboren, die durch die dunkelsten Schatten des Krieges das schwache Licht längst vergessener Hoffnung bringen. Doch die wahren Helden einer Legende, sind nicht so leicht zu erkennen, wie wir glauben möchten.
Er schlug die Augen auf. Und für einen wunderbaren Moment schwebte er zwischen Traum und Erwachen. Für einen kostbaren Moment wusste er nicht, wo er war. Und in diesem kleinen Moment war die Welt noch in Ordnung, das Leben noch erstrebenswert. Doch nur ein weiterer Augenblick musste verstreichen, und seine Erinnerung kam erschreckend klar zurück.
Das Inferno eines roten Sonnenaufgangs fiel durch den dünnen Schlitz samtener Vorhänge und spiegelte sich in dem Silber der Maske wieder, die auf dem Kopfkissen neben ihm lag.
Wexmell gähnte müde und stützte sich zunächst auf einen Ellenbogen. Er rubbelte sich mit einer Hand das zerknitterte Gesicht, war überrascht, dass er sich, seit Wochen der Schlaflosigkeit, endlich mal wieder einigermaßen erholt fühlte.
Es war die erste Nacht, in der er nicht von Tod und Verlust geträumt hatte. Genau genommen, erinnerte er sich gar nicht daran, was er geträumt hatte. Aber es musste etwas Schönes gewesen sein, denn wenn er nach der Erinnerung suchte, fühlte er ein warmes Gefühl in der Herzgegend, fast wie das Gefühl von Freude oder Glück. Und das hatte er die letzten Wochen wahrlich nicht empfunden.
Trotzdem, als er wie jeden Morgen die unberührte Seite in seinem Bett ansah, fühlte er eine innerliche Leere, die ihn in einen tiefen Abgrund zu stürzen drohte.
Wexmell streckte die Hand aus und krallte die Finger in das leere Laken, sein Blick fiel auf die silberne Maske, die er vor jedem Schlafengehen auf dem zweiten Kissen deponierte, um sich seinem Geliebten so nahe wie möglich zu fühlen.
Für einen Moment schloss er die Augen und legte die Fingerknöchel an die kalte Wange, versuchte sich einzureden, er berührte Desiderius‘ Gesicht.
Schließlich beugte er sich vor, gab der Maske einen Kuss und stand endlich auf.
Er öffnete zuerst die Vorhänge und ließ das Morgenrot auf seine blasse, nackte Haut treffen, ehe er nach seiner Kleidung griff und sie mit Blick auf den Sonnenaufgang gemächlich überstreifte.
Großkönig Melecays Schneider hatte ihm auf eigenen Wunsch hin »einfache« Kleider angefertigt. Eine Lederhose aus Bärenleder, robuste Stiefel zum Jagen und Reiten, einen kurzen, dunklen Umhang und ein einfaches, helles Stoffhemd mit Schnürung. Alles ohne jeden Hauch von feiner Seide.
Seine Rüstung wollte er noch nicht anlegen. Er wusste, die Zeit dafür kam gewiss noch früh genug.
Bevor er seine Gemächer verließ, legte er die silberne Maske in eine Schublade einer massiven Ebenholzkommode, machte noch sein Bett, und hinterließ alles so feinsäuberlich, dass er den Bediensteten keinerlei Arbeit aufhalste.
Wie es eben Wexmells Art war, wollte er niemandem zur Last fallen.
Wie jeden Morgen war es noch still in den Räumen und im Hof der dunklen Burg des Großkönigs von Carapuhr. Als er an der Küche vorüberging, hörte er dahinter leise die Köche, die das Frühstück vorbereiteten.
Wexmell verzichtete wie jeden Morgen darauf. Später, wenn er wieder zurückkam, würde er eine Schale warme Ziegenmilch trinken, aber so kurz nach dem Aufstehen war seinem Magen noch nicht danach, etwas aufzunehmen.
Wie erwartet fand er die königlichen Ställe verlassen vor. Bis auf die Pferde und die schnarchenden Wachen, an denen er sich vorbei schlich, weil er die Männer nicht wecken wollte.
Er schmunzelte über sie. Wenn Melecay diese Nachlässigkeit bemerkte, würde er sicherlich toben. Weshalb Wexmell dem Großkönig nichts davon erzählen wollte. Aber er würde den Wachen wohl beim nächsten Antreffen raten, sich zusammenzunehmen. Keiner wusste besser als er, dass jeder Zeit mit Attentätern zu rechnen war.
Wexmells Schritte waren leise, während er die Stallgasse abging. Er öffnete das Tor der neu erbauten Erweiterung und blickte vom Stall aus auf weitläufige Weiden. Das Gras stand hoch und leuchtete saftig grün in der Morgenröte. Über den sanften Hügeln lag etwas Dunst, wie es Carapuhr nach der Nacht eigen war. Die Morgensonne traf auf sein Gesicht, sie warf den Schatten seiner schlanken Gestalt auf den gepflasterten Boden der Gasse. Die Pferde hoben ihre müden Köpfe, einige scharrten mit den Hufen, drängten nervös nach dem Frühstück oder dem Auslauf auf der Weide.
Wexmell wandte sich von dem idyllischen Anblick des Morgennebels ab, der über den Weiden hing, und holte aus einer Kammer seinen eigens für ihn angefertigten Sattel und das Zaumzeug.
Beides legte er vor der Tür seines weißen Hengstes ab. Das Tier war schon wach. Erwartungsvoll hob es den Kopf über die Stalltür und schnaubte Wexmell ins Haar, als wollte es sagen: »Da bist du ja endlich, ich warte schon seit Stunden.«
»Guten Morgen, mein Hübscher!«, verwendete Wexmell die Begrüßung, mit der auch Desiderius seinen Wanderer jeden Morgen begrüßt hatte. Er hob den Arm und strich dem ungestümen Hengst über die breite Stirn, fegte ihm das weiße Haar zur Seite. »Na, bereit für den Ausritt?«
Karic legt seine weichen Nüstern an Wexmells Gesicht und schnaubte ihn erneut an.
Wexmell lachte leise und öffnete die Tür zum Stall.
Lange hatte Wexmell überlegt, wessen Namen er seinem Hengst geben konnte. Für einen Moment hatte er natürlich mit der Vorstellung geliebäugelt, ihn Desiderius zu taufen. Doch das hätte er nicht übers Herz gebracht. Jedes Mal, wenn er das Tier gesehen hätte, hätte es ihn nur an die Leere in seinem Herzen erinnert.
Dann war ihm sein geliebter Bruder eingefallen. Wexmell hatte natürlich all seine Geschwister geliebt, aber er und Karic hatten doch eine ganz besondere Beziehung zueinander gehabt. Der älteste und der jüngste Sohn des Königs, sie waren unzertrennlich gewesen. Sie hatten immer ihre Späße untereinander getrieben, hatten anderen Streiche gespielt, waren ein Herz und eine Seele gewesen, bevor Karic sich mit Silva verlobte, und Wexmell nur noch Augen für Desiderius hatte. Wexmell hatte Karic immer vertraut, ihm wegen seines großen Selbstbewusstsein und seiner leichten Arroganz geliebt.
Eigenschaften, die auch dieser wilde, ungestüme Hengst zeigte. Selbstvertrauen und Eigenwille. So war Wexmell die Entscheidung letztlich nicht schwergefallen.
Als Wexmell in den Stall trat, senkte der Hengst den Kopf und stupste ihn leicht an, forderte Zuneigung und Streicheleinheiten. Wexmell schlang wie jeden Morgen die Arme um den großen Kopf, dessen Stirn sich an seine Brust drückte, und legte das Gesicht an die weiche Mähne seines Pferdes. Für einen Moment genoss er den Trost, dem ihm das Tier jeden Morgen schenkte, als spürte es, dass jeder weitere Tag ohne Desiderius für Wexmell unerträglich war.
Er machte sich los, um Karic zu striegeln, zu satteln und aufzuzäumen. Schließlich führte er das Tier aus dem Stall, holte noch Bogen und einen gefüllten Köcher aus einer Kammer, und ritt aus dem Burgtor, noch bevor die Königsfamilie in ihren Betten erwachte.
Er spürte nicht, dass ihn argwöhnische Blicke von der Mauer aus folgten.
Das wahrscheinlich schönste am wilden Carapuhr war, dass man nicht lange reiten musste, um der Zivilisation zu entfliehen. Unweit der königlichen Burg entfernt, konnte Wexmell auf Karics Rücken in einem tiefen Tannenwald verschwinden. Auch hier lag der Dunst noch dicht über dem Boden, wie an einem frühen Herbstmorgen, dabei war es längst Sommer in Carapuhr.
Kaum hatte er den bekannten Trampelpfad erreicht, der auf eine Hügellichtung hinaufführte, trieb er Karic in den Galopp. Wexmell fiel in den Schwung der Gangart ein. Karic hatte einen sanften Galopp, geschmeidig, Wexmell wurde im Sattel leicht vor und zurück gewogen, wie ein Kind in der Wiege. Er spannte den Oberkörper an, ließ die Zügel etwas lockerer und gab Karic mehr Freiheiten.
Der Hengst nahm sie sich sofort und wurde schneller, etwas ungestümer. Dankbar galoppierte er den schmalen Pfad durch den Wald entlang, nahm mit Freuden jedes Bisschen Freiheit, die Wexmell ihm gewährte.
Reiter und Tier liebten die frühmorgendlichen Ausritte, so still, so einsam, so unendlich frei.
Oben auf dem Hügel angekommen hielt Wexmell im hohen Gras an und stieg ab. Er führte Karic an einen einsamen Baum, der am Rande der sanften Absteige stand, getrennt von all den anderen Bäumen, die die Lichtung umrandeten.
Wexmell musste Karic anbinden, so leid es ihm tat, denn der Hengst war nun mal nicht Wanderer. Wanderer hatte immer freilaufen können, er wäre nie von Desiderius‘ Seite gewichen. Er war wie ein treuer Hund gewesen, mehr Freund als Reittier.
Oh ihr grausamen Götter, selbst das Pferd seines Geliebten hatten sie ihm genommen. Was hätte Wexmell nicht alles dafür gegeben, wenigstens den Hengst wieder herbeirufen zu können, doch keiner konnte sich erklären, wohin das Tier verschwunden war. Es ist in jener Nacht davongelaufen, in der sie überfallen worden waren. Vielleicht hatten Rahffs Männer den Hengst sogar mitgenommen.
Wexmell band die Zügel um den Baumstamm, ließ Karic aber genügend Raum, damit er den Kopf senken und grasen konnte. Dann nahm er Pfeil und Bogen und stakste in den Wald.
Es dauerte nicht lange, bis er das erste Tier im Blick hatte.
In geduckter Haltung schlich er näher heran, den Pfeil locker in den Bogen gelegt, aber noch nicht gespannt. Zunächst hielt er den braunen Fellrücken für eines von Carapuhrs absurd großen Eichhörnchen, doch dann stellte es sich als Kaninchen heraus.
Für einen Moment stockte Wexmell, nicht wissend, was er jetzt tun sollte. Desiderius hatte ihm einst die rührende Geschichte darüber erzählt, weshalb er keine Kaninchen jagte und aß. Genau jene Geschichte kam ihm wieder in den Sinn. Jene Geschichte, und all die anderen, die sie sich damals an dem Fluss erzählt hatten, bevor sie sich im Schutz der hohen Gräser geliebt hatten. Damals, als sie noch so jung gewesen waren, sich gerade erst kennengelernt hatten und herausfanden, was sie von einander erwarten konnten …
Es schien ein anderes Leben gewesen zu sein.
Wexmell atmete tief durch, dann spannte er den Bogen und zielte. Genau wie Luro es ihm unzählige Male gezeigt hatte, hielt er die Luft an und erfasste seine Beute. Er schätzte die Entfernung ab, erwog, ob das Kaninchen sich bewegen würde – und wohin. Korrigierte den Pfeil, zielte etwas höher, mehr links, wegen des Windes. Er musste nur noch loslassen, und …
Er verharrte. Schweiß perlte an seiner Schläfe hinab.
Warum konnte er es nicht? Er aß gern Kaninchen. Er ging gerne Jagen, seit er sicher im Umgang mit dem Bogen war. Er mochte es, den Köchen in der Burg eine Freude zu machen, wenn er ihnen nach dem Ausritt am Morgen frisches Fleisch vorbeibrachte, dass sie für sich selbst zubereiten und ihren Familien mitbringen durften.
Es war doch nur ein Kaninchen, sprach er auf sich selbst ein. Desiderius war nicht mehr hier, um etwas an seiner Beute auszusetzen zu haben. Er würde Wexmell nicht mehr tadeln können, ihm keinen seiner griesgrämigen Blicke mehr zuwerfen können.
Nie mehr.
Und Wexmell würde nie mehr die Gelegenheit haben, ihm diesen zynischen, verbissenen Ausdruck aus den verhärteten Mundwinkeln zu küssen.
Nie mehr.
Wexmell blinzelt die Tränen fort, die ihm in den Augen brannten. Er hatte in seinem Leben jetzt schon wahrlich genug geweint, er war es leid.
Tu es, drängte er sich. Niemand würde daran Anstoß nehmen.
Noch einmal spannte er die Bogensehne, richtete den Pfeil auf das Kaninchen und …
Er konnte nicht.
Ermüdet sackte er zusammen und ließ sich auf die Knie nieder. Seine Arme fielen mutlos an den Seiten herab, in der einen Hand den Pfeil, in der anderen den Jagdbogen.
Wenn er nicht einmal fähig war, ein Kaninchen zu töten, nur weil Desiderius es nicht getan hätte, wie sollte er je über ihn hinwegkommen?
Wobei »hinwegkommen« ohnehin die falsche Bezeichnung dafür war. Wexmell wollte nicht darüber hinwegkommen, dass sein Geliebter jetzt tot war, dass sie sich nie wiedersehen würden. Aber er erhoffte sich doch zumindest, dass dieser elende Schmerz in seinem Herzen langsam abklang. Dass er nachts schlafen konnte. Und dass er nicht jeden winzigen Augenblick seines Lebens daran denken musste, dass er Desiderius verloren hatte.
Es zerriss ihn innerlich so sehr, dass er kaum zu hoffen wagte.
Das Schlimmste, das ihn hätte passieren können, war Desiderius zu verlieren, und genau das war eingetroffen.
Wie sollte er damit umgehen?
Wenn er doch nur irgendein Zeichen erhalten würde. Irgendein Gefühl. Oder zumindest irgendetwas spüren würde, das ihm das Gefühl gab, Desiderius wachte noch über sie alle.
Doch da war nichts. Nichts war von Desiderius übrig. Nichts war geblieben.
Gänzlich unerwartet drängte sich eine Bewegung in sein Blickfeld. Wexmell sah auf und bemerkte ein weiteres Kaninchen, das aus dem Busch hoppelte. Es gesellte sich zu dem anderen, ihre langen Ohren zuckten aufgeregt, ihre winzigen Nasen ruckten schnell auf und ab, ihre Zähne rupften das Gras aus dem Boden und ihre Köpfe flogen nervös hin und her.
Sie bemerkten ihn nicht, zu reglos kniete er da und beobachtete sie.
Das dazugekommene Kaninchen hoppelte dicht an das andere, drängte sich dagegen und stupste es mit dem Kopf an. Sie begrüßten sich. Das eine Kaninchen leckte dem anderen über die Stirn, putzte es sorgfältig, woraufhin das Frühstück eingestellt wurde, und das Kaninchen, das geputzt wurde, seinen Kopf drängend seinem Artgenossen entgegenschob.
Wexmells Mundwinkel verzogen sich zu einem Lächeln.
Und dann tat die Natur etwas völlig Unpassendes im Angesicht dieses lieblichen Moments. Der Instinkt der Tiere ging mit ihnen durch. Das eine Kaninchen bestieg das andere und rammelte es ungehalten im Dunst des Morgens.
Für einen Moment sah Wexmell ziemlich belämmert aus der Wäsche, ehe er das Geräusch in seiner Kehle nicht mehr zurückhalten konnte. Er begann leise zu lachen.
»Vermisst du es?«
Wexmell fuhr mit einem leisen Aufschrei herum.
Der Mann hinter ihm, der lässig mit einer Schulter am Baumstamm gelehnt hatte – er musste ihn schon länger beobachtet haben – bedeutete ihm, sitzen zu bleiben.
Wexmell lächelte etwas verlegen. »Was denn? Das Rammeln?«
Lachend schlenderte Allahad auf ihn zu. Er ruckte mit der Schulter, woraufhin sein Falke mit dem rot gefiederten Kopf die Flügel ausbreitete und in den Himmel abhob.
»Die Zweisamkeit«, korrigierte Allahad und setzte sich zu Wexmell auf den feuchten Boden. Er sah ihm schelmisch in die Augen. »Und das Rammeln.«
Wexmell senkte schmunzelnd den Kopf. Da er das Knien leid war, zog er die Beine hervor und setzte sich auf den Hintern. »Ich wusste nicht, dass schon jemand wach ist«, wich er der Frage aus.
Allahad fuhr sich durch sein schulterlanges, unordentliches Haar, das ganz genauso wirkte, als hätte es vor Kurzem erst ein gewisser Jemand mit den Händen durchwühlt.
Für einen Moment beneidete Wexmell Allahad und Luro darum, dass sie einander hatten. Aber das Gefühl dauerte nicht allzu lange an. Dafür war Wexmell einfach zu … nett. Er konnte auf seine engsten und ältesten Freunde nicht neidisch sein, nur weil sie das Glück hatten, dass sie beide noch am Leben waren.
So jemand war er nicht. Und er wollte es auch nicht sein.
»Luro ist auch auf der Jagd«, erklärte Allahad und blickte dann gen Himmel.
Wexmell folgte dem Blick ohne etwas zu erkennen. Zweifellos, so ging es ihm in jenem Moment durch den Kopf, flog Allahads Falke zu dem Jäger im Wald, um über ihn zu wachen.
Nicht, dass Luro Schutz nötig gehabt hätte. Aber so war das eben unter Männern von diesem Schlag. Allahad konnte ebenso wenig wie Luro den Beschützerinstinkt abstellen. Genauso war es Desiderius immer ergangen, obwohl er nach zwanzig Jahren allmählich gelernt hatte, Wexmells Fähigkeiten zu vertrauen.
Wexmell senkte den Kopf und atmete schwer durch. »Er fehlt mir jeden Tag mehr«, gab er müde zu.
»Uns allen«, erwiderte Allahad, und gab Wexmell das Gefühl, mit seiner Trauer nicht gänzlich allein zu sein. Das tat unheimlich gut.
»Willst du etwas hören, das dich kurzzeitig aufmuntern wird?«, fragte Allahad und lächelte Wexmell amüsiert zu.
Wexmell zuckte mit den Achseln. »Ja, natürlich.«
»Der Rammler da …«, Allahad nickte zu den Kaninchen und deutete mit einem ausgestreckten Finger auf sie, » … erinnert mich stark an Luros ungestüme Versuche, den Part des Besteigers zu übernehmen.«
Wexmell drang sich das Bild auf, das Allahad ihm beschrieb. Er brach in Gelächter aus und stieß Allahad mit der Schulter an. »Du bist furchtbar. Und gemein!«
Allahads leises Kichern war dunkel. »Nein, ehrlich. Frag ihn, er wird es nicht leugnen.«
»Danke, doch ich verzichte.« Aber Wexmell war dankbar für den kurzen Moment, den Allahad ihn zum Lachen gebracht hatte. Er wischte sich eine Lachträne aus dem Augenwinkel und sagte aufrichtig: »Danke, Allahad, ich weiß deine Mühen zu schätzen. Aber vergiss nicht, dass es nicht deine Pflicht ist, mich aufzumuntern.«
»Wir sind Freunde«, sagte Allahad ernst, »Familie, Wexmell! Es ist meine Pflicht. Und es ist eine Pflicht, die ich nicht als solche empfinde. Außerdem … wie oft hast du mir mit Rat zur Seite gestanden? Ich will dich trösten, soweit es mir zusteht, weil du es zweifellos auch für mich oder Luro – ach was rede ich da, für einfach alle tun würdest. Jetzt verdienst du es, dass andere für dich da sind.«
Wexmell lächelte ihn teils gerührt, teils traurig an. »Ich danke dir.«
Freunde wie diese zu haben, bedeutete Wexmell alles auf der Welt. Ohne Luro und Allahad wäre er in den letzten Wochen sicherlich in einen tiefen Abgrund gestürzt. Sie hatten ihn immer wieder aufgefangen. Sie hörten ihm zu. Oder er ihnen. Sie gaben sich gegenseitig Trost und Halt. Wie eine Familie es eben einfach tut.
»Luro und ich …«, begann Allahad zögerlich und senkte den Blick zu Boden, »… wir haben beide schon am eigenen Leib erfahren, was es bedeutet, einen Geliebten zu verlieren. Und ich denke … Also ich möchte dir schon seit Tagen etwas sagen, doch weil Desiderius mein engster Freund war, fällt es mir schwer, diese Worte über meine Lippen zu bringen …«
Neugierig betrachtete Wexmell sein Profil.
Allahad sah ihm ernst in die Augen. »Du wirst verzweifelt sein, lange. Du wirst traurig sein, lange. Aber irgendwann, da kommt der Moment … da wirst du dich gut fühlen. Glücklich sein. Und wenn der Moment da ist …«, es war Allahad anzusehen, dass es ihm schwerfiel, weiter zu sprechen, » … empfinde keine Schuld.«
Wexmell begann zu lächeln, denn er konnte mit absoluter Sicherheit garantieren: »Das wird nicht geschehen.«
Allahad nahm gequält den Blick von Wexmell. »Das dachte ich auch einmal.«
»Ich bin nicht du.« Es war kein Tadel, sondern nur eine liebgemeinte Erinnerung.
»Nun denn, vielleicht findest du keine Liebe mehr«, lenkte Allahad ein, weil er wohl zu dem Schluss gekommen war, dass Wexmell für diese Art von Gespräch noch nicht bereit war.
Dafür war es wahrlich noch zu frisch.
Allahad sah Wexmell wieder in die Augen. »Aber du wirst eines Tages wieder etwas anderes als Trauer empfinden. Ob du willst oder nicht. Und ich will dir nur sagen, dass du, wenn es soweit sein sollte, keine Schuld empfinden musst. Ich möchte nur sagen … wir verurteilen dich nicht, ganz egal, was geschieht.«
Die Loyalität seiner Freunde rührte Wexmell bis tief in seine verletzte Seele. Er lächelte Allahad nur dankbar an. Er brachte in jenem Moment keine Worte hervor, die ausgedrückt hätten, wie ergriffen er war.
Er drehte das Gesicht und blickte nachdenklich in den Wald. Allahads Worte gingen ihm einen Moment im Kopf herum. Und er musste sich fragen, was er empfinden würde, wäre er tot und Desiderius noch am Leben. Wenn es anders herum wäre, wenn er von der Nachwelt heraus Desiderius im Leben beobachten und glücklich sehen würde, vielleicht neu verliebt …
Ja, der Gedanke machte ihn für einen Augenblick wütend, doch dann besann er sich wieder.
Das Glück seines Geliebten wäre ihm wichtiger als sein eigenes Empfinden. Denn er wäre dann tot, und Desiderius musste weiterleben.
Wexmell glaubte fest daran, dass es Desiderius nur wichtig wäre, dass Wexmell glücklich war. Wo auch immer er jetzt sein mochte.
Trotzdem fragte Wexmell nachdenklich an Allahad gewandt: »Würdest du es Luro gönnen, wenn du tot und er am Leben wäre? Glück ohne dich?«
Allahad senkte den Kopf, er blieb Wexmell die Antwort schuldig. In dieser Sache kannte Wexmell den eifersüchtigen Schurken ohnehin so gut, dass er die Antwort bereits wusste.
Die Sonne war während ihres Gesprächs weiter gen Himmel gewandert und sandte gemächlich ihre Strahlen durch die Tannenbäume.
Seufzend hielt Wexmell das Gesicht in die Sonne und schloss die Augen. »Darüber mache ich mir gar keine Gedanken, Allahad. Einzig und allein, wo er jetzt sein mag, interessiert mich.«
Er spürte Allahads neugierige Augen auf seinem Profil.
»Die ganze Zeit schon erwarte ich eine Art Zeichen«, gestand Wexmell und streckte die Hand leicht aus, als milder Morgenwind um sie herum einen Bogen beschrieb, sodass ihre Haare zur Seite gedrückt wurden. »Etwas, das mich ihn spüren lässt. In der Luft. Im Wasser. In der Erde, auf der wir sitzen. Im Feuer, das unser Essen wärmt. Irgendwo. Irgendetwas. Aber …«
»Da ist nichts«, flüsterte Allahad traurig, als erginge es ihm ebenso.
Wexmell öffnete die Augen und betrachtete den Schurken. Er saß leicht nach vornegebeugt neben ihm und hatte einen Ast vom Boden aufgehoben, mit dem er Spiralen in den von Tannennadeln übersäten Waldboden malte.
»Ich spüre gar nichts«, sagte Wexmell düster.
Allahad hob verwundert über Wexmells finstere Stimme den Blick.
»Ich müsste doch etwas spüren!«, glaubte Wexmell, ihm war seine Verwirrung deutlich anzuhören. »Das er tot ist! Ich spüre es nicht, Allahad.« Wexmell lehnte sich zu seinem alten Freund und klopfte sich auf die Brust, wo sein gebrochenes Herz schlug. »Hier drinnen müsste ich es doch spüren! Ich habe immer gedacht, wenn er eines Tages vor mir stirbt, würde ich es mit jeder Faser meines Körpers wissen. Es müsste sich anfühlen, als hätte jemand die andere Hälfte meines Herzens rausgeschnitten. Sie müsste tot sein. Aber da ist nichts. Ich fühle mich noch genauso wie zuvor, nur voller Unglauben.«
Allahad forschte mit einem Blick in Wexmells Augen, der deutlich werden ließ, dass er Wexmell zutiefst bemitleidete, weil er ihn für leicht von Sinnen hielt.
Seufzend wandte Wexmell sich ab. Niemand würde es je verstehen. Weil niemand die Tiefe der Liebe je verstehen würde, die Desiderius und er für einander empfanden, ob im Leben oder im Tod.
»Er ist tot, Wexmell«, sagte Allahad einfühlsam, aber erschreckend endgültig. »Wir wünschten alle, es wäre anders.«
Es gab keine Worte, die Allahad begreiflich machen konnten, was Wexmell meinte.
»Vielleicht will dein Herz es nicht glauben, weil du … ihn nicht mehr sehen konntest. Seine sterbliche Hülle.«
»Seine Leiche?«, brachte Wexmell barsch hervor. Ja, nicht einmal diese hatte Rahff zurück nach Carapuhr schicken wollen. Wer wusste schon, was mit Desiderius nach der Hinrichtung geschehen war …
Daran konnte Wexmell nicht denken, ihm wurde übel dabei.
Zumindest, so tröstete er sich mehr schlecht als recht, war Desiderius‘ Leiche dort, wo er immer hatte sein wollen. In ihrer Heimat.
»Es tut mir leid«, sagte Allahad ernüchtert. »Ich bin kein so guter Tröster wie du.«
»Das liegt derweil an dem, den zu trösten du versuchst, nicht an dir, dem Tröster«, sagte Wexmell und zwang sich zu einem Lächeln.
Allahad erwiderte es.
Doch Wexmells Blick glitt wieder ab, seine Miene verdüsterte sich erneut, als er über seine andere Sorge nachdachte, die ihn schon solange quälte. Er musste es loswerden, ehe es ihn verschlang, auch auf die Gefahr hin, seinem Freund die gleiche Angst aufzubürden, die er mit sich herumtrug.
»Ich war tot! Ich war dort, in der Nachwelt. Ich kann mich an alles erinnern, was ich dort gesehen habe …«, verzweifelt nach Rat ersuchend sah Wexmell Allahad in die Augen, » … und wenn er auch tot ist … warum habe ich ihn dann nicht gesehen?« Seine Augen füllten sich mit Tränen. »Warum waren wir nicht … zusammen dort?«
Diese Frage verschlug Allahad die Sprache. Er öffnete die Lippen, holte sogar Luft, doch dann schüttelte er nur entschuldigend den Kopf.
Tief durchatmend drehte Wexmell das Gesicht gen Wald und starrte in die Leere. »Ist es das, was auf uns wartet?«, fragte er mehr sich selbst als Allahad. »Eine leere Welt, die wir allein füllen müssen? Dürfen wir uns im Angesicht des Todes nicht damit trösten, unsere Geliebten wieder zu sehen, die vor uns von dieser Welt schieden?«
»Er war nicht dort?«, fragte Allahad nach.
»Nein«, bestätigte Wexmell seufzend. »Niemand war dort.«
»Vielleicht … weil du doch gar nicht richtig tot warst«, glaubte Allahad. »Du hast weder Zazar gesehen, noch sonst irgendwen. Vielleicht war alles nur ein Traum.«
»Vielleicht«, stimmte er zu. Aber richtig glauben wollte er es nicht.
Doch was wäre die Alternative? Dass er die Ewigkeit nach dem Tod ohne Desiderius verbringen würde? Das wollte er nicht glauben. Er wollte nicht glauben, dass sie sich nie mehr wiedersehen würden.
Nie mehr …
Der Gedanke machte ihn wahnsinnig.
Und wenn doch, wenn der Tod doch nur eine Ewigkeit der Einsamkeit bedeutete, dann machte es auch keinen Unterschied, ob er lebte oder starb. Genauso gut konnte er sich zusammennehmen und seine mentale und körperliche Kraft dazu verwenden, die Welt der Sterblichen etwas besser zu machen. Seinen und Desiderius‘ Traum zu verfolgen. Seine Versprechen gegenüber Melecay zu halten. In die Heimat zurückkehren. Seinen Freunden die Gelegenheit zur Rache verschaffen.
Für Desiderius‘ Traum, für sich selbst, für Karrah, Luro und Allahad, wollte Wexmell nicht verzagen, weshalb er sich immer noch auf den Beinen hielt, obwohl die Last der Welt ihn allmählich zu erdrücken begann.
Bald würden sie aufbrechen. In wenigen Tagen schon. Sie würden ins gefährliche Elkanasai reisen und einen Kaiser bezwingen.
Oder zumindest den wahnwitzigen Versuch dazu unternehmen.
Melecay tat es aus Angst vor dem Kaiserreich, oder wohl mehr aus Rache und Machtgefühl. Wexmell tat es aus Pflichtbewusstsein, wegen der Sklaven und wegen der Bedrohung, die sich bis nach Nohva ausbreiten konnte.
Erst Elkanasai, dann Nohva. Mithilfe der kaiserlichen Truppen müsste Rahff gezwungen sein, zu kapitulieren. Und wenn nicht, machte es auch keinen Unterschied mehr, er würde sterben.
Wexmell war kein Mensch der Gewalt, so ein Mann wollte er auch nicht sein. Er war auch niemand, der von Hass zerfressen sein konnte. Doch Rahff hatte ihm tiefe Wunden zugefügt, und Wexmell würde das nicht dulden. Allein für Desiderius musste er den Verräter vom Thron stürzen. Trotzdem hoffte Wexmell, Rahff würde aufgeben, um einen Krieg zu verhindern.
Doch bevor es überhaupt soweit war, stand Wexmell noch eine lange Reise und eine gefährliche Aufgabe bevor. Erst einmal musste er lebend nach Elkanasai reisen, mitten ins Herz der Hauptstadt, und irgendwie den Kaiser stürzen, ohne dafür getötet zu werden.
Dazu brauchte es mehr als Mut, es brauchte Gerissenheit.
Er wusste nicht, ob er schon dazu bereit war.
Schlimmer als diese Sorgen, war noch der Gedanke, dass Luro und Allahad durch ihn in Elkanasai zu Schaden kamen, bevor sie die Möglichkeit hatten, ihre Heimat wiederzusehen. Ganz zu schweigen von Karrah, die jetzt Mutter und Ehefrau war.
Wexmell hatte darüber nachgedacht, sie nicht mitzunehmen, aber Karrah war zu eigensinnig. Wenn sie etwas wollte, konnte sie niemand davon abbringen. Sie hatte den Starrsinn von Desiderius, eindeutig!
Der Vergleich ließ ihn lächeln.
Letztlich war es nicht seine Entscheidung gewesen, sondern ihre. Sie würde ihn begleiten, und er würde ihre Zauberkraft vermutlich auch brauchen. Selbst wenn nicht, war es immer beruhigend, eine geschickte Heilerin bei sich zu wissen.
Melecays Bruder Melvin hatte getobt. Er wollte, dass Karrah hierblieb, zusammen mit ihrem gemeinsamen Sohn, dafür wollte Melvin mitreisen.
Da war ihm Melecay jedoch dazwischengekommen. Der Großkönig hatte sein Machtwort gesprochen. Melvin musste in Carapuhr bleiben, er musste das Land regieren, während Melecay und Dainty abwesend waren.
Es stand schon seit Wochen fest, wer bleiben und wer gehen würde. Sie alle warteten teils ungeduldig und teils befürchtend auf den Tag der Abreise.
Als hätte er seine Gedanken gelesen, sagte Allahad nachdenklich: »In Elkanasai reinzukommen wird nicht schwer. Ich befürchte nur, dass es nicht so einfach sein wird, dort lange zu überleben.«
»Nein, das wird es garantiert nicht.« Und Wexmell hatte schon jetzt das unbehagliche Gefühl, dass er Carapuhr nie wiedersehen würde. Das machte ihn traurig, denn er liebte dieses Land.
Allahad wandte ihm das Gesicht zu, als drängte sich ihm urplötzlich eine Frage auf, die keinen Aufschub duldete. »Darf ich fragen, weshalb du dich letztlich doch entschlossen hast, nach Elkanasai zu gehen?«
Wexmell hätte viele gute Gründe nennen können, und alle hätten zu einem geringen Teil sogar der Wahrheit entsprochen. Doch nachdem er kurz den Kopf schuldig hängen gelassen hatte, hob er das Gesicht wieder an und erwiderte Allahads brennenden Blick. »Die Wahrheit?«
Allahad rang sich ein Schmunzeln ab. »Bist du überhaupt in der Lage, zu lügen?«
Wexmell lachte leise auf. »Wohl nicht.« Dann ließ er seufzend und ergebend Schultern und den Kopf hängen. Er starrte in den Nebel, der über den Waldboden kroch und der sich ganz gemächlich verzog, während der Vormittag anbrach.
»Die Wahrheit ist«, hauchte er gestehend, »dass ich hoffte, durch diese Mission vergessen zu können.«
Voller Mitgefühl und Verständnis verzog Allahad seine Mundwinkel. Er legte Wexmell eine Hand auf die Schulter und drückte sie aufmunternd. »Das kann ich gut verstehen. Und ich spreche für Luro und mich gemeinsam, wenn ich sage, dass wir dir guten Gewissens und mit dem Herzen folgen. So wie seitjeher, mein Kronprinz.«
Nur zwei Tage nach diesem Gespräch reisten sie ab, genau einen Tag bevor eine verzauberte Taube mit einer Nachricht aus Nohva im Könighaus Carapuhrs eintraf.