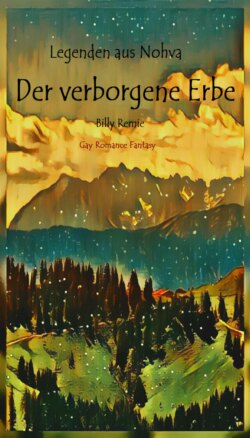Читать книгу Der verborgene Erbe - Billy Remie - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Prolog
ОглавлениеSeine Stiefel pochten bei jedem Schritt auf dem kahlen, feuchten Gestein. Blut tropfte aus seinen tiefen Wunden auf den Boden und hinterließ eine genaue Spur des Weges, den er voran stolperte. Das Schwert mit der geschwungenen Klinge noch fest in der Hand, die blutbeschmierte Schneide bereit zum Einsatz, doch sein verletzter Arm, in den das Monster seine Zähne geschlagen hatte, schmerzte so stark, dass er schwach an seinem Körper hinabhing, und die Spitze seines Schwertes über den Gesteinsboden zog, sodass sie Funken erzeugte.
»Du weißt doch sicher, dass uns die Kreatur in eine Falle lockt.«
Sei still, bat er sanft die andere Stimme, bitte, lass mich denken.
Es war dunkel. So dunkel, wie es in einer Höhle sein konnte. Ein Licht, hell und mystisch, am Ende des langen Gangs, wies ihm den Weg zum Herz des natürlichen Gewölbes.
Vor Jahrhunderten war dieser Ort in Vergessenheit geraten. Und vermutlich war er der erste Sterbliche seit einer Vielzahl von Jahrzehnten, der mit seinen unwürdigen Stiefeln diesen heiligen Boden betrat.
Er ging den Tunnel entlang. Schlurfte, schnaubte, am Ende seiner Kräfte. Es war kühl dort drinnen. Feuchtigkeit glänzte auf dem von Wasser glattgeschliffenen, dunkelgrauen Gestein. Das mystische Licht leuchtete darin. Wasser perlte an den Wänden hinab. Das Erklingen der Tropfen in feuchte Pfützen hallte laut in der Höhle wider.
Als er aus dem Tunnel trat, fand er sich in einer Art Grotte wieder. Der mystische Lichtschimmer wurde von einem See verursacht, der aus so klarem Wasser bestand, dass es nicht möglich war, eine Spiegelung auf der Oberfläche wahrzunehmen. So war der Tunnel unter Wasser, der aus der Höhle direkt ins Meer mündete, seinen Augen nicht verborgen.
Es gab also zwei mögliche Fluchtwege, sollte er hier nicht siegen können. Der trockene Weg, den er gekommen war, oder der nasse Weg durchs Wasser.
Wobei er nicht sicher sein konnte, wie weit der Tunnel sich erstreckte, und ob er überhaupt lange genug die Luft anhalten konnte, um ihn zu durchtauchen.
Doch es bedeutete auch, dass das Monster, das er verfolgte, wohlmöglich gar nicht mehr hier war. Und ihm stand mit seinen offenen Wunden nicht der Sinn danach, in salziges Meerwasser zu springen und ihm nachzuschwimmen, zumal es für ihn als Sterblichen unmöglich war, jenes Monster ausgerechnet im Wasser zu besiegen.
Es roch angenehm in der Höhle. Frisch. Salzig. Nach dem tobenden Meer – und Freiheit.
Vor dem See, und unmittelbar vor ihm, tat sich ein Hain auf. Eine Statue aus weißem Marmor zeigte eine schlanke Gestalt – menschlicher Natur – die elegant einen Arm in die Höhe streckte. Auf der nach oben gerichteten Handfläche befand sich eine hohe Welle, als läge die unbändige See der Welt in der Hand dieser Statue. Die andere Hand hielt eine Schlange an die flache Brust gedrückt. Der Kopf des Tieres steckte zwischen den Fingern, die das Tier zu erwürgen schienen, die Zunge züngelte heraus, die Augen waren zu giftigen Schlitzen verengt, der lange Körper um einen schmalen Unterarm geschlungen.
Die Statue trug eine Tunika, die an der rechten Schulter mit einer Spange oben gehalten wurde. Um die schmale Taille war ein Band geschlungen. Auf der einen Seite war die Statue eine zarte, junge Frau, mit weichem Gesicht, langem Haar und einer Brust, die sich perfekt in die Hand eines Mannes schmiegen würde. Auf der anderen Seite war sie ein junger anmutiger Mann, mit kurzem Haar und kindlichen Zügen, dessen Brustmuskel aus der Tunika hervorlugte.
Ein uralter, vergessener Gott, der längst von neuen, gutmütigen Göttern ersetzt wurde. Das Monster mit den vielen Gesichtern, dass die See beherrschte, und abwechselnd Seefahrer ins Unglück verführte oder die Wellen über die Küsten schwappen ließ, um alles Leben dort zu vernichten.
Das Ungeheuer, das es zu besiegen galt.
Vor der Statue stand ein uralter aus groben Stein gehauener Altar. Die Opfergaben von längst vergangenen Zeiten hätten durch die Feuchtigkeit längst verfault sein müssen, doch irgendwas hatte sie erhalten. Blumen und frische Felle bildeten eine Art Bettstatt auf dem Altar. Auf den Stufen seines Podestes lagen dem Altar Obst, Fleisch, ungeschliffene Edelsteine und sogar Gold und Silber in Form von primitiven Münzen zu Füßen. Die Gaben waren das letzte Zeugnis von den einstmalig Lebenden, die hergekommen waren, um etwas zu erbitten. Oder um die rauen Wellen der See zu besänftigen, ehe sie die bewohnten Küsten verschlangen.
Laut den Überlieferungen alter Legenden, war es lange vor seiner Zeit – lange vor der Zeit der Welt, wie die Sterblichen sie kannten – Gang und Gebe gewesen, einen dieser Haine aufzusuchen und durch mitgebrachte Opfergaben die Gunst der Götter zu erlangen.
Sein Gang war träge, er wirkte fast gelangweilt, doch es war Furcht, die seinen Schritt erlahmte. Die Einsamkeit und die Trauer dieses Ortes übertrugen sich auf ihn, sodass sich ihm die Haare im Nacken sträubten.
»Eines Tages werden auch wir vergessen sein. Egal, was du für die Welt opferst. Genau wie die Kreatur, die du jagst. Wir sind alle gleich.«
Ich weiß, seufzte er in Gedanken, aber das ist jetzt nicht wichtig.
Für einen Moment fragte er sich tatsächlich, weshalb er das Wesen jagte, und ob er die Kreatur nicht einfach ziehen lassen sollte.
Aber er konnte nicht, er hatte eine Pflicht zu erfüllen, vor der er nicht davonrennen konnte.
Vor dem Altar blieb er stehen und blickte noch einmal hinauf zu der Statue, die trotz all der Zeit wie frisch erbaut wirkte. Die Witterung konnte diesem Ort nichts anhaben, hier stand die Zeit still.
Schließlich wurde seine Erschöpfung zu groß, seine Knie knickten ein. Mit einem geradezu erleichterten Seufzen ergab er sich den Mächten der Natur und sank vor dem Hain schwer auf die Knie.
»Sie ist noch hier«, züngelte der Drache in ihm. »Ich kann sie spüren.«
»Ich weiß, dass du noch hier bist!« Seine Stimme klang kratzig, aber trotz der Erschöpfung noch erstaunlich laut. »Stell dich deinem letzten Kampf, Herrin der Gewässer!«
»Was lässt Euch annehmen, es könnte mein letzter Kampf sein?« Das Wasser blubberte leise, als die samtweiche Stimme der Gottheit erklang. Zunächst war nichts zu sehen, außer Luftblasen, die über die klare, unbewegte Oberfläche des Wassers immer weiter zum Ufer gelangten. Dann erschien ganz langsam ein Scheitel mit dunklem Haar aus dem Wasser. Die junge Frau, die langsam dem See entstieg, war das genaue Ebenbild der weiblichen Seite der Statue. Groß, graziös, schlank. Anmutig und weich. Wunderschön. Zu schön um sterblicher Natur zu sein. Dunkles, langes Haar, das trocken aus dem Wasser hervorkam, ganz anders als ihre vor Nässe triefende, blasse Haut, und die feuchte Tunika, die sich durchsichtig um ihren eleganten Körperbau schmiegte.
Ein verwegenes Lächeln lag auf ihren Lippen, als sie aus dem Wasser trat und voller Triumph ihren vollständig geheilten Körper präsentierte.
Er blinzelte ärgerlich. »Das ist kein gerechter Kampf.«
»Ihr seid sterblich. Ich bin es nicht.« Sie lachte kehlig und ließ die Arme fallen. »Habt Ihr denn wirklich geglaubt, es wäre so einfach, König Lugrain?«
Noch immer auf den Knien sitzend, streckte er den verletzten Schwertarm aus und zeigte mit der Spitze der Drachenflügelklinge auf ihre Gestalt. »Ich hätte dich schon beinahe besiegt!«
»Beinahe«, stimmte die Gottheit zu, sie schlenderte um den Hain herum, raffte dabei ihre nasse Tunika, und hinterließ feuchte Fußabdrücke auf dem Gestein. »Aber jetzt stehen die Verhältnisse anders, richtig? Jede Wunde, die Ihr mir zufügtet, König, ist geheilt, aber Eure Wunden …«, sie hielt die Nase in die Luft und atmete genüsslich ein, » … reichen tief.«
»Weil du feige geflohen bist, Monster! Ich hätte dich längst besiegt, wärest du nicht aus einem gerechten Kampf davongerannt.« Schwerfällig kam Lugrain auf die Beine. »Sei es drum. Ich verletzte dich schon einmal, Kreatur, es wird mir ein Leichtes sein, es zu wiederholen!«
Die Gottheit betrachtete Lugrain mit gesunder Vorsicht, als er sich mühsam wieder aufrichtete und den stolzen Rücken durchdrückte.
»Ihr wollt nicht aufgeben?«, fragte sie verwundert über ihn. Neugierig verengte sie ihre schönen Augen. »Trotz Wunden? Trotz, dass ich Euch überlegen bin, sterblicher König?«
Lugrain begann zu grinsen. »Ich habe bisher gerecht gekämpft, aber wenn du mit faulen Tricks und mit Magie kämpfen willst, habe auch ich noch eine Überraschung für dich …«
Sie machte einen ängstlichen Schritt zurück, als sich Lugrains sterbliche Augen in die geschlitzten Pupillen des Wesens verwandelten, das Zazar mit seiner Seele verflochten hatte. Er bleckte die Fänge und knurrte tief in der Brust.
Die Gottheit wurde sichtlich blasser.
»Sie hat Angst, weil du der erste bist, der sie verletzte.«
Ermutigt machte Lugrain einige Schritte auf sie zu. Sie wandte den Kopf etwas zur Seite, als wollte sie zurückschrecken, blieb aber trotzig vor dem Altar stehen, der zu ihren Ehren erbaut worden war.
»So schwer verletzt könnt Ihr unmöglich eine Verwandlung riskieren!«, glaubte sie, doch ihr war ihre Unsicherheit anzuhören.
»Die Gefahr ist es wert«, grollte der Drache.
Lugrain log mit höhnischen Grinsen: »Oh doch, das kann ich. Ich kann mich zu jeder Zeit verwandeln.«
Sie forschte nervös in seinen Augen, dabei machte sie fast unscheinbar einige Schritte zurück.
Lugrain nutzte ihre Unsicherheit aus und sprang mit allerletzter Kraft auf sie zu. Er packte ihre Kehle, sie zog erschrocken die Luft ein, und er drückte sie mit dem Rücken grob über den Altar. Er spürte bereits unter seinen Fingern ihre Haut weich und kühl werden, als wollte sie sich ein weiteres Mal in Wasser auflösen.
Dieses Mal entkam sie ihm nicht, er hob das Schwert an, das sein Schmied mit Hingabe für ihn gegossen, und das Zazar mit Liebe für ihn verzaubert hatte, um genau das zu tun, was er hier gerade tat: Monster zu töten.
»Wartet!«, rief sie erstick, als die Spitze der Klinge in ihren Hals drückte, und verhinderte, dass sie ihm entwichen konnte. »Ist gut, König, Ihr habt mich überzeugt.«
Lugrain runzelte seine markante Stirn. »Was meinst du damit?«
»Ihr müsst mich nicht vernichten!«
»Doch, das muss ich!«, zischte er wütend. »Wir sind im Krieg! Wegen Wesen wie dir! Mein Volk hungert, mein Volk stirb hier. Ich muss die See bändigen, damit meine Fischer wieder Nahrung finden, da die Dämonen den Wildbestand der Wälder fast vollständig ausgelöscht haben. Und anstatt den Sterblichen beizustehen, wie es die Pflicht einer angeblichen Gottheit gewesen wäre, zwingst du meine Völker in die Knie. Lässt sie Hunger leiden. Verschlingst mit deinen Wellen meine kostbaren Schiffe. Verhinderst, dass die Unschuldigen auf Inseln fliehen können, bis ich den Krieg für sie beendet habe!«
Die Wut über die Nachlässigkeit der Kreatur ließ Lugrains Schwertarm zittern.
»Du hast die Wahl«, zischte er drohend, »entweder du ergibst dich meiner Klinge, oder ich verwandle mich in das Wesen, das dazu geschaffen wurde, Kreaturen wie dich zu fressen.« Er drückte ihr das Schwert noch etwas tiefer in die Haut, bis goldenes Blut glitzernd hervorquoll.
»Ich bin noch nie einem Sterblichen wie Euch begegnet«, sagte die Gottheit geradezu fasziniert. »Ihr seid der erste Mann, dem es gelang, so viele unterschiedliche Völker zu einen, und der erste, der König eines wilden, freien Landes wurde. Ein Mann, dem es gelang, einen Halbgott-Halbdämon an sich zu binden. Ein Mann, dem zu folgen es sich lohnt. So stolz, so hartnäckig, selbst im Angesicht des Todes. Ihr wollt Euch selbst opfern, um die Völker zu retten, die Ihr zu schützen geschworen habt … Ein Märtyrer, gewiss. Doch Euren tiefsten Wunsch kennt nur Ihr selbst, und der Drache in Euch. Denn Ihr wollt sterben, selbst wenn Ihr Euer geliebtes Halbwesen dafür im Stich lassen müsst. Ihr wollt sterben, um die wiederzusehen, die Ihr einst geliebt habt. Aber Euer Tod wird Unheil anrichten, König. Euer Sohn wird viel Blut vergießen. Eure Freunde, denen Ihr den Thron überlasst, werden ihn nicht mehr hergeben, Euch werden sie aus der Geschichte verbannen. Und Euer Bellzazar … wird zerbrechen an den Spielen, die die neuen, ach so barmherzigen Götter für ihn bereithalten.«
Lugrain wollte nicht länger zuhören, zu nahe lag die Gottheit an der Wahrheit und an seinen tiefsten Ängsten. »Spar dir deinen letzten Atemzug für dein Todesröcheln auf!« Lugrain wollte zustechen …
»Ich lasse mich von Euch bändigen, König, der über die freien Länder wacht!«
Lugrain hielt überrascht inne.
»Ich werde Euch gestatten, mich zu bannen«, wiederholte die Gottheit, als Lugrain ihr fragend in die dunklen Augen blickte.
Lugrain konnte ihr nicht glauben.
»Sie sagt die Wahrheit.«
Sie könnte uns täuschen.
»Ich werde Euch helfen, den Dämonenfürsten aufzuspüren. Ich werde sogar ohne Aufstand in die Unterwelt gehen und dort verharren, solltet Ihr ihn wahrhaftig besiegen, so wie es jedem vergessenen Gott ergehen wird, solltet Ihr Erfolg haben. Ich werde die See zahm lassen und Euch ihr Siegel anheften, auf dass sie Eure Seele stets erkennt. Ihr könntet durch alle Gewässer dieser Welt schwimmen, ohne dass Euch Gefahr drohen würde. In diesem und in jedem anderen Leben, das folgen sollte.«
»Ich gehe keinen Pakt ein.«
»Pakte schließt man mit Dämonen, König«, tadelte die Gottheit. »Nein, es ist kein Pakt. Ihr wollt mich töten, doch ich ergebe mich freiwillig. Es ist ein friedliches Abkommen. Ein Bündnis!«
Lugrain nahm das Schwert runter und trat einen Schritt zurück. Er war kein Mörder, und wenn er jemanden tötete, der sich freiwillig ergab, wäre es Mord.
Froh war er damit nicht. »Du wirst einfach nur ausharren, bis du eines Tages eine Möglichkeit findest, dich zu rächen«, fürchtete er.
»Nein«, versprach die Gottheit und machte einen Schritt auf ihn zu. »Alles, was ich will, ist Euer Wort, das Ihr eines Tages zurückkehrt und mich wieder frei lasst. Ich werde mich durch das Wort des Königs von Nohva binden lassen, auf dass mich nur der wahre König von Nohva wieder frei geben kann, wenn die Zeiten besser stehen.«
»Und dann wirst du die Fischer wieder vom Weg abkommen lassen? Die Küsten überschwemmen, und mein Volk hungern lassen? Alles, was du mir anbietest, ist etwas Zeit.«
»Nein, König, der über die freien Länder wacht!« Die Gottheit fiel vor ihm auf die Knie.
Lugrain wich erschrocken einen Schritt zurück. Er war nur ein Sterblicher, mit einer verflochtenen Seele, aber dennoch sterblich. Doch vor ihm kniete eine Gottheit.
Wenn das mal kein Ereignis für eine Legende war.
»Ich gelobe dem rechtmäßigen König Nohvas die Treue«, schwor die Gottheit, »sofern er mir die Treue hält. Kommt zurück in diese Welt, König, und gebt mich frei. Vertraut mir, Ihr werdet es bitter nötig haben. Denn Euer Tod wird einen Zyklus beschreiben, den ich zu gegebener Zeit zu durchbrechen weiß. Dafür benötige ich Euer Vertrauen.«
Lugrain sah düster auf die Gottheit hinab. »Warum sollte ich dir glauben?«
»Warum sollte ich lügen?«, warf sie klug ein. »Sobald Ihr mich gebannt habt, bin ich Eurer Gnade ausgeliefert. Ich werde nur dann frei sein, wenn Ihr es wieder gestattet. Genau genommen bin ich es, der großes Vertrauen schenkt.«
»Ich werde sterben«, sagte er eindringlich. »Bald schon.« Dieser Umstand machte ihm Angst, denn er wusste von Bellzazar, dass er nach dem Tod willenlos der Gnade der Götter ausgeliefert sein würde, die er verachtete, für das, was sie Zazar antaten. Weil sie ihn verschmähten.
Das konnte für ihn nicht gut ausgehen.
»Ihr werdet Erben haben«, warf sie ein. »Der rechtmäßige König – Ihr oder Euer Erbe – werden mich freigeben. Ich werde Euch oder ihn daran erinnern, wenn die Zeit gekommen ist.«
»Ein Zyklus, sagst du?« Lugrain rieb sich das Kinn, denn auch Zazar hatte ihn davor gewarnt, die Prophezeiung zu erfüllen.
»Ja. Aber auch Prophezeiungen sind abzuwenden, mein König, jedoch nur, wenn man selbst ein Gott ist … oder zumindest ein halber Gott.« Die Gottheit grinste listig.
Lugrain verstand sofort, sein Gesicht erhellte sich. »Zazar …«
Die Gottheit nickte. »Er wird Eure Seele gänzlich befreien. Und ich werde dafür sorgen, dass ihm nichts geschieht, sollte die Zeit dafür reif sein. Ihr habt mein Wort, König.«
Nun war Lugrain ganz Ohr. »Du schwörst mir, Zazar zu beschützen?«
»Ja«, versprach die Gottheit. »Mit allen erdenklichen Mitteln. Selbst wenn es bedeuten würde, ihn zum Feind der Götter zu machen. Ich werde dafür sorgen, dass er sicher vor ihnen ist, damit er zu gegebener Zeit den Zyklus brechen kann.«
Lugrain spürte sein Herz flattern. Seit er gegen Zazars Willen entschieden hatte, sein Leben für seine Heimat zu opfern, fühlte er sich ihm gegenüber schuldig. Er hatte in seiner Traurigkeit über Zazar hinweg entschieden, ihn zu verlassen, um Surrath wiederzusehen. Jetzt hatte er die einmalige Gelegenheit, wenigstens dafür zu sorgen, dass Zazar sicher sein würde.
Doch das würde seinen Geliebten nicht vor der Einsamkeit schützen, die ihm bevorstand.
»Das halte ich für töricht, nur damit du es weißt.«
Bitte, sei ruhig, lass mich denken.
Er war es Zazar schließlich schuldig. Immerhin hatte Zazar zugestimmt, Lugrains letzten Wunsch wahr werden zu lassen. Er schloss für einen Moment die Augen und ergab sich der Vorstellung, wie so oft seit er Zazar kannte. Er sah ihn bereits in seiner Bettstatt liegen. Nackt. Er sah sich bereits hinabbeugen und den schlanken Hals lecken. Schmeckte bereits die Haut. Spürte bereits die schlanken, kühlen Finger an seinem erhitzten Körper. Fühlte bereits dunkles, kräftiges Haar in seinen Händen … Nach all der Zeit, in der er sich so sehr danach gesehnt hatte, würde Zazar ihm seinen innigsten Wunsch erfüllen. Denn schon übermorgen könnte der Kampf soweit sein. Schon in zwei Nächten könnte er sterben … Und zuvor würde er Zazar noch das egoistische Versprechen abnehmen, nie mehr bei einem anderen Mann zu liegen. Denn diesen Gedanken könnte er nicht ertragen, selbst im Tode nicht.
Er hatte viele Männer geliebt. Nach Surraths Tod hatte er in vielen Lagern gelegen, er hatte zugelassen, dass die zarten Berührungen von Menschen ihn eine Weile heilten, aber es war immer nur ein schwacher Trost gewesen, nur Ablenkung. Zazar … Zazar war der eine, den er immer begehrt hatte. Der eine, für den er eine seltsame Liebe empfand. Tief und innig, eine geradezu verzweifelte Liebe.
Doch sein Herz hatte immer nur Surrath gehört.
Immer.
Aber Surrath wartete bereits in der Nachwelt. In der Welt, in die Zazar ihnen nicht folgen konnte. Lugrain war innerlich zerrissen, weil er nicht sagen konnte, was er lieber täte. Hier bei Zazar bleiben oder sterben und Surrath wiedersehen.
Letztlich war es eine Entscheidung, die sein Herz für ihn traf. Er würde sterben. Surrath war der Mann, zu dem er gehörte.
»In Ordnung«, hörte er sich sagen und öffnete die Augen. »Ich bin einverstanden mit dieser Abmachung.«
Die Herrin der Gewässer grinste.
Lugrain hob sein Schwert und legte die Klinge in die andere Handfläche, er zog die silberne Schneide über die Haut. Sie war so scharf, dass er keinerlei Druck benötigte, um Blut hervorfließen zu lassen.
Er streckte die Hand nach unten. »Ein Blutbann.«
Lachend kam die Gottheit auf die Beine. »Nein, König Lugrain, so bannt man einen Dämon. Aber ich bin ein uralter Gott. Zwar vergessen, aber dennoch göttlicher Natur.« Sie umfing sein Handgelenk mit sanften Fingern, führte seine Hand zu ihrem Mund und leckte keck über die Wunde.
Ungläubig zog Lugrain seine Hand wieder zu sich heran. Die Wunde war geschlossen, nur ein leichter Striemen blieb auf der Haut zurück.
»Und wie bannt man einen Gott?«, fragte er befürchtend.
Die Gottheit flog geradezu auf ihn zu und schmiegte sich an ihn wie ein Seidentuch, das von einer warmen Windböe gegen ihn geblasen wurde.
»Mit Schmerz und Blut bannt man Dämonen«, hauchte sie und nestelte mit den Fingern an der Schnürung seines Umhangs. »Mit Freude und Liebe einen Gott.«
Lugrain versteifte sich …
»Ähm.« Er umfing ihre Handgelenke, entfernte sie verlegen und trat nervös einen Schritt zurück. »Ich fürchte, dazu wird es nicht …«
»Oh, verzeiht, König.« Sie lachte sich in ihre Hand, ihre Wangen färbten sich rot. Sie sah an sich hinab und bemerkte: »Das ist die falsche Gestalt, nicht wahr?«
Mit einer schnellen Drehung veränderte die Gottheit ihren Körper. Aus der wunderschönen jungen Frau wurde der anmutige junge Mann der anderen Seite der Statue.
Lugrain blinzelte, zweifelte allmählich an seinem Verstand.
»So ist es recht?«, fragte der Gott mit plötzlich dunkler, rauchiger Stimme.
Lugrain räusperte sich verlegen. »Ich … ähm …«
»Niemand wird es je erfahren«, versprach er mit dunkler Stimme und löste die Spange der weißen Tunika. Sie fiel raschelnd zu Boden, und er stand nackt da. Das mystische Licht aus dem See der Grotte strahlte auf seinen sagenhaften Körper. Er war wunderschön. Anmutige Muskeln, groß und schlank, wie ein junger Schwertkämpfer. Die Schultern breiter als die umwerfend schmalen Hüften … Lugrain hätte ihn gern von hinten gesehen …
Er schüttelte den Kopf. Wusste, dass seine Trance teils davon verursacht wurde, dass er sterblicher Natur war und von einem Gott verführt wurde.
Doch als der Gott an ihn heran schwebte und erneut an seinem Umhang nestelte, hielt Lugrain ihn nicht zurück.
Der Umhang fiel zu Boden, und Lugrain starrte mit dunkler Lust in die großen Augen des perfekten Gesichts. »Was ist deine wahre Gestalt?«
»Ich bin ein Gott«, erinnerte er Lugrain schmunzelnd, »genau genommen habe ich keine wahre Gestalt. Ich bin weder richtig männlich, noch richtig weiblich. Ich bin göttlich.«
Lugrains Finger wanderten wie von selbst in das kühle, dunkle Haar, das ihn vom ersten Anblick an sehr an Bellzazars schönes Haar erinnert hatte. Es war kurz, aber dennoch nicht zu kurz, sodass es ihm ein Leichtes war, in die kräftigen Strähnen zu packen und den Kopf in den Nacken zu zwingen. Vor ihm präsentierte sich eine schlanke Kehle. Er beugte sich vor und fuhr mit der Zunge eine kräftige Sehne entlang nach oben.
Hatte je ein Sterblicher die Haut einer Gottheit kosten dürfen? Selbst wenn es sich hier nur um einen Gott handelte, an den niemand mehr glaubte?
Er hob den Kopf und sah in das lüsterne Gesicht, das ebenso begierig zu sein schien wie er selbst es war. »Wie lautet dein Name?«
Der Gott antwortete schmunzelnd: »Levidetha.«
»Haben wir eine verbindente Abmachung, Levidetha?«
»Ja, König Lugrain.« Levidethas Finger fuhren gespreizt über Lugrains Brustpanzer nach oben und zerrten ihn dann an den Schultern zum Altar. »Liegt bei mir, und wenn Ihr gut genug seid, habt Ihr die See gebannt. Kommt, und nehmt mich. Kostet von dem, das nur wenige vor Euch kosten durften. Zeigt mir, welche Macht in einem wahren König steckt, und wenn sie mir groß genug erscheint, lass ich mich bezwingen.«
»Und wenn nicht?«
Nicht, dass er Zweifel an seinem Können diesbezüglich hätte.
Levidetha grinste: »Nur ein wahrhaft mutiges Herz vermag es, einen Gott zu bannen. Seid Ihr nur dem Titel nach ein König, aber nicht im Herzen, wird Euch meine Macht bei der Vereinigung noch heute Nacht das Leben kosten.«
Aber Lugrain war der einzig wahre König!
»Hoffentlich tötet uns dein Stolz heute Nacht nicht.«
Vertrau mir, so wie ich dir, bat er den Drachenteil in sich.
Lugrain ließ sich zum Altar führen, zarte Finger lösten die Riemen seiner Rüstung, während sein Mund mit den Lippen Levidethas verschmolz. Nach und nach wurde ihm mit spielerischer Neckerei die Rüstung abgestreift. Nach und nach wurden seine Wunden geheilt, nur durch eine sanfte Berührung der kühlen Hände, die über seinen starken Kriegerkörper strichen.
Der Drache in ihm grollte lüstern. »Das ist besser, als ihn zu töten.«
Wenn doch nur jeder Kampf so schön ausgehen könnte …
Lugrain bettete den nackten Körper Levidethas auf dem Blumenmeer des Altars und schob sich nackt zwischen seine kühlen Schenkel. Die Haut, die er berührte, war kühl wie Wasser, an manchen Stellen war es so, als tauchte er die Fingerkuppen in die Oberfläche eines Sees. Levidetha schmeckte nach Salz, wie das Meer, das er beherrschte.
Lugrain beugte den Kopf hinab und legte die Lippen an das Ohr der Gottheit. »Hiermit banne ich dich, Gott der Gewässer«, hauchte er und drang mit einem dunklen Stöhnen in den kühlen Körper ein, der sich ihm augenblicklich entgegenwölbte. »Auf dass du vom heutigen Tage an nur dem wahren Königsblut treu ergeben sein wirst!«