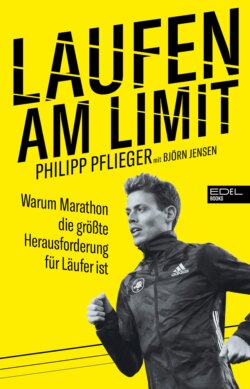Читать книгу Laufen am Limit - Björn Jensen - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
KILOMETER 6 TRAINER
ОглавлениеZählt man zu den glücklichen Menschen, die gesund sind, dann ist Laufen wahrscheinlich der einfachste Sport, den man sich aussuchen kann. Trainingsklamotten überwerfen, Schuhe anziehen – und los geht’s! Wer einmal laufen gelernt hat, verlernt es in der Regel nicht mehr. Deshalb mag es auch unter euch einige geben, die sich diese Frage stellen: Wofür braucht ein professioneller Läufer überhaupt einen Trainer?
Nationale Konkurrenten wie der deutsche Marathon-Rekordhalter Arne Gabius oder der mehrfache deutsche 5000-Meter-Meister Richard Ringer haben keine Trainer mehr und kommen damit gut zurecht. Gute Gründe, mit einem Trainer zusammen zu arbeiten, gibt es trotzdem.
Der wichtigste Grund ist: Als Leistungssportler fehlt einem oft die nötige Objektivität, die eigene Leistung zu beurteilen. In kritischen Situationen, sei es eine Formschwäche oder eine Verletzung, neigt man dann zu falschen Entscheidungen. Vor allem ist die Gefahr groß, dass man in solchen Phasen mehr trainiert, als einem guttut. Das bewusste Zurückschalten, um dem Körper eine notwendige Pause zu verschaffen, funktioniert bei vielen nicht, wenn es nicht eine neutrale oder, besser gesagt, objektive Instanz gibt, die auf solche Dinge achtet. Und das ist für mich ein Trainer.
Mein langjähriger Trainer Kurt Ring musste seine eigene Karriere mit Ende 20 aufgrund anhaltender Verletzungsprobleme beenden. Im Hauptberuf war er Grundschullehrer, er unterrichtete auch Sport und wusste deshalb, dass ihm die Arbeit mit jugendlichen Sportlern liegt. Er hat nie einen der höheren Trainerscheine gemacht, die man braucht, um Bundestrainer zu sein, aber er hat mittlerweile mehr als 40 Jahre Erfahrung im Coaching.
Was braucht es, damit eine Symbiose zwischen Trainer und Sportler gelingt? Ich bin überzeugt: Nur bilaterales Vertrauen und Offenheit können zu gemeinsamem sportlichem Erfolg führen. Gerade in der osteuropäischen Schule findet man Verhältnisse, in denen der Trainer eine Art Diktator ist, der seinen Sportlern Befehle zubellt, die diese dann befolgen. Dass in einer solchen Beziehung intime Gespräche möglich sind, wage ich zu bezweifeln. Solche Gespräche aber muss man führen können, um das Maximum aus dem Athleten herauszukitzeln. Deshalb kann ich für mich behaupten, dass ich nie mit einem Trainer arbeiten könnte, der mir nicht das Gefühl vermittelt, auf gegenseitiges Vertrauen zu bauen.
Ich bin ein Mensch, der Beständigkeit sucht. Es gibt Sportler, die alle zwei Jahre den Verein – und damit auch den Trainer – wechseln. Ich war zwölf Jahre in Regensburg beim selben Coach, war davor zehn Jahre beim VfL Sindelfingen und hatte dort mit Harry Olbrich und Frank Zimmermann nur zwei Trainer. Ich schätze mich sehr glücklich, dass ich stets mit Trainern arbeiten durfte, zu denen ich ein persönliches Verhältnis aufbauen konnte. Allen dreien verdanke ich sehr, sehr viel, sie haben mich geprägt und auf meinem Weg, mich im Profisport zu behaupten, leidenschaftlich begleitet.
Auf dem Papier sind sie „Trainer“, in der Realität und durch das gemeinsam Erlebte aber viel mehr für mich. Bei Frank und seiner Frau saß ich oft beim gemeinsamen Abendessen, und wir haben über alles Mögliche geredet. Kurts Frau Doris kümmert sich in Regensburg um das Athletik- und Koordinationstraining sowie die Planung und Organisation der Trainingslager. Ich habe mich nie gefühlt wie eine Vertragsnummer auf einem Blatt Papier, sondern immer als Mensch mit all seinen Stärken und Schwächen. Natürlich ändert sich die Beziehung, je länger sie dauert, ein 18-Jähriger fordert seinen Trainer ganz anders, als es ein 30-Jähriger tut, der mehr Eigenverantwortung mitbringt, aber auch mehr hinterfragt. Letztlich geht es doch darum, dass man sich die Verantwortung für die Karriere teilt und gemeinsam daran bastelt, sie zum bestmöglichen Ergebnis zu bringen.
„Jetzt ist der Trainer als Psychologe gefordert“, das ist so ein Satz, den jeder aus den Medien kennt. Ich mag ihn nicht besonders, weil es für die Arbeit, die Psychologen tun, ja längst auf Leistungssport spezialisierte Mentaltrainer gibt. Allerdings wird deren Arbeit in Deutschland noch zu oft stigmatisiert – wer einen Mentaltrainer braucht, hat eine Schraube locker. Und deshalb stimmt der obige Satz eben doch ein Stück weit, denn häufig übernimmt der Trainer, wenn er das nötige Gespür für menschliche Bedürfnisse, sprich: Empathie besitzt, die Aufgabe eines seelischen Entwicklungshelfers.
Fakt ist: Wenn der Kopf nicht frei ist, wenn also der Athlet Streit in der Familie hat oder Zukunftsängste, wenn er sich vor der zu hohen Norm fürchtet oder ihn eine Verletzung hemmt, dann ist physische Höchstleistung nicht erreichbar. Ein guter Trainer spürt das und sucht das Gespräch. Ein guter Athlet kommt ihm zuvor und erzählt von sich aus. Das kann alles nur gelingen, wenn Vertrauen da ist.
Ja, natürlich muss ein Trainer auch eine Autoritätsperson sein. Er ist der Chef, der am Ende die Entscheidungen trifft, und auf diese muss sich ein Athlet dann auch verlassen. Aber weil Kurt und ich uns schon lange kennen, konnte ich auch mit ihm vor der Gruppe über Trainingsinhalte diskutieren, und zwar ergebnisoffen. Wenn wir nicht übereinstimmen, überließ ich ihm in der Regel das letzte Wort. Aber das Gefühl, bei diesen Entscheidungsprozessen mitgenommen zu werden, ist ein gutes.
Ich gebe euch ein Beispiel. In einem Wintertrainingslager in Portugal hatte Kurt am letzten Tag eine sehr intensive Einheit angesetzt. Ich war müde von den zehn Trainingstagen und bezweifelte, dass ich den Plan zu unserer Zufriedenheit würde durchziehen können. Kurt war anderer Meinung. Darüber diskutierten wir, mit dem Ergebnis, dass ich es versuchen sollte. Es gelang, sogar sehr gut. Kurt war zufrieden, dass es gelungen war. Ich war zufrieden, weil er Vertrauen in mich gesetzt hatte, das ich erfüllen konnte. Er hatte mir wieder einmal gezeigt, wie gut er darin ist, Menschen einzuschätzen.
Obgleich ich die psychische Komponente als wichtigsten Grund dafür ansehe, mit einem Trainer zu arbeiten, will ich den fachlichen Einfluss natürlich auch würdigen. Zum einen sorgt ein Trainer dafür, dass sich die Inhalte der Übungseinheiten verändern und dadurch stets neue Reize gesetzt werden, ohne die der Athlet irgendwann stagnieren würde. Zum anderen ist die Expertise, die ein Coach während der Einheiten oder Wettkämpfe einbringt, sehr wichtig, auch wenn sie in ihrer Intensität durchaus variiert.
Lasst mich an dieser Stelle schon mal kurz beschreiben, wie mein Training überhaupt aufgebaut und konzipiert wird. Aus der Analyse der vorangegangenen Saison entwickelt man eine Strategie mit Zwischen- und Hauptzielen für die neue. Daraus entwirft der Trainer einen groben Trainingsplan, der später Tag für Tag an die Bedürfnisse und den Gesundheitszustand angepasst wird. Grundsätzlich ist es so, dass Kurt nicht bei jeder Laufeinheit dabei war. Wenn ich morgens an einem sogenannten „Zwischentag“ meinen Plan ablaufe, brauche ich niemanden, der mich dabei auf dem Rad begleitet.
Aber bei den Vereinstrainings am Montag-, Mittwoch- und Freitagabend ist er immer dabei, genau wie seine Frau, die das Warm-up anleitet. Am Mittwoch- und Samstagvormittag stehen zudem die härtesten Einheiten der Woche auf dem Programm, samstags ein besonders langer Lauf, wo Kurt meist auch anwesend ist. Am Ende jeder Trainingswoche schicke ich ihm mein Trainingsprotokoll, das ich jeden Tag aktualisiere. Daraus leitet er dann die Schlussfolgerungen für die nächste Woche ab. Ihr merkt: Vertrauen ist auch hier unabdingbar. Würde der Athlet falsche Angaben machen, die der Trainer nicht kontrollieren kann, würde das den Plan der Folgewoche negativ beeinflussen.
Und nicht dass ihr denkt, unehrliche Sportler würden einfach ein paar Kilometer mehr angeben, als sie tatsächlich gelaufen sind, oder ihre Zeiten ein paar Sekunden besser machen, als sie waren. Nein, die meisten Athleten neigen dazu, ihre Leistungen eher schlechtzureden, weil sie das Gefühl haben, mehr machen zu müssen, als der Trainer ihnen abverlangt. Der Trainer muss also seine Sportler eher bremsen als antreiben. Das ist nicht leicht, Fußfesseln wären Freiheitsberaubung, und wer nicht jede Einheit kontrolliert, muss damit leben, dass ein Trainingsplan nicht immer zu 100 Prozent umgesetzt wird.
Aber niemand kann jeden Tag mit 110 Prozent Leistung fahren, das Pedal stets bis auf den Boden durchtreten. Kurt sagt gern, dass nicht jeder Tag Wettkampf ist und niemandem geholfen ist, wenn er an den „Zwischentagen“ mit regenerativem Training mit Sonderschichten zu glänzen versucht. Der Körper nimmt sich seine Pausen sonst in Form von Krankheiten oder Verletzungen. Da ist es besser, wenn man die Pausen selbst bestimmt. Das musste ich lernen, und dabei hilft ein Trainer ungemein.
Auch der direkte Einfluss eines Übungsleiters ist nicht zu unterschätzen. Wenn wir im Training auf der Bahn oder im Gelände eine festgelegte Distanz auf Zeit laufen, hat jeder eine Uhr dabei, auf der er seine Runden- oder 1000-Meter-Zeit kontrolliert. Der Trainer überwacht das und kann eingreifen, wenn das Tempo verschärft oder gebremst werden sollte. Es kam auch nach 20 Jahren in meinem Sport noch vor, dass er meinen Laufstil korrigierte. Ich bin als Bahnläufer groß geworden und habe auch jetzt noch den unverkennbaren Laufstil: hohe Knie, gutes Anfersen (das Heben der Ferse in Richtung Po). Das ist ein guter Stil, um schnell zu laufen. Absolute Laufstil-Ästheten, was das anbelangt, sind zweifellos Topstars wie Kenenisa Bekele oder Mo Farah.
Weil das allerdings auch ein sehr aufwändiger Stil ist, ist er für den Marathon, wo es in erster Linie auf Ausdauer und nicht auf Schnelligkeit ankommt, nicht unbedingt geeignet. Deshalb erinnert mich Kurt im Training bisweilen daran, dass ich flacher bleiben muss, um den Körperschwerpunkt möglichst nah am Boden zu halten. Das ist ökonomischer. Den Laufstil nachhaltig zu verändern, ist sehr schwierig. Er ist fast wie ein Fingerabdruck: Wir laufen, wie es uns in die Wiege gelegt wurde. Aber korrigierend einzugreifen, ohne Grundlegendes zu ändern, das ist schon möglich. Es funktioniert zum Beispiel auch nach Verletzungen, wenn man aus Schonhaltungen heraus anders belastet, als es natürlich wäre. Auch das sieht ein guter Trainer und wird darauf hinarbeiten, dass der Läufer zum gewohnten Stil zurückgelangt.
In solchen Fällen wird ausnahmsweise auch mal mit Videoanalyse gearbeitet, um dem Athleten seine Fehler zu verdeutlichen. Im Allgemeinen ist Videoanalyse bei uns Langstrecklern nicht verbreitet. Sprinter und vor allem Springer nutzen sie deutlich mehr, weil es bei ihnen auf die einzelnen Schritte ankommt. Für uns sind ganz normale Besprechungen der Einheiten das Mittel der Wahl, um gemeinsam Anpassungen am Trainingsplan zu erarbeiten. Im Trainingslager gibt es diese Gespräche täglich, im Alltag nach Bedarf.
Eine Besonderheit stellt das Coaching im Wettkampf dar. In der Vorbereitung unterscheiden wir zwei Arten von Rennen. Bei dem einen muss man eine möglichst schnelle Zeit laufen. Da ist vorher wenig zu besprechen, denn jeder Läufer kennt seinen Fahrplan, die entsprechenden Zwischenzeiten und weiß aus seiner Erfahrung und instinktiv, wo er sich im Feld einordnen und wann er sein Tempo anziehen kann, um so die optimale Zeit zu erlaufen.
Die zweite Art sind die Rennen, die man taktisch läuft; in der Regel sind das Meisterschaftsrennen, wo es rein um die Platzierung geht. Vor diesen Rennen ist deutlich mehr Vorbesprechung notwendig, damit der Athlet in den entscheidenden Rennsituationen die richtige Entscheidung treffen kann.
Warum das alles in Vorgesprächen abgearbeitet werden muss? Ganz einfach: Weil im Rennen selbst ja oft keine Möglichkeit der Verständigung besteht. In kleineren Stadien hört man die Stimme seines Trainers schon, darauf ist man in gewisser Weise konditioniert. Aber in größeren Arenen ist es laut, der Abstand zwischen Bahn und Bande oder Tribüne ist groß. Also muss vor den Rennen, in der Regel bereits am Vorabend, alles besprochen sein.
Beim Marathon gibt es zudem die Regel, dass Coaching von außen nicht erlaubt ist. Nicht einmal der begleitende Helfer, der mit dem Rad von Verpflegungsstation zu Verpflegungsstation vorausfährt, um Getränke und Nahrung zu reichen, darf den Athleten ansprechen. Kurt saß bei Marathons deshalb meist im Führungsfahrzeug. Das ist das Auto mit der großen Digitaluhr auf dem Dach, das der Gruppe der Eliteläufer voranfährt, um ihnen die Zeit anzuzeigen. Von dort hat er Einblick in das gesamte Rennen, was von einer Position irgendwo an der Strecke nicht der Fall wäre. Aber weil das Auto eben vorneweg fährt, hätte er auch gar nicht die Möglichkeit, Kontakt mit mir aufzunehmen, selbst wenn es gestattet wäre.
Dass es hier und da auch mal Konflikte in der Trainer-Athleten-Beziehung, ist nicht ungewöhnlich. Reibereien gibt es immer mal, das gehört dazu. Kurt zum Beispiel ist ein Trainer der alten Schule, der mit den heutigen Auswüchsen des kommerziellen Profisports wenig anfangen kann. Das mag auch darin begründet sein, dass er schon erleben musste, wie seine Schützlinge betrogen wurden. Ich erinnere hierbei ungern an Corinna Harrer, die 2012 bei den Olympischen Spielen im Halbfinale über 1500 Meter Siebte wurde und den Endlauf nur um 23 Hundertstelsekunden verpasste. Heute weiß man: Sie wäre Sechste geworden, und zwar insgesamt. Alle anderen Konkurrentinnen vor ihr wurden nachträglich des Dopings überführt.
Solche Erlebnisse schmerzen empathische Trainer wie Kurt sehr, sodass ich seine gemischten Gefühle zu meiner Entscheidung, auf die Profikarte zu setzen, nachvollziehen kann. Denn er weiß, dass im internationalen Profisport eben nicht jeder nach den Regeln spielt und man als sauberer Sportler trotzdem gegen ebenjene schwarzen Schafe antreten wird. Dennoch hat er meinen Traum von der Olympiateilnahme geteilt und mit Leidenschaft mitgelebt. Diese Erfahrungen und diese Unterstützung möchte ich nicht missen und werde sie auch nie vergessen.