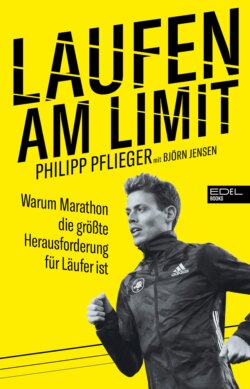Читать книгу Laufen am Limit - Björn Jensen - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
EINLEITUNG DAS RENNEN MEINES LEBENS
ОглавлениеDie Nacht sollte der Freund des Athleten sein, der Körper regeneriert im Schlaf am besten. Doch diese Nacht ist ein Alptraum. Ich liege wach unter meiner Decke und schaffe es einfach nicht, das Gedankenkarussell zu stoppen. Immer wieder schaue ich auf mein Handy. Wie viel Uhr ist es? Wann hat dieses Warten endlich ein Ende? Frustriert sinke ich ins Kissen, weil die Ewigkeit nur eine halbe Stunde dauerte. Im Bett neben mir, in diesem Doppelzimmer in einem Berliner Hotel, liegt Jonas Fischer, mein langjähriger Teamgefährte und Freund. Er schläft. Er weiß, was mir am nächsten Tag bevorsteht. Er weiß nicht, dass ich deshalb kein Auge zukriege. Aber was würde es auch helfen? Besser, er schläft, dann ist immerhin einer von uns beiden fit. Schließlich geht es um alles.
Das ist, was mich von schönen Träumen abhält. Diese Endgültigkeit. Ich kann sehr konsequent sein. Und in den Tagen vor diesem Rennen am 27. September 2015 habe ich entschieden, dass ich meine Läuferkarriere beenden werde, für die ich fast 20 Jahre lang alles gegeben habe, sollte es nicht funktionieren. Sollte ich beim anstehenden Marathon scheitern und die Zeit, die ich mir vorstelle, nicht schaffen. Dann ist ein für alle Mal Schluss mit dem Laufen als Profi, noch hier, in Berlin.
Mit 20 dachte ich, Marathon sei etwas für Läufer, die zu langsam für die Bahn sind. Meine Strecke waren damals die 5000 Meter. Im Laufe der Jahre änderte sich das jedoch und ich stellte fest: Marathon ist die Königsdisziplin des Laufens. Denn die Marathondistanz vereint zwei Anforderungen: Ausdauervermögen, gepaart mit Tempohärte in einem Belastungszeitraum von etwas mehr als zwei Stunden.
2014 nahmen mein Trainer Kurt Ring und ich mein Marathon-Debüt in Angriff. Ich meldete mich für den Frankfurt-Marathon an, der traditionell am letzten Oktober-Wochenende stattfindet. Ab Ende Juli begann ich mit der Vorbereitung. Kurt war skeptisch. Er sah, dass ich nicht in der nötigen Form war. Doch mein Ansporn – man kann auch sagen: mein falscher Ehrgeiz – war größer. Ich wollte mir und meinem Umfeld beweisen, dass ich es schaffte. Dazu musste ich, so dachte ich, einfach nur mehr Umfänge trainieren als vor einem Zehner oder einem Halbmarathon. Um andere entscheidende Dinge bei einem Marathon wie Ernährung und Flüssigkeitszufuhr machte ich mir keine Gedanken.
Ich rannte sozusagen in mein Verderben und bekam prompt die Quittung. Ich lief in einer Gruppe mit Julian Flügel, damals bereits ein arrivierter Marathon-Läufer. Bis Kilometer 30 blieb ich an ihm dran, dann aber verlor ich den Kontakt, und alles verschwand im Nebel. Ich ignorierte sämtliche Warnsignale des Körpers. Schwindel, ein Kribbeln in den Händen? Einfach weiterlaufen! Ich erinnere mich gerade noch, wie ich bei Kilometer 35 nahe der Messe an unserem Teamhotel vorbeirannte. Zwei Kilometer weiter lag ich auf der Straße, nichts ging mehr. Kreislaufkollaps, Zusammenbruch, Filmriss. Passanten, erzählte man mir später, führten mich in den Sanitäterbereich. Eine neue Definition von Scheitern.
Ich brauchte gut zwei Monate, bis ich wieder Laufschuhe anziehen konnte. Mein sportlicher Lebenstraum seit Kindertagen war die Teilnahme an den Olympischen Spielen. In dieser Phase fehlte mir jegliche Vision dafür. Ein neuer Marathon-Versuch war damals so weit weg für mich wie Donald Trump vom Friedensnobelpreis. Ich war in dieser Zeit unausstehlich, haderte mit mir und zweifelte an allem.
Es war Felix Plinke, mein langjähriger Teamgefährte der mich wieder ans Laufen brachte. Ohne mein Wissen buchte er zusammen mit meinem Trainer für Januar einen Flug ins Trainingslager nach Portugal. Und dort reifte der Plan, im September 2015 in Berlin die Olympianorm für Rio 2016 anzugreifen. Der Verband setzte sie auf 2:12:15 Stunden an. Eine Zeit, die für mich zu jenem Zeitpunkt kaum erreichbar schien.
Wir nutzten das Frühjahr, um zuerst meine Halbmarathon-Zeit zu verbessern und meine Tempohärte zu trainieren. Was das Wichtigste war: Ich trainierte jetzt mit einer ganz anderen Einstellung und nahm den Marathon endlich so ernst, wie es notwendig ist. Es klingt komisch, aber statt drei sehr intensiver Einheiten pro Woche machte ich nur noch zwei und hatte zwei ganze Tage Regeneration dazwischen. In der Folge verringerte sich das Verletzungsrisiko und erhöhte sich mein Leistungsoutput.
Was ich unter „sehr intensiver Einheit“ verstehe? Darauf werde ich später gesondert noch eingehen. Aber auch wenn es die perfekte Marathon-Vorbereitung nicht gibt, weil man immer etwas findet, das man beim nächsten Mal anders machen würde, die Umstände jeweils andere sind: Ich fühlte mich perfekt vorbereitet, als es in Richtung Berlin ging.
Warum ich mir diesen riesigen Druck auferlegte, als ich mir sagte, ich würde aufhören, sollte es in Berlin schiefgehen, kann ich im Rückblick nicht so genau sagen. Mein Gefühl war: Du hast alles an Energie hineingesteckt, mehr geht nicht. Aber auch in ökonomischer Hinsicht war es eine schwierige Zeit. Ich hatte zwar ein paar kleinere Sponsorenverträge, am Jahresende blieb aber nicht mehr als die schwarze Null – wenn es gut lief. Dieses Gesamtpaket wog schwer. Vielleicht brauchte ich diesen Druck aber auch, um mich zu pushen. Leistungssportler sind ja oftmals Extremisten, suchen diesen besonderen Kick, dieses Entweder–Oder, Hopp oder Topp. Tod oder Gladiolen, wie es der frühere Bayern-Trainer Louis van Gaal formuliert hat.
In den grauen Morgenstunden, die kein Ende nehmen, denke ich daran, was ich aufs Spiel setze. Was mache ich mit meinem Leben, wenn der Sport nicht mehr ist? Ich habe keinen Plan B. Nur einen Bachelor in Politik-, Medienwissenschaft und Geschichte. Ganz okay, aber die Miete zahlt er dir nicht. Was also, wenn es schief geht? Um 4.30 Uhr wälze ich mich endlich aus dem Bett. Vor einem Wettkampf, der im Marathon klassisch am Morgen beginnt, steht der Athlet grundsätzlich früh auf. Der Kreislauf muss in Gang gebracht werden. Für mich ist es eine Erlösung.
Mit Jonas laufe ich durch das noch dunkle Berlin Richtung Tiergarten. Die Morgenluft tut gut. Zum Frühstück würge ich zwei Semmeln herunter. Ich habe keinen Appetit, leichte Übelkeit schnürt mir die Kehle zu. Aber Jonas, der an diesem Tag die Verpflegung mit dem Fahrrad an den dafür vorgesehenen Stationen für mich bereithalten wird, zwingt mich zum Essen, zur Energiezufuhr. Ich würde am liebsten ihn fressen, aber ich weiß, ich sollte ihm dankbar sein.
Nach dem Frühstück gehen wir nochmal aufs Zimmer, bis der Shuttlebus uns vom Hotel in den Startbereich bringt. Wettkampfequipment kontrollieren, zusammenpacken. Die Fahrt ist wie der Weg zum Schafott: Was mache ich hier eigentlich? Warum tue ich mir das an? Neben dem abgesperrten Elitebereich, wo die Spitzenläufer ihre Sachen deponieren, hat die ARD ihren Übertragungspunkt aufgebaut. Ralf Scholt, der Moderator, und die Lauflegende Dieter Baumann, der als Experte fungiert, beobachten die ankommenden Athleten. In der Übertragung werden sie sagen, der Pflieger habe ängstlich ausgesehen – angesichts meines psychischen Zustandes halte ich das bis heute für eine freundliche Untertreibung.
Es widerstrebt mir kolossal, das Warm-up zu beginnen, denn es führt zwangsläufig an die Startlinie. Doch dann kommt die Wende. Bald merke ich: Die Beine fühlen sich gut an. Und das Wetter ist top! Kühl, aber sonnig und vor allem windstill. So wie ich es mag. Zehn Sekunden Countdown bis zum Start, sie fühlen sich an wie eine Ewigkeit – als der Schuss fällt, bin ich bereit.
Wie ist es möglich, dass genau in dem Moment, wenn es beginnt, der Fokus auf dem Rennen liegt? An einem Tag mit so wenig Schlaf? Es ist ein Wunder, für das ich keine rationale Erklärung habe.
Nach der zweiten Verpflegungsstation oder zehn Kilometern bin ich voll im Rennen und komplett bei mir, befinde mich in dem sagenumwobenen Flow-Zustand. Nichts kann mich ablenken. Ich habe diesen Zustand nicht oft erreicht, doch an diesem Tag fühle ich mich als Herr der Lage, weiß, dass ich alles schaffen kann.
Der Knackpunkt kommt erneut nach 30 Kilometern. In unserer zwölfköpfigen Gruppe, die sich aus deutschen und internationalen Läufern zusammensetzt, sind drei Tempomacher, zwei Kenianer und Simon Stützel, ein guter Freund und Teamkollege von Julian Flügel, dem Mann, dem ich ein Jahr zuvor in Frankfurt nicht folgen konnte. Simon steigt bei der Halbmarathon-Distanz aus, die Kenianer bei 25 beziehungsweise 30 Kilometern. Ich habe mich aus der Defensive, aus der ich gestartet war, in die Mitte vorgekämpft. Als der letzte Hase aussteigt, passiert, was oft passiert, wenn die Tempomacher das Rennen verlassen und sich die Gruppe neu sortieren muss: Kilometer 31 ist zehn Sekunden langsamer als die Kilometerzeiten davor, was wir auf einer Uhr sehen, die auf dem vor uns fahrenden Führungsfahrzeug angebracht ist.
Plötzlich schießt ein Läufer aus der Gruppe an mir vorbei, ein weiterer folgt ihm. Es sind Willem van Schuerbeeck und Florent Caelen, zwei Belgier. Aus einem Reflex heraus nehme ich die Verfolgung auf. Schnell lassen wir die anderen neun hinter uns. Den 32. Kilometer laufen wir in 3:02 Minuten – ein Tempo, das einer Zielzeit von 2:08 Stunden entspricht. Das werde ich niemals durchhalten können. „Jetzt ist dein ganzer Rennplan hinüber“, schießt es mir durch den Kopf.
In Gruppen zu laufen, macht Sinn. Man teilt sich die Tempoarbeit und kann im Windschatten laufen. Jetzt bin ich die letzten elf Kilometer mit den beiden Belgiern unterwegs, deren Taktik sich mir nicht ansatzweise erschließt. Immer wieder verschärfen sie abwechselnd das Tempo. Wollen sie den anderen demoralisieren? Und warum bleibe ich dran? Aus purem Trotz? Ein solch langer Dreikampf in der Endphase eines Marathons ist nicht gerade alltäglich. Aber der Rest der Gruppe macht keinerlei Anstalten aufzuschließen, und so bleibt mir keine Wahl: Wenn ich eine starke Zeit laufen will, muss ich dranbleiben. Adrenalin schießt mir ins Blut.
Als das Brandenburger Tor in Sicht kommt, überflutet mich ein Glücksgefühl. Ich ziehe das Tempo noch einmal an, in der Überzeugung, dass hinter dem Berliner Wahrzeichen der Zieldurchlauf sei. Tatsächlich liegt er 400 Meter weiter … Mit fast 42 Kilometern in den Beinen können 400 Meter eine Tortur sein. Mein ganzer Körper brennt. Aber es geht alles gut. 150 Meter vorm Ziel ist klar, ich laufe eine 2:12. Sollte das die Zeit gewesen sein, die ich nie mehr im Leben verbessern werde, dann ist das okay. Für mich war es ein perfektes Rennen.
Bei 2:12:50 Stunden bleibt die Uhr für mich stehen. Eine Sekunde vor mir läuft Willem als 15., eine Sekunde hinter mir Florent als 17. ins Ziel. Ich habe die Norm für Olympia um 35 Sekunden verpasst. Aber es ist eine gute Zeit, und ich weiß: Ich werde weitermachen mit dem Laufen!
Kurz danach kommt der Schmerz. 42,195 Kilometer bin ich über die Straßen Berlins gelaufen, in dem Moment, in dem ich aufhöre, sticht es in meinem rechten Fuß. Das Sprunggelenk ist nicht einverstanden mit den Strapazen. Ein Ödem kündigt sich an, das mich in den nächsten Wochen plagen wird. Im Sanitäterzelt ziehe ich meine schwarzen Laufschuhe aus. Meine Socken sind vorne tiefrot, sie triefen vor Blut. Der Stoff hat sich ins Fleisch meiner Zehen gebrannt. Während des Laufs habe ich davon nichts gemerkt. Neben den Schmerzen ist da aber noch ein Gefühl, das alles überstrahlt: tiefe Genugtuung.
Als Athlet hat man kaum Zeit, Erfolge zu genießen. Es stehen Interviews an, mit denen man nicht rechnet. Es gibt Siegerehrungen, Pressekonferenzen, jeder will irgendwas von einem. Erst nachmittags gegen 16 Uhr sitze ich mit meinen Eltern, Jonas und meinem Trainer in der Hotelbar und trinke zwei Bier. Geduscht habe ich da noch nicht, keine Zeit. Mit meiner Freundin Barbara telefoniere ich zwischen Tür und Angel. Sie hat das Rennen im Fernsehen verfolgt.
Abends gibt es eine After-Show-Party in einem Berliner Club. Jonas und ich geben mächtig Gas bis in die Morgenstunden. Verrückt, wozu der menschliche Körper imstande ist. 24 Stunden am Stück bin ich wach gewesen, habe einen Marathon in weniger als 2:13 Stunden geschafft und dann die Nacht durchgefeiert.
Die Quittung bekomme ich nach nur vier Stunden Schlaf, weil der Trainer nach Regensburg zurückwill. Meine Oberschenkel tun so dermaßen weh, dass ich beim Aufstehen direkt wieder ins Bett zurückfalle. Die paar Meter ins Bad sind die Hölle. Auf dem Weg zum Frühstücksraum treffe ich Eliud Kipchoge, den Marathon-Star aus Kenia, den Sieger des Rennens, und spreche ihn an: „Stairs or elevator?“ „Elevator“, ruft er, „elevator!“ Auch dem besten Marathon-Läufer der Welt tun nach einem Rennen die Beine weh. Finde ich sehr erleichternd.
Auf der After-Show-Party erfahre ich übrigens, was die beiden Belgier angetrieben hat, wie um ihr Leben zu rennen: Sie waren beide der Auffassung, dass nur der Bessere von ihnen zu Olympia nach Rio fahren dürfe, da es in ihrem Team noch einen anderen Läufer gab, dem die Norm locker zugetraut wurde, der allerdings nicht in Berlin am Start war. Die Ironie des Ganzen: Ihr Landsmann verpasste die Norm und am Ende fuhren sie beide nach Brasilien. Ich traf sie bei den Olympischen Spielen in Rio wieder. Aber Berlin war das Rennen unseres Lebens, das uns irgendwie immer verbinden wird. Bis heute sage ich, dass es das wichtigste sportliche Ereignis meines Lebens war.
Warum Marathon bei aller Plackerei, aller Schmerzen und Entbehrungen eine so riesengroße Faszination ausübt, nicht nur auf mich, sondern auf so viele Millionen Menschen, weltweit? Warum ich überhaupt bei Olympia in Rio 2016 dabei war, wo ich doch in Berlin die Norm, wenn auch super knapp, verpasst hatte? Warum ich auch in Tokio 2020 wieder dabei sein will? Das sind einige der Fragen, denen ich in den nächsten 42,195 Kapiteln nachgehe.